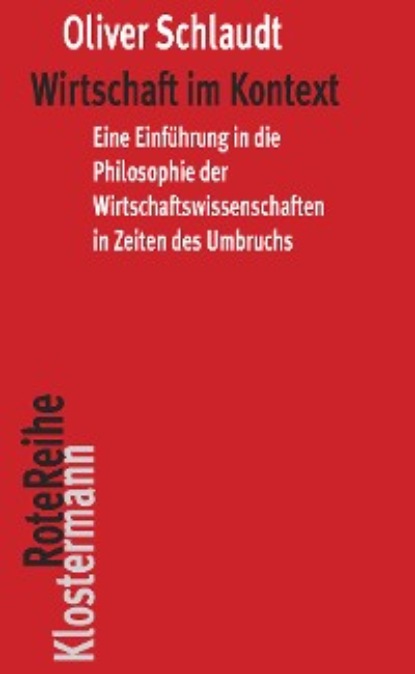- -
- 100%
- +
Erlauben wir uns schon an dieser Stelle einen kritischen Blick. Problematisch ist dieser Zug aus zwei Gründen. Erstens wird die Frage übergangen, ob die Verbesserung aller auch praktisch möglich ist. Man sieht sofort, warum es den Ökonomen legitim erscheinen muss, diese Frage auszuklammern: es handelt sich um eine soziologische Frage, denn Möglichkeit und Unmöglichkeit hängen von außerökonomischen Faktoren ab. Hier berühren wir eine Grenzfläche, welche die Ökonomen ausblenden. Darf man sie allerdings nicht ausblenden, wie die Kritiker der Neoklassik meinen, so wird die Frage nach der praktischen Realisierbarkeit wieder relevant.
Der zweite Grund hat mit der Trennung von Effizienz- und Distributionsaspekten zu tun. Wie können die Ökonomen einerseits die Distributionsfrage als eine Wertfrage kenntlich machen und als solche ausklammern, andererseits aber anhand des Effizienzkriteriums entscheiden wollen, ob eine politische Reform wünschenswert ist? Ist letzteres etwa keine Wertfrage? Eine Effizienzsteigerung im Sinne einer potentiellen Paretoverbesserung ist den Ökonomen ja nicht nur als Mittel zum Zweck, sondern an sich erstrebenswert. Die Ökonomen leugnen diese Wertdimension, indem sie ihr Kriterium der Effizienzsteigerung nicht auf einen externen Wertmaßstab gründen, sondern sich auf die ›Naturanlage‹ des Individuums berufen (d. h. eigentlich auf die Modellannahme), beständig nach mehr zu streben. Wünschenswert soll also heißen: wünschenswert für die Individuen. Die Ökonomen erlauben sich also, im Namen der Individuen zu sprechen und die Effizienzsteigerung als deren ureigentliches Interesse darzustellen. Nun beachte man aber: Die Ökonomen geben vor, über den faktischen Nutzen einer Reform im Namen der Individuen zu urteilen. Aber nun ist es ja gerade so, dass de facto nicht alle, vielleicht gar nur eine Minderheit eine Verbesserung erzielt, und die übrigen sich unter Umständen sogar verschlechtern. Die Ökonomen sprechen über eine faktische Reform, aber nicht im Namen der faktisch betroffenen Individuen, sondern der Individuen unter hypothetischen Umständen, an deren Herbeiführung sie in der Regel selbst nicht glauben. Hier klafft eine Lücke in der Argumentation, die nur durch die Annahme überbrückt werden kann, dass es einer Gesellschaft besser geht, wenn sie reicher ist, auch wenn der Reichtum ungleicher verteilt ist. Aber dies ist eine Annahme über das kollektive Wohl, welche zu begründen wäre, als unbegründete aber ein Werturteil der Ökonomen kaschiert.
Es ist der Mühe wert, diesen Punkt in technischen Begriffen herauszuarbeiten. Bereits 1941 zeigte der ungarische Ökonom Tibor de Scitovsky, dass das Kaldor-Hicks-Kriterium zu widersprüchlichen Resultaten führen kann, da es Situationen zulässt, in welchen der Übergang von einem Zustand X zu einem anderen Zustand Y ebenso wünschenswert ist wie der umgekehrte Übergang.36 Dieses Paradox kann man auch am Beispiel der Korngesetze aufzeigen, also am Streit um den Freihandel. Abbildung 2 zeigt die sogenannte Nutzenmöglichkeitsgrenze, welche den je höchstmöglichen Nutzen eines Akteurs als Funktion desjenigen der anderen Akteure zeigt. Es handelt sich also um alle Pareto-optimalen Kombinationen von Nutzenwerten. Wir betrachten ein System, in welchem sich ein Konsument und ein Produzent gegenüberstehen, und welches den Punkt X einnimmt. Ein Übergang vom Freihandel zur Protektion des fraglichen Produktionszweiges würde das System an den Punkt Y verschieben, dem eine veränderte Nutzenmöglichkeitsgrenze zugeordnet ist. Der Produzent würde sich verbessern, der Konsument verschlechtern. Gleichwohl wäre diese politische Reform nach dem Kaldor-Hicks-Kriterium wünschenswert, da auch nach Entschädigung des Konsumenten, d. h. Übergang auf der Nutzenmöglichkeitsgrenze von Y zu Y ′, der Produzent noch einen Gewinn davonträgt. Allerdings gilt auch das Umgekehrte: Steht das System an Punkt Y, stellt der Übergang zum Freihandel eine potentielle Paretoverbesserung dar, da nach Entschädigung des Produzenten (X zu X ′) der Konsument nach wie vor besser dasteht.

Abb. 2: Das Paradox von de Scitovsky: Sowohl der Übergang von X zu Y als auch seine Umkehrung stellen eine potentielle Paretoverbesserung dar.
Die Wurzel dieses Problems liegt darin, dass die Entschädigung nicht tatsächlich vorgenommen werden muss. Muss sie dies doch, ändert sich die Situation nämlich grundlegend. Denn nun gilt: Wenn eine Gesellschaft am Punkt X angesiedelt ist, ist ein Übergang zum Protektionismus inklusive Entschädigung des Konsumenten, d. h. zu Punkt X ′, eine Pareto-Verbesserung; umgekehrt, wenn sie durch den Punkt Y beschrieben wird, stellt ein Übergang zum Freihandel mit Entschädigung des Produzenten eine Pareto-Verbesserung dar. Das Paradox verschwindet. Zugleich sieht man aber deutlich am hervorgehobenen Wenn-Teil der ausgesprochenen Empfehlungen, dass man es nunmehr mit einer bedingten Empfehlung zu tun hat. Gegenstand der Bedingung ist aber die bestehende Einkommensverteilung. Dies bedeutet jedoch, dass sich Fragen der Effizienz und der Verteilung mitnichten voneinander trennen lassen. Die Diskussion in technischeren Begriffen zeigt mithin sehr präzise die Fragwürdigkeit der Objektivität wirtschaftspolitischer Empfehlungen, die auf dem angeblich wertfreien Effizienzkriterium gegründet sind.37 Auf dieser Grundlage können auch renommierte Ökonomen wie der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz ihrem Fach vorwerfen, sich von einer wissenschaftlichen Disziplin zu einem cheerleader des laissez-faire-Kapitalismus gewandelt zu haben.38
2.2.8 Spieltheorie
Der Rationalitätsbegriff der Neoklassik hat keine Tiefe. Er beschreibt lediglich die Präferenzstruktur des als Nutzenmaximierer aufgefassten Akteurs. Es ermangelt der Neoklassik einer Theorie, welche Wege zum Optimum es gibt und welchen davon das Individuum einschlägt. 1944 präsentierten die beiden amerikanischen Emigranten John von Neumann und Oskar Morgenstern in dem heute klassischen Buch Theory of Games and Economic Behavior einen Ansatz, diese Lücke zu füllen – und zwar in Form eines mathematischen Formalismus, wo die Neoklassik nur einige qualitative Hinweise bereithielt. Von Neumann und Morgenstern wollten insbesondere der Wechselwirkung der Akteure Rechnung tragen, wodurch ein schwieriges Problem gestellt ist:
[Der Teilnehmer einer sozialen Tauschökonomie] versucht ein optimales Ergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, muss er jedoch in Austauschbeziehungen zu anderen treten. Wenn zwei oder mehr Personen untereinander Güter tauschen, wird für jeden das Ergebnis im Allgemeinen nicht bloß von den eigenen Handlungen, sondern ebenfalls von denen der anderen abhängen. Jeder Teilnehmer sucht also eine Funktion zu maximieren, deren Variablen er nicht sämtliche kontrolliert. Dies ist offenkundig kein Maximierungsproblem mehr, sondern ein irritierendes Gemenge konfligierender Maximierungsprobleme. Jeder Teilnehmer wird durch ein anderes Prinzip angeleitet und keines bestimmt alle ihn tangierenden Variablen. – Für ein solches Problem hält die klassische Mathematik keine Theorie bereit.39
Diese Analyse teilt den reduktionistischen Individualismus der Gleichgewichtstheorie, dem die beiden Autoren ausdrücklich beipflichten. Sie ergänzen diese Theorie hingegen um einen wichtigen Aspekt, der in ihr nicht vorgesehen war: Der homo œconomicus ist stumm und teilnahmslos. Insbesondere unterscheidet er nicht zwischen Variablen, die die unveränderliche Umwelt beschreiben, und solchen, die vom Willen der anderen Akteure abhängen, von »Motiven, die ihrer Natur nach den seinigen identisch sind«. Diese Unterscheidung ändert sein Verhalten tiefgreifend, da er eine Erwartung über das Verhalten anderer ausbilden wird und weiß, dass dieses umgekehrt ihre Erwartungen über sein Verhalten widerspiegelt.40 Mit einem Wort: sein Verhalten wird strategisch.
Die mathematische Theorie, die hier beispringt, ist die Spieltheorie oder Theorie der Strategiespiele, welche von Neumann schon in den 1920er Jahren ausgearbeitet hatte.41 Das Marktgeschehen stellt dabei das ›Spiel‹ dar, nämlich einfach ein regelgeleitetes Geschehen. Wo die Akteure Wahlmöglichkeiten haben, machen sie ›Spielzüge‹. Die festen Muster und Prinzipien ihrer Züge bilden ihre ›Strategie‹. Wie auch schon für den Begriff des rationalen Verhaltens gilt für den Begriff der Strategie, dass seine Anwendung nicht auf bewusst geplante Handlungen eingeschränkt ist. Auch das Verhalten eines seinem Instinkt oder seinen Affekten folgenden Akteurs wird als Strategie beschrieben. Dies ist insbesondere für die Anwendung spieltheoretischer Methoden in der evolutionären Forschung von Bedeutung.
Das bekannteste Fallbeispiel einer spieltheoretischen Analyse stellt sicherlich das sogenannte Gefangenendilemma dar. Es ist zugleich aber auch ein problematischer Fall, der die Grenzen des individualistischen Ansatzes spürbar werden lässt, weshalb er von besonderem Interesse für uns ist. Das Gefangenendilemma wird uns insbesondere in der Frage des Umgangs mit öffentlichen Gütern wieder begegnen. Betrachten wir es hier schon näher.
Das Gefangenendilemma handelt von zwei Verbrechern A und B, die sich von der Polizei haben schnappen lassen und nun – getrennt voneinander – verhört werden. Ihr Verhalten – Gestehen oder Leugnen – wird Konsequenzen für die zu erwartende Länge der Haftstrafe haben. Allerdings hängt der Urteilsspruch von beider Verhalten ab, womit die von von Neumann und Morgenstern beschriebene Situation prototypisch realisiert ist: jeder einzelne hat es mit einem Maximierungsproblem zu tun, über dessen Variablen er nur partiell Kontrolle ausübt, partiell aber auch andere Akteure (Maximierung des Nutzens heißt hier natürlich Minimierung der Haftzeit). Das konkrete Szenario ist folgendes: Es drohen jedem sechs Jahre Haft. ›Kooperieren‹ sie und schweigen beide, werden sie aufgrund der dünnen Beweislage jeweils zu drei Jahren Haft verurteilt. ›Defektiert‹ einer von beiden und gesteht, kommt er mit einem Jahr davon, während der andere die vollen sechs Jahre absitzen muss. Gestehen beide, müssen sie infolge immerhin nur vier Jahre einsitzen.
Das Gefangenendilemma: A gesteht schweigt B gesteht je 4 Jahre 6 Jahre für A 1 Jahr für B schweigt 1 Jahr für A 6 Jahre für B je 3 JahreDie eigentliche Schwierigkeit entsteht dadurch, dass die beiden Verbrecher ihr Verhalten nicht abstimmen können. So empfiehlt sich jedem, zu gestehen, weil man nur so unabhängig vom Verhalten des anderen die Höchststrafe vermeidet. Gesteht der andere ebenfalls, hat man die 4 Jahre abzusitzen, schweigt der andere, sogar nur ein Jahr. Da sich für beide die Situation gleich darstellt, sollten sie auch beide diese Option wählen und defektieren. Man spricht von einem (starken) Nash-Gleichgewicht: in diesem Zustand kann sich jeder der Spieler durch einseitige Strategieänderungen nur verschlechtern.42 Freilich gelangen die Spieler mit dieser rationalen Strategie zu einem pareto-inferioren Resultat, denn im Falle der Kooperation hätten sie beide besser dagestanden! Dies ist der Kern des Dilemmas: die aus je individueller Perspektive rationale Strategie führt zu einem für alle dürftigen Ergebnis. Hier trifft man auf ein ernsthaftes Problem individualistischer Rationalität.
Entwickelt wurde die Spieltheorie übrigens als Analyseinstrument im Kalten Krieg. Erst vor diesem Hintergrund erhellt die Bedeutung der absoluten Nichtkommunikation zwischen den Gefangenen, die für die nuklearen Großmächte stehen. Das Nash-Gleichgewicht ist insbesondere also die theoretische Grundlage für das »Gleichgewicht des Schreckens«. Es ist interessant zu notieren, dass Nash in seiner Arbeit die Modellannahmen noch einmal gegenüber dem Ansatz von Neumanns und Morgensterns verschärfte. Während diese sich auch intensiv mit der Rolle von Koalitionsbildungen in Spielen mit mehr als zwei Spielern auseinandersetzen, schloss Nash diese ausdrücklich aus. Seine Spieler agieren vollkommen unabhängig, sie kennen weder Kommunikation noch Koalition. Dieses düstere Bild wurde tatsächlich erst in einem zweiten Schritt auf die Analyse der Wirtschafts- und schließlich auch anderer sozialer Prozesse übertragen, die mithin als eine Art verallgemeinerter Kalter Krieg verstanden wurden.
Vor diesem Hintergrund ist es besonders bemerkenswert, wie sich das Bild ändert, wenn das Spiel des Gefangenendilemmas über mehrere Runden gespielt wird, so dass die Spieler die Möglichkeit erhalten, auf das Verhalten des Mitspielers in der Vorrunde zu reagieren. Die optimale Strategie besteht darin, im ersten Zug Kooperationsbereitschaft zu signalisieren und sodann immer den Zug des anderen nachzuahmen, so dass seine Kooperation mit selbiger belohnt, die Defektion aber mit selbiger bestraft wird. Diese Strategie wird als TIT FOR TAT bezeichnet (etwa: »wie du mir, so ich dir«). Treffen zwei TIT FOR TAT Spieler aufeinander, erreichen sie tatsächlich das Paretooptimum. Aber selbst wenn der Mitspieler einer anderen Strategie folgt, bleibt der TIT FOR TAT Spieler nahe am optimalen Ergebnis. Er ist kein ›naiver‹ Kooperationspartner, dessen Strategie sich ausnutzen ließe.43 Es lässt sich zeigen, dass diese Strategie es zumindest im Ansatz erlaubt, die Entstehung kooperativen Verhaltens in einer rein egoistischen Umwelt zu verstehen. Dringt nur ein kleiner cluster von TIT FOR TAT Strategen in einer Population konsequenter Defektierer ein, kann er sich dort halten und entwickeln.44 Die Frage nach der evolutionären Entstehung von Kooperation und Institutionen ist heute ein zentrales Problem alternativer Ansätze in den Wirtschaftswissenschaften. Wir werden darauf zurückkommen.
2.3 Autonomie – Reversibilität – Unendlichkeit
Wir haben nun die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften in ihren elementarsten Zügen kennengelernt. Es sticht in die Augen, dass sie das Marktgeschehen nach dem Vorbild eines physikalischen Geschehens konzeptualisieren. Diese Analogie wurde auch nicht erst im Rückblick von den Historikern der Ökonomie entdeckt. Vielmehr beriefen sich die Autoren der Grenznutzenschule in der Mitte des 19. Jahrhunderts ausdrücklich auf die Physik ihrer Zeit, welche mit dem Energiebegriff gerade einen ihrer ergiebigsten Begriffe aus der Taufe gehoben hatte. Aus dieser Physik konnte sie insbesondere das Extremalprinzip übernehmen, wie es dem Pareto-Prinzip zugrundeliegt: sich selbst überlassene Systeme tendieren dazu, einen Zustand einzunehmen, in welchem eine charakteristische Größe einen Extremwert annimmt. Das Marginalprinzip schlägt die Brücke zur Mathematik, da es die Anwendung analytischer Methoden erlaubt. Damit können wir das Programm der Neoklassik endlich vollständig durch folgende drei Elemente beschreiben:
1 Methodologischer Individualismus;
2 Utilitarismus;
3 Paradigma der energetischen, mathematischen Physik.
Aus diesen drei Säulen ergeben sich auch die Züge, die die moderne Volkswirtschaftslehre charakterisieren und zunehmend infrage gestellt werden: mathematischer Formalismus, der Anspruch der Wissenschaftlichkeit gegen alle alternativen Ansätze, der zentrale Begriff des Nutzens, das Programm der Mikrofundierung, die Annahme exogener Variablen, insbesondere exogener Präferenzordnungen.45
Wichtiger für unsere Fragestellung ist aber, welche Eigenschaften des Untersuchungsgegenstands, des Wirtschaftsprozesses, durch dieses Programm vorgegeben waren. Was nämlich durchaus erst im Rückblick sichtbar wurde, waren die Schranken, die dem Programm, welches anfangs allein als Verheißung und Erfolgsgarantie erscheinen konnte, sehr wohl eingeschrieben waren. Der ›mechanistisch‹ aufgefasste Wirtschaftsprozess, wie ihn die Neoklassik vorstellt, ist gekennzeichnet durch folgende drei Eigenschaften:
1 Autonomie: keine Abhängigkeiten;
2 Reversibilität: keine Geschichte;
3 Unendlichkeit: keine Grenzen.
Mit diesen Schlagworten ist genauer folgendes gemeint:
2.3.1 Autonomie
Unter Autonomie sind zwei Besonderheiten zu verstehen. Erstens ist der Wirtschaftsprozess ein autonomer Subprozess des gesellschaftlichen Gesamtgeschehens, d. h. er kann allein durch das ökonomische Eigenschaftsspektrum des homo œconomicus erklärt werden und es gibt keine Abhängigkeiten zu anderen sozialen Teilprozessen wie Kultur, Religion, Politik. Zweitens kann und wird es in der wirklichen Welt zwar zahlreiche Interferenzen mit anderen gesellschaftlichen Subprozessen geben, aber diese sind Störungen in dem anspruchsvollen Sinne, dass sie die Markteffizienz verringern, also zu einem Zustand führen, der nicht Pareto-optimal ist. Diese Autonomie des wirtschaftlichen Prozesses ist insbesondere auch bestimmend für das Selbstverständnis der Wirtschaftswissenschaften im Verhältnis zu den anderen Sozialwissenschaften. Wir können sagen, dass sie eine Sozialwissenschaft wider Willen sind.
2.3.2 Reversibilität
Diese Eigenschaft ist aus der Mechanik bekannt: mechanische Systeme verhalten sich – abstrakt ausgedrückt – symmetrisch unter Zeitumkehr. Konkret gesprochen heißt dies, dass der zeitlich umgekehrte Ablauf eines gegebenen rein-mechanischen Vorgangs den Gesetzen der Mechanik ebenfalls entspricht. Lässt man die Filmaufzeichnung eines Stoßes zweier Billiardkugeln oder eines schwingenden Pendels rückwärts ablaufen, so zeigt sie ein nach den Gesetzen der Mechanik zulässiges Geschehen. (Man beachte, dass Reibungsverluste, die die Zeitsymmetrie in der Tat verletzen, indem z. B. die Pendelschwingung allmählich zum Erliegen kommt, keine rein-mechanischen Vorgänge sind, da dabei mechanische Energie in Wärme umgesetzt wird.) Und Gleiches gilt in der Tat auch für den Wirtschaftsprozess, wie ihn die Mikroökonomie auffasst. Jeder Tausch beispielsweise ist auch in umgekehrter Richtung denkbar. (Dass dies den Präferenzen der Akteure zuwiderläuft ist kein Einwand, da die Präferenzen ja allein aus dem ökonomischen Verhalten bekannt sind, sprich aufgrund des rückwärts laufenden Films würde man auf andere Präferenzen schließen.)
Diese Eigenschaft ist, was wir noch eingehender zu diskutieren haben werden, mit der grundsätzlichen Erfahrung der Gerichtetheit der Zeit unverträglich. Aber auch grundlegende ökonomische Phänomene wie der Zusammenhang von Verschuldung und Profit sind mit der Zeitsymmetrie nicht vereinbar. Schulden werden mit Blick auf zukünftige Gewinne gewährt sowohl als auch aufgenommen.46 Für den Augenblick behalten wir vor allem die methodologische Konsequenz der Reversibilität zurück, dass alle Geschichte aus dem rein-ökonomischen Prozess ausgeschlossen und somit auch jeder historische Ansatz in der Wirtschaftswissenschaft disqualifiziert ist. Die Welt des Gleichgewichts kennt keine Geschichte, da jede Störung des Gleichgewichts Kräfte mobilisiert, die das System wieder ins Gleichgewicht rücken, so wie eine angestoßene Kugel immer wieder zum tiefsten Punkt einer Schale zurückfinden wird. Eine relevante Geschichte – um dieses Fenster schon zu öffnen – könnte beispielsweise über das Konzept der Pfadabhängigkeit gedacht werden, wonach vorgängige Entscheidungen auch dann noch unsere aktuellen Handlungsspielräume beeinflussen, wenn sie unter Umständen getroffen werden, die heute nicht mehr relevant sind.47
2.3.3 Unendlichkeit
Ein rein mechanischer Prozess, in welchem der Energieinhalt zwischen den Formen potentieller und kinetischer Energie frei hin- und her flutet, kennt keine innere Grenze, an welcher er zum Erliegen kommen könnte, und gleiches gilt für den ökonomischen Prozess in der neoklassischen Vorstellung. Im Grunde ist dies eine direkte Folge der Autonomie und der Reversibilität. Aber es lohnt sich gleichwohl, die Unendlichkeit gesondert hervorzuheben, weil sie im Hintergrund von enormer Wirkmacht im ökonomischen Ideenkosmos ist: Die Wirtschaft ist ein sich selbst erhaltender Prozess im geschichtslosen Gleichgewicht, der sich immerdar erhalten wird. Die Bedeutung dieser Idee kann man daran ablesen, dass sie selbst dann, wenn mit dem Wachstum eine zeitlich gerichtete Größe eine zentrale Stellung einnimmt, in ihrer Macht ungebrochen ist, obgleich doch selbst die geringste konstante Wachstumsrate zu einem exponentiellen Wachstum führt, wie die Wachstumskritiker beständig unterstreichen. Die Natur wird als eine beständig fließende Quelle betrachtet, die den Wirtschaftsprozess alimentieren kann, ohne selbst eine Änderung zu erleiden. Und wo die Endlichkeit der Ressourcen sich doch drängend geltend macht, setzen die Ökonomen auf technischen Fortschritt, Erhöhung der Energieeffizienz, und Ersetzbarkeit (Substituierbarkeit) der knappen Ressource durch andere Stoffe.
2.3.4 Das ›System‹ Wirtschaft
Wenn wir hier somit behaupten, die Neoklassik verstehe den Wirtschaftsprozess als einen autonomen, reversiblen und unbegrenzten Vorgang, so soll damit freilich nicht gesagt sein, dass die Ökonomen dies nicht besser wissen. Der springende Punkt aber ist, dass, selbst wenn sie als Personen durchaus die Abhängigkeit der Wirtschaft von der Biosphäre anerkennen, sie als Ökonomen keine Sprache haben, um dies auszudrücken. Das System Wirtschaft erscheint als autonom, reversibel und unbegrenzt, aber unter »System« ist kein Gebilde von kausaler, räumlicher oder funktionaler Einheit zu verstehen. »System« bezeichnet hier vielmehr die Gesamtheit dessen, was sich durch eine bestimmte Sprache beschreiben lässt. Neoklassische Ökonomie spricht nur über Werte und Preise. Wir können mit Luhmann sagen, dass durch das Medium des Geldes und den entsprechenden binären Code »to pay or not to pay« das geschlossene, zirkuläre und selbstbezügliche Universum der Ökonomie konstituiert wird.48 Wenn wir also sagen, die Wirtschaftswissenschaftler stellen sich die Wirtschaft als autonomen, reversiblen und unbegrenzten Prozess vor, so beschreiben wir damit kein psychologisches Phänomen, sondern ein epistemologisches. Wir benennen das Bild, welches ihren Begriffen eingeschrieben ist. Wir benennen nicht, was sie glauben, sondern was sie sagen können.
2.4 Eine Sozialwissenschaft wider Willen
2.4.1 Die ›Astronomie der Warenbewegungen‹
Es zeichnet sich damit schon eine Diagnose ab, die sich noch weiter erhärten wird und die wir in der Feststellung zusammenfassen können, dass die Wirtschaftswissenschaften den merkwürdigen Status einer Sozialwissenschaft wider Willen innehaben. Sie sind einerseits fraglos eine Sozialwissenschaft, da ihr Gegenstand ein gesellschaftlicher ist, sogar der wesentlichste im materiellen Lebensprozess der Gesellschaften. Zugleich aber konzeptualisieren sie den Wirtschaftsprozess als ein mechanisches System, eine Art »Astronomie der Warenbewegungen«49, in welcher soziale Phänomene keinen Platz mehr haben. Dies geht so weit, dass im Grunde in der Gleichgewichtstheorie der Neoklassik eigentlich auch der Markt und das Privateigentum keine Rolle spielen. Sie kennt in ihrer Reinform (ohne die implementierte Spieltheorie) weder Wettbewerb noch strategisches Verhalten, da die Akteure sich niemals treffen und sich auch nicht füreinander interessieren, sondern stumm den Trajektorien ihrer Nutzenmaximierung im Schwerefeld der Güterverteilung folgen. Dies führte zu der verblüffenden Situation, dass diese Theorie, die, wie wir sahen, auch an den Freihandel geknüpft war und diesem eine wissenschaftliche Rechtfertigung beibringen sollte, in den 1930er Jahren problemlos als eine Theorie der Allokation in einer Planwirtschaft gelesen werden konnte.50