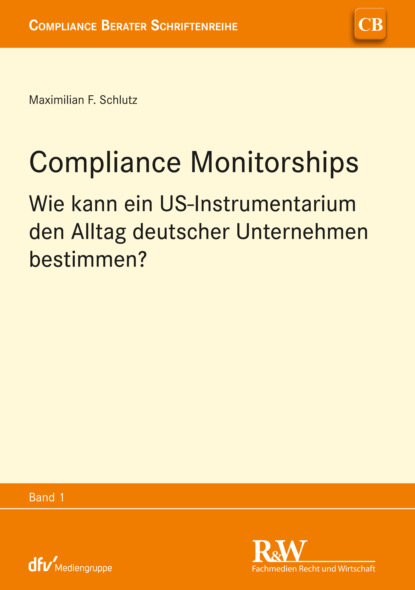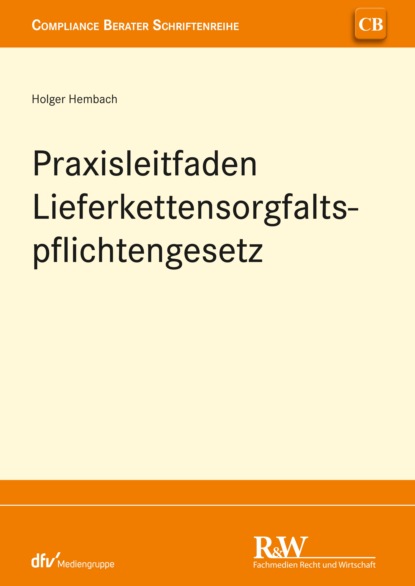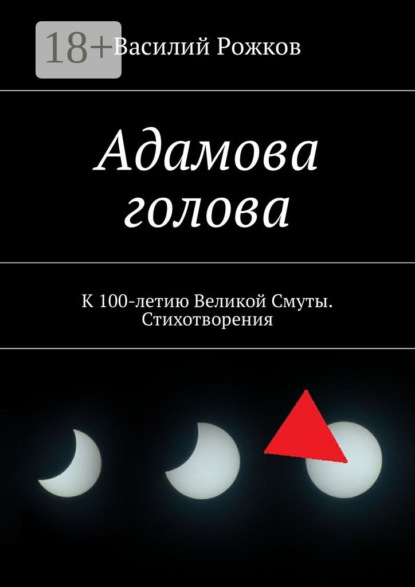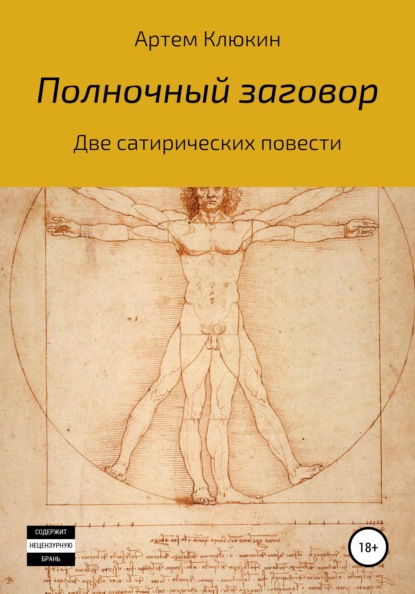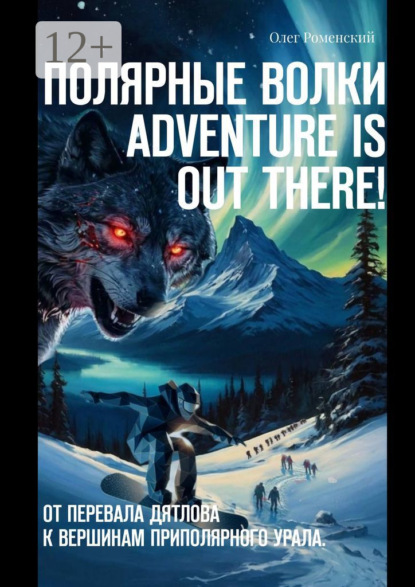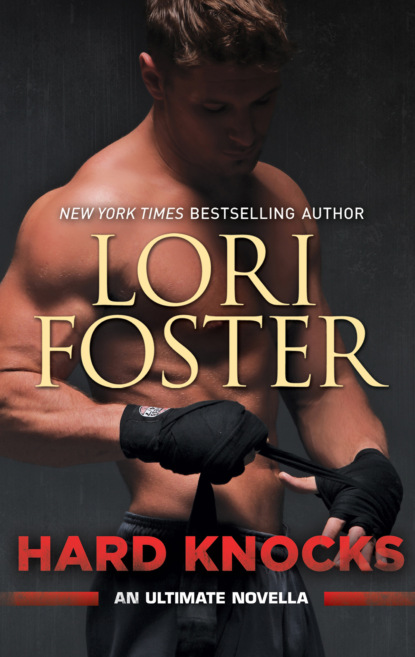- -
- 100%
- +

Maximilian F. Schlutz
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Zugleich Dissertation Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-8005-1790-9
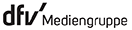
© 2021 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: WIRmachenDRUCK GmbH, Backnang
Printed in Germany
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Herbst 2020 von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Goethe-Universität Frankfurt am Main als Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur konnten im Wesentlichen bis August 2020 berücksichtigt werden.
Auf meinem juristischen Werdegang und während der Erstellung dieses Werks haben mich viele Menschen unterstützt, denen ich an dieser Stelle danken möchte.
HerzlichdankenmöchteichzunächstmeinemDoktorvater, Herrn Prof. Dr. Matthias Jahn, für die exzellente Betreuung. Herrn Prof. Dr. Dres. h.c. Theodor Baums danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens.
Danken möchte ich Frau Rechtsanwältin Andrea Klamser, die meine juristische Ausbildung nachhaltig geprägt hat, sowie den Herren Dr. Theo Waigel und Dr. Andreas Pohlmann, dass sie mir im Rahmen von Experteninterviews Rede und Antwort gestanden haben.
Ich danke meinem Vater, Herrn Rechtsanwalt Joachim H. Schlutz, für die Inspiration, mich mit der Thematik Compliance Monitorship auseinanderzusetzen sowie für den gelegentlichen Meinungsaustausch.
Mein größter Dank gebührt meiner gesamten Familie, insbesondere meiner Mutter Petra von Hebel, die stets die Interessen ihrer Kinder vor ihre eigenen gestellt hat.
Diese Arbeit ist meinem Großvater Gerhard Dilcher gewidmet, der die Fertigstellung leider nicht mehr erleben konnte. Die Liebe und Dankbarkeit, die ich für ihn stets empfunden habe, kann ich nicht in Worte fassen. Er wird in meinen Erinnerungen immer weiterleben.
Frankfurt am Main, im Januar 2021Maximilian F. SchlutzI. Untersuchungsgegenstand
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit Unternehmensbeobachtern bzw. -aufpassern, sogenannten „Compliance-Monitoren“, die für einen bestimmten Zeitraum Compliance-Systeme prüfen, bewerten und dabei helfen sollen, beanstandete Rechtsverstöße in Zukunft möglichst zu vermeiden.
1. Kernproblem
Die Strafvollstreckungspraxis der US-Behörden hat dazu geführt, dass die Thematik „Compliance Monitorship“ zunehmend auch für europäische Unternehmen Relevanz entfaltet.1 Als Folge strafverfahrensbeendender Vergleiche mit US-Behörden waren bzw. sind in mehreren deutschen Unternehmen Compliance-Monitoren tätig.2 Ein Compliance-Monitor ist eine Art „Unternehmensaufpasser“, der überprüft, sicherstellt und zertifiziert, dass die Compliance-Strukturen des Unternehmens den Anforderungen des US-Rechts entsprechen.3 Ausgangspunkt der abgeschlossenen Vergleiche sind regelmäßig Ermittlungen durch das US-amerikanische Department of Justice (DOJ) wegen möglicher Verstöße unter anderem gegen den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Der FCPA ist ein US-Gesetz, das internationale Korruption ahndet und sich durch einen sehr weiten4 Anwendungsbereich auszeichnet.5
In den USA sahen zwischen 1993 und 2009 etwa 30 % und im Jahr 2016 mehr als 50 % der abgeschlossenen Vergleichsvereinbarungen den Einsatz eines Monitors vor.6 Im Jahr 2018 war die Zahl der Unternehmen, die in den USA infolge von FCPA-Verfahren einen Monitor einsetzen mussten, gegenüber den Vorjahren rückläufig.7 Allerdings kann daraus noch nicht gefolgert werden, dass das der Ausgangspunkt einer langfristigen Entwicklung sein wird, wobei das vom DOJ im Oktober 2018 veröffentlichte und im Laufe der Untersuchung noch zu besprechende Benczkowski-Memorandum allerdings eine Tendenz in diese Richtung aufzeigt.8
2. Monitorships innerhalb deutscher Unternehmen
Die Berichterstattung im Fall der Korruptionsaffäre um den Münchner Elektrokonzern Siemens hat gezeigt, dass ausländische Antikorruptionsbehörden grenzüberschreitend gegen deutsche Unternehmen ermitteln und diese im Anschluss rechtlich zur Verantwortung ziehen. Im Jahr 2008 sprach in Washington D. C. ein US-Bundesgericht Siemens wegen vorsätzlich umgangener und fehlender interner Kontrollen und Nichteinhaltung der Rechnungslegungsvorschriften des FCPA für schuldig.9 Nach geständiger Einlassung der Siemens-Verantwortlichen erreichte das Unternehmen eine Beendigung des Verfahrens gegen Zahlung von 800 Millionen Dollar.10 Gleichzeitig erklärte sich Siemens in der Schuldvereinbarung („Plea Agreement“) damit einverstanden, dass Theo Waigel für einen Zeitraum von vier Jahren ab Unterzeichnung der Vereinbarung als unabhängiger Monitor für Siemens tätig wird.11 Mit dem ehemaligen Bundesminister der Finanzen war erstmalig in der US-amerikanischen Rechtspraxis ein Nicht-Amerikaner als Compliance-Monitor tätig.12
Die Siemens-Korruptionsaffäre und der anschließende Einsatz des Monitors stellen keinen Einzelfall dar. Auch Daimler und Bilfinger mussten bereits einen unabhängigen Monitor beauftragen, der innerhalb beider Unternehmen im Anschluss an die strafverfahrensbeendenden Vergleiche mehrere Jahre eingesetzt wurde. Im Fall von Daimler stellte das Unternehmen im Jahr 2006 zur Aufklärung von Schmiergeldzahlungen Louis Freeh, der in den 90er Jahren die US-Bundespolizei FBI geleitet hatte, als Berater ein. Am 22.03.2010 vereinbarte Daimler mit dem DOJ den Abschluss eines „Deferred Prosecution Agreements“ (DPA). Eine Bedingung dieses Vergleichs war, dass Daimler fortan einen Compliance-Monitor im Unternehmen einsetzt.13 Im Anschluss an den Vergleich von Daimler mit den US-Behörden zog das Unternehmen fortan Freeh als unabhängigen Kontrolleur heran.14 Auch beim Mannheimer Industriedienstleister Bilfinger wurde Freeh im Herbst 2015 als Monitor eingesetzt, nachdem bereits 2013 das US-Justizministerium den Schweizer Juristen Mark Livschitz als Monitor installiert hatte.15 Grund für die Doppelbesetzung der Beraterposition war der Abgang des Vorstandsvorsitzenden Roland Koch, woraufhin es zu Unruhe an der Spitze des Konzerns kam. Da Bilfinger-Manager bei einem Ölpipeline-Projekt in Nigeria Regierungsbeamte mit rund 6 Millionen US-Dollar bestochen haben sollen, zahlte das Unternehmen eine Geldstrafe in Höhe von 32 Millionen Dollar und erklärte sich im Dezember 2013 in einem DPA mit dem Einsatz eines unabhängigen Monitors einverstanden.16 Das Monitorship bei Bilfinger endete im Dezember 2018, nachdem das Unternehmen ein effektives Compliance-System zur Abwehr von Korruptionsverstößen implementiert hatte.17
In jüngster Vergangenheit wird im Rahmen des Volkswagen-„Abgasskandals“ aufgrund mehrerer Vergleiche, zum einen zwischen Volkswagen und dem DOJ18 sowie zum anderen zwischen Volkswagen und der Environmental Protection Agency (EPA)19, Larry D. Thompson als Monitor und Auditor bei Volkswagen eingesetzt. Ausweislich einer Meldung vom Oktober 2019 wird Thompson auf Wunsch von Volkswagen drei Monate länger, d.h. bis September 2020, im Unternehmen bleiben.20 Hintergrund ist nach Mitteilung des Konzerns, dass Volkswagen bestimmte Maßnahmen zum Einhalten der Grundsätze guter Unternehmensführung noch gründlicher testen und ein optimales Ergebnis erzielen will. Im Juli 2020 veröffentlichte Volkswagen den Abschlussbericht von Larry D. Thompson als Auditor mit der Feststellung, dass die Auditierung von Volkswagen im Rahmen des Third Partial Consent Decrees erfolgreich abgeschlossen sei.21
Unlängst haben sich die IAV GmbH und die Fresenius Medical Care mit dem DOJ auf die Bestellung eines Compliance-Monitors für einen Zeitraum von jeweils zwei Jahren geeinigt.22
Bei systembezogenen Vorwürfen innerhalb der Finanzbranche sind Monitorships ebenfalls möglich. Dementsprechend blieben auch deutsche Unternehmen im Finanzsektor von einem Compliance Monitorship bislang nicht verschont.23 Bei der Frankfurter Commerzbank war ein Verstoß gegen Iransanktionen der Auslöser für Ermittlungen der US-Behörden. Die Bank zahlte daraufhin im Jahr 2015 im Rahmen eines Vergleichs eine Strafe in Höhe von 1,45 Milliarden Dollar und musste zudem ab 2016 einen externen Compliance-Monitor auf eigene Kosten installieren.24 Die Deutsche Bank war bzw. ist sogar mehreren Compliance Monitorships ausgesetzt. Aufgrund der fehlenden Kontrolle von Swap-Derivaten musste das Kreditinstitut basierend auf einer Einigung mit der US-Börsenaufsicht CFTC im Oktober 2016 einen Monitor einsetzen.25 Ein weiteres Monitoring resultierte aus einem Geldwäsche-Skandal, bei dem Deutsche-Bank-Kunden laut dem New York State Department of Financial Services (NYSDFS) ca. 10 Milliarden Dollar Schwarzgeld aus Russland an den Finanzplätzen New York, London und Moskau gewaschen haben sollen. Das Kreditinstitut habe die Möglichkeiten ungenutzt gelassen, die Geldwäschetätigkeiten zu unterbinden.26
3. Grenzüberschreitende Ermittlungen der US-Behörden
Der Einsatz eines Compliance-Monitors in deutschen Unternehmen hat die Frage nach dem Einfluss der US-Strafverfolgungsbehörden sowie die Frage nach deren Vorgehensweise bei der Aufklärung von Korruptionsfällen aufgeworfen.27 Bereits seit längerem stößt die extensive grenzüberschreitende Anwendung von US-Vorschriften weltweit auf Kritik. Im Zuge dessen wird insbesondere bemängelt, dass europäische Unternehmen die volle Härte des Sanktionsregimes treffe, wohingegen amerikanische Unternehmen bevorzugt würden.28 An dem Mandat eines US-Monitors in deutschen Unternehmen ist insbesondere bemerkenswert, dass sich die Regelungen des US-Strafrechts von denen des deutschen Wirtschaftsstrafrechts deutlich unterscheiden. Ein im Rahmen der Untersuchung anzustellender Rechtsvergleich erfordert daher auch Überlegungen zu den Prozesssystemen in Deutschland und den USA.29
4. Meinungsspektrum
Zu erörtern ist im Rahmen der Einführung, inwieweit Compliance und speziell das Monitorship innerhalb von Gesetzesentwürfen, Rechtsprechung und der juristischen Literatur derzeit abgebildet werden.
a) Gesetzesentwürfe
Obwohl viele deutsche Unternehmen bereits einen Monitor einsetzen mussten bzw. müssen, ist diese Sanktionsmöglichkeit im deutschen Rechtssystem bisher nicht normativ verortet. An Vorschlägen und Fürsprechern für die Einführung dieses Konstrukts mangelt es jedoch nicht.
Bereits 1996 legte der „Thyssen-Arbeitskreis Strafrecht – Deutsche Wiedervereinigung“ unter Mitwirkung von Schünemann den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität vor. Dieser sah in § 30a E-OWiG vor, dass das Unternehmen unter Kuratel gestellt werden kann, sofern ein – dem Leitungsbereich des Unternehmens angehörender – Mitarbeiter für das Unternehmen eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit begeht und die Gefahr weiterer Zuwiderhandlungen gegeben ist. Nach § 30b Abs. 1 E-OWiG hat der Kurator zu beaufsichtigen, „ob in dem unter Kuratel gestellten Unternehmen die für die Anordnung maßgeblichen Gründe dauerhaft beseitigt werden.“30 Der Zweck der Sanktion bestand gemäß § 3 Abs. 1 E-OWiG in der „Aufsicht über die Resozialisierung.“
Der Kölner Entwurf eines Verbandssanktionsgesetzes aus 2017 sah in § 5 Abs. 4 vor, dass das Gericht für die Dauer oder einen Teil der Bewährungszeit einen sachkundigen und unabhängigen Monitor bestellen soll, der die Erfüllung der Auflagen überwacht.31
Gemäß § 12 Abs. 4 des Münchener Entwurfs eines Verbandssanktionengesetzes vom 05.09.2019 kann das Gericht für die Dauer oder einen Teil der Bewährungszeit einen Monitor bestellen, der die Erfüllung der Auflagen durch den Verband überwacht.32
Der Regierungsentwurf zum Verbandssanktionengesetz (VerSanG-E) des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) sieht in § 13 Abs. 2 folgende Reglung vor: „Das Gericht kann den Verband namentlich anweisen, bestimmte Vorkehrungen zur Vermeidung von Verbandstaten zu treffen und diese Vorkehrungen durch Bescheinigung einer sachkundigen Stelle nachzuweisen. Die Auswahl der sachkundigen Stelle, die der Verband getroffen hat, bedarf der Zustimmung durch das Gericht.“33
b) Compliance-Rechtsprechung
Trotz umfangreicher Fachliteratur zu den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Compliance-Organisation sind Urteile zum Thema Compliance eher selten34 bzw. im Hinblick auf den Compliance-Monitor nicht vorhanden. Spätestens seit der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. Mai 2017 – 1 StR 265/1635 müssen sich Unternehmen verstärkt mit der Effektivität ihres Compliance-Programms auseinandersetzen. Im zugrunde liegenden Verfahren zahlte ein deutsches Rüstungsunternehmen – unter Zuhilfenahme einer Beratungsgesellschaft – Bestechungsgelder an den damaligen griechischen Verteidigungsminister, um einen millionenschweren Auftrag für ein Rüstungsgeschäft zu erhalten.36
Ausweislich des Judikats ist es für die Bemessung der Geldbuße nach § 30 Abs. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) von Bedeutung, inwieweit das Unternehmen seiner Pflicht, Rechtsverletzungen aus seiner Sphäre zu unterbinden, nachkommt und ein effizientes Compliance Management installiert hat, das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen ausgelegt sein muss.37 Nach Auffassung des Gerichts kann zudem von Bedeutung sein, ob das Unternehmen im Laufe des Ordnungswidrigkeitenverfahrens Regelungen optimiert und betriebsinterne Prozesse so gestaltet hat, dass Normverletzungen künftig deutlich erschwert werden.38
Die vom BGH vorgenommene Berücksichtigung von Compliance-Maßnahmen im Rahmen der Bemessung der Unternehmensgeldbuße kann Unternehmen zu effektiver Compliance-Organisation und zur Aufdeckung von Normverletzungen motivieren.39 Hierbei können Unternehmen von ihren Erfahrungen während Compliance Monitorships profitieren und diese Erkenntnisse als Hilfestellung nutzen. Die Arbeit des Monitors kann dem Unternehmen bei der Bewertung seines Compliance-Systems helfen.40 Der eingesetzte Monitor kann zusammen mit einem kompetenten Team eine genaue, unabhängige sowie objektive Einschätzung hinsichtlich der Compliance-Bemühungen im Unternehmen treffen oder in Form von Bewertungen und Vorschlägen Handlungsempfehlungen zur Fokussierung, Anpassung und Weiterentwicklung des Compliance-Systems aussprechen.41
c) Stand der rechtswissenschaftlichen Diskussion
(1) Allgemeines zur Unternehmenssanktionierung
Die Frage der Sanktionsmöglichkeit juristischer Person ist, wie bereits vor geraumer Zeit von Roxin42 antizipiert, niemals aus der Diskussion im strafrechtlichen Schrifttum verschwunden.43 In diesem Zusammenhang sprechen sich viele Rechtswissenschaftler für eine kriminalpolitisch notwendige Reform des Sanktionsregimes gegenüber Unternehmen aus.44 Bestandteil dieser Forderung nach Unternehmenssanktionierung ist, dass neben finanziellen Strafen andere Sanktionsmöglichkeiten kreiert werden sollten, wobei hier oftmals der Compliance-Monitor nach US-Vorbild genannt wird, da dieser ein Umdenken in der kriminogenen Betriebsattitüde erzeugen könne.45 Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass der Trend aus den USA, Unternehmen für strafrechtliche Risiken und Verstöße immer stärker zur Verantwortung zu ziehen, auch in Europa bei allen drei Gewalten angekommen ist und sich in einer dynamischen Entwicklung befindet.
(2) Einordnung von Compliance Monitorships
Fraglich ist, wie sich Compliance Monitorships in den wissenschaftlichen Diskussionsstand einordnen lassen. Die Grundidee, dass ein externer Dritter als Verwalter oder „Aufpasser“ in einem Unternehmen tätig wird, ist nicht neu. Eine treuhänderische Verwaltung von Körperschaften als Unternehmenssanktion war bereits im Jahr 1953 auf dem 40. Deutschen Juristentag in Hamburg Gegenstand von Diskussionen.46 Diesen Gedanken der Einrichtung einer Unternehmenskuratel, die durch gerichtliche Entscheidung für einen bestimmten Zeitraum die Aufsicht über ein Unternehmen übernimmt, hat insbesondere Schünemann wiederaufleben lassen.47 Dieser spricht sich seit längerem für das Konzept der Unternehmenskuratel aus, das seiner Meinung nach nicht mit einer Verwaltung des Unternehmens durch den Staat verwechselt werden dürfe, da der Kurator keine Entscheidungskompetenzen, sondern lediglich Informationsrechte habe, durch deren Ausübung gestörte Informationsflüsse als Ursache der Unternehmenskriminalität im Unternehmen optimiert würden.48 Im Gegensatz zur Geldbuße sei der Vorteil der Einsetzung der Unternehmenskuratel, dass die Sanktion das Unternehmen im organisatorischen Bereich treffe, wo der für die Deliktsentstehung ausschlaggebende Mangel gefunden worden sei.49 Für Schünemann ist die Legitimation der Unternehmenskuratel als eine – in die Zukunft gerichtete – Maßregel problemlos möglich, da die Kuratel weder Aktionären noch Arbeitnehmern schade.50
Dannecker schlägt zur Bestrafung von Verbänden als spezialpräventive Aufsichtsmaßnahme ebenfalls die Anordnung einer temporären Unternehmenskuratel vor.51 Die Kuratel müsse seiner Ansicht nach von einem staatlich bestellten Treuhänder oder Gremium ausgeübt werden und die eingesetzten Personen müssten über Kenntnisse bzw. Erfahrungen wie z.B. Insolvenzverwalter verfügen.52 Allerdings dürfe die Kuratel nur angeordnet werden, wenn die Erteilung einzelner Weisungen zur Verhinderung weiterer Straftaten nicht ausreiche.53 Der Vorteil der Sanktionsform bestünde darin, dass sie den Unternehmensbestand sichere, die Anteilseigner schone und die Unternehmensleitung empfindlich treffe.54
Für den Bereich des Umweltstrafrechts plädiert Christina Schwinge – als Sanktion gegenüber Unternehmen – für eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte, staatlich überwachte organisatorische Intervention, die auf ein sich selbst regulierendes und kontrollierendes Unternehmen hinwirken soll.55 Durch die Überwachung mit Hilfe einer Unternehmenskuratel könne für bestimmte Zeit in der erforderlichen Weise auf strukturelle und institutionelle Probleme im Unternehmen, die zu Umweltstraftaten geführt haben, eingegangen werden.56 Des Weiteren würde trotz Unternehmenskuratel die Unternehmensleitung in ihrer bisherigen Form bestehen bleiben und infolge der Überwachung zu einer ordnungsgemäßen umweltorientierten Unternehmenspolitik angehalten werden. Dieser Ansatz habe im Vergleich zur vorübergehenden „Absetzung“ des Managements den Vorteil, dass ihm ein gewisser „Erziehungseffekt“ innewohne und die Unternehmensleitung nach Ende der Kuratel-Einsetzung wohl gewillt sein werde, umweltschonend zu arbeiten.57 Von der Unternehmenskuratel würde auch eine erhebliche Präventionswirkung ausgehen, da die Führungsautorität des Managements sowie das Prestige des Unternehmens insgesamt angegriffen werde und für den Zeitraum der Einsetzung zumindest indirekt eine dauerhafte Konfrontation mit der begangenen Umweltstraftat bestünde.58
Napp unterteilt externe Eingriffe in Unternehmen – abhängig von ihrer Intensität – in verschiedene Modelle: 1. Modell einer reinen Rechtsaufsicht, 2. Zustimmungs-/Genehmigungserfordernis des Kurators, 3. Einsetzung eines Managements bzw. unmittelbare Entscheidungsbefugnis des Kurators, 4. Ersetzung des Managements.59 Unter dem ersten Modell subsumiert Napp den obigen Entwurf des Thyssen-Arbeitskreises unter Mitwirkung von Schünemann (§ 30a Abs. 1 E-OWiG)60 und die vorstehende Position von Schwinge61. Die zweite Kategorie enthält den Vergleich des Kurators mit einem Vormund, der sämtliche Beschlüsse einsehen darf und diesen, um Gültigkeit zu erlangen, seine Zustimmung und Unterschrift erteilen muss. Mangels selbstständiger Handlungsbefugnisse für den Verband nach außen beschränken sich die Mitwirkungsbefugnisse des Kurators daher auf die Überprüfung sowie Genehmigung von Beschlüssen, sodass die Geschäftsführung prinzipiell die volle Handlungs- und Entscheidungsfreiheit behält.62 Die dritte – auf Empfehlungen des Europarats basierende – Kategorie sieht die gerichtliche Einsetzung eines vorübergehend geschäftsführenden Managements vor, wobei diese Position auch von einem Kurator mit eigener sowie unmittelbarer Entscheidungsbefugnis besetzt werden könnte.63 Nach Darstellung des vierten Modells, der „Ersetzung des Managements“, die beispielsweise durch Austausch der Führungsebene möglich ist, greift Napp noch die von Schünemann und Schwinge angedachte Möglichkeit einer vorläufigen Kuratel entsprechend § 111a StPO auf.64 Letztgenannte komme jedoch nur in Betracht, wenn man die Kuratel als Strafe einordne, und bringe zudem das Risiko mit sich, nicht durch eine endgültige Entscheidung gedeckt zu sein.65
Napp sieht – unter Einbeziehung der Positionen Schünemanns und Heines66 – den Vorteil der Kuratel darin, dass sie einerseits Gesellschafter, Arbeitnehmer und Gläubiger am wenigsten belaste, andererseits aber – bereits durch ihre Androhung – Topmanager und Unternehmensleitung unter Druck setzen könne, da die Kuratel ihr persönliches Ansehen schmälere. Die Unternehmenskuratel sei die für das Unternehmen schonendste und bezüglich der Vermeidung künftiger Straftaten wirksamste Sanktion.67 Problematisch seien jedoch neben der Schwierigkeit, einen geeigneten „Unternehmensüberwacher“ zu finden, der Aufwand und die Kosten der Aufsicht.68
Napp äußert ferner Bedenken gegen das Modell Schünemanns: Aus ihrer Sicht ist nachteilhaft, dass bei weiteren Zwischenfällen während der Kuratel lediglich der Zeitraum für die Dauer der Aufsicht erneut zu laufen beginne, sodass es für das Unternehmen bei einer Bewährung bliebe, die zeitlich ausgedehnt werde.69 Napp bezweifelt den von Schünemann angeführten Effekt, dass sich Manager durch eine Einsetzung oder Verlängerung der Kuratel beeindrucken und/oder ausreichend abschrecken lassen.70 Sie vermisst eine weitere bzw. die „eigentliche“ Sanktion, wenn die Kuratel nicht zu den erwünschten Änderungen führe; es fehle – wie bei der Strafaussetzung zur Bewährung – die Verhängung einer an sich bereits verwirkten Strafe, deren Vollstreckung zurückgestellt wurde.71
Im Rahmen der Diskussion um ein Unternehmensstrafrecht und mögliche Alternativen wird zudem auch von Autoren wie Scholz72, Bottke73, Beukelmann74 oder Trüg75 als mögliche Rechtsfolge einer Unternehmensstrafe die Anordnung von Aufsicht durch einen Treuhänder oder ein Gremium angeführt.