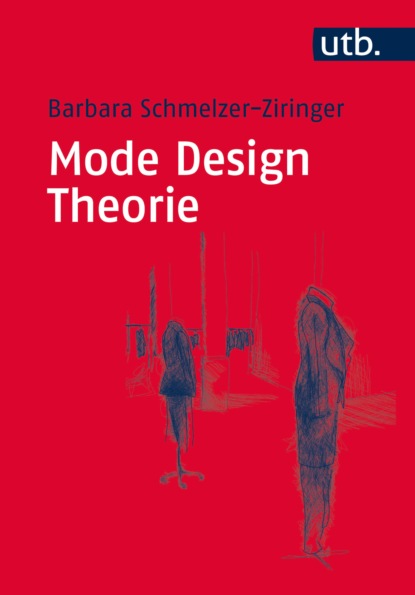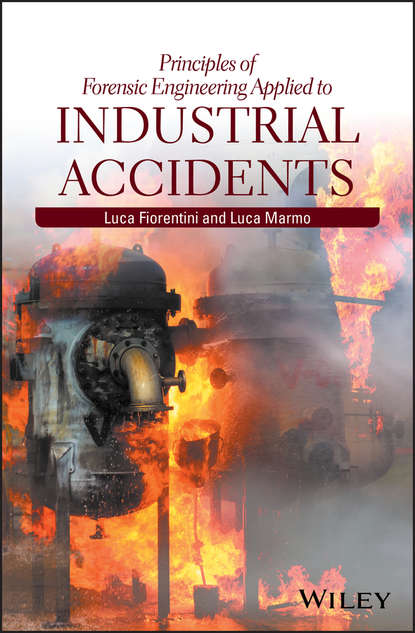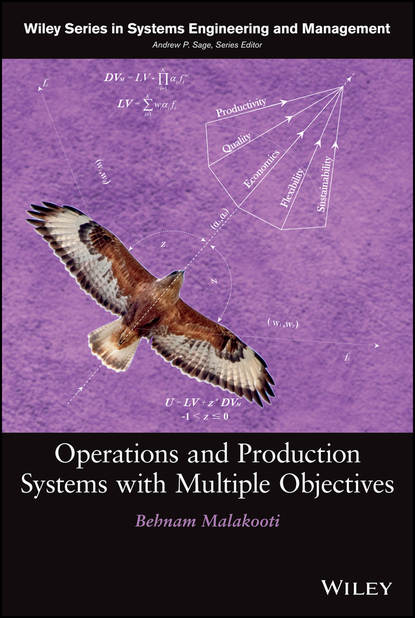- -
- 100%
- +
Der singuläre Status des Modedesigns als Unterdisziplin des Industrial Designs ist insofern herauszustreichen, da die Gestaltung und Verwendung von Bekleidung direkt an die menschliche Gestalt gebunden ist. Modeentwürfe folgen den bestehenden Prämissen des menschlichen Körpers in allen seinen Erscheinungsformen, Funktionen und Bewegungen. Den intrinsischen Körperfunktionen gegenüber – wie beispielsweise Hautatmung und Bewegungsfreiheit – ist bei der Bekleidungsgestaltung Beachtung zu schenken, wohingegen die Gestaltung von Wohnmobiliar, Küchengeräten, Automobilen etc. dem Körper Gegenstände bietet, auf die Menschen einwirken und deren Funktionen auf spezifische extrinsische Zielsetzungen gerichtet sind.
Das Textildesign geht mit dem Modedesign insofern Hand in Hand und ist der Bekleidungsgestaltung immanent, wenn Stoffe in der unmittelbaren Körpersphäre eingesetzt werden und nicht im innerhäuslichen oder industriellen Bereich. Als zweite Haut ist Kleidung einer dritten vorgelagert, wie sie Innenraumensembles bieten, wobei sich Mode- und Produktgestalter/innen in beiden Sphären bewegen können.64 Zwischen Modedesign und weiteren Industrial Designdisziplinen wie Interior Design, Automotive Design, Hardware Design, Maschinendesign etc. bestehen Überlagerungen, [<<28] denn der Wissenstransfer bezüglich Textilien, Bekleidung, deren Herstellung und über die dafür benötigten Technologien erfolgt stets über tradierte Wissensbestände und Kulturpraktiken.
Im breiten Spektrum handwerklicher Tätigkeiten setzte der Originalitätsanspruch der eigenen Arbeit erst Ende des 19. Jahrhunderts mit den „Avantgardebewegungen der Moderne und der darin angestrebten Annäherung von Kunst und Design“65 ein. In diesem Zirkel schlossen sich die Diskursformationen um Imitation, Originalität, Genialität und individueller Schaffenskraft als Entitäten der ‚künstlerischen Gestaltung‘, die in bildenden und angewandten Künsten als Leitbegriffe für ihre ökonomische Verwertung zum Ausdruck kommen.66 Irgendetwas zu schaffen reicht nicht aus, um sich im Marktgeschehen erfolgreich zu behaupten. Trendbewusst, innovativ, künstlerisch-kreativ zu sein und eine individuelle Designhandschrift herauszustreichen, ist gefragt. Von Designer/inne/n wird ein (Selbst-)Marketingkonzept verlangt, das diese Leitbegriffe überzeugend vermittelt.67 Hierbei geht es keineswegs um eine creatio ex nihilo,68 eher um eine Modifikation des Bestehenden, einem redesign im (post)modernen Sinne – das letztlich, wenn es sich durchsetzt, werbewirksamen Geniecharakter erhält, denn der Wert von ,Kreativität‘ wird in kapitalistisch ausgerichteten Gesellschaften nach deren Markterfolg bemessen.69
1.2 Kunst versus Design. Design versus Mode. Creative Industries versus ?
Ein kritisch intendiertes Designpostultat erschien 1990 in einem Sonderheft des damals äußerst renommierten Kunstmagazins ART Position. Die Gründung und die Popularität des Magazins profitierten von einer sukzessiven Kommerzialisierung der Kunst, was die inhaltliche Auseinandersetzung mit Design verstärkte. Hier war zu [<<30] lesen, dass Design und Kunst im Kern verschieden seien, und Kunst „ihrem Wesen entsprechend, nicht zweckgebunden [ist], im Unterschied zum Design, das sich selbst in der Negation des Zweckes an ihm orientiert“.70 Unter den einzelnen ‚Paragrafen‘ stand des Weiteren „IX. Design braucht Vergegenständlichung, Kunst ist Vergeistigung“ und „X. Design ist immer Folge, Kunst immer Ursprung“.71 Ähnlich streng waren designpädagogische Positionen formuliert, die ihre Dogmen in Anlehnung an das legendäre Bauhaus oder die Hochschule für Gestaltung in Ulm verfassten. Noch 1983 beschrieb der österreichische Industriedesigner Herbert Lindinger ein funktionalistisches Konzept der „Guten Industrieform“ in zehn Punkten. An erster Stelle stand ein hoher praktischer Nutzen, gefolgt von ausreichender Sicherheit, langer Lebensdauer und Gültigkeit. Unter einem weiteren Punkt forderte er eine ergonomische Anpassung ein. Diese Wertmaßstäbe waren für ihn nicht statisch zu denken, denn sie unterlägen einer langsamen stetigen Veränderung, da die Industrieproduktion in einem Spannungsfeld zwischen technischem Fortschritt, sozialem Wandel, ökonomischen Gegebenheiten und den Entwicklungen in den Künsten, Architektur und Design stehen würde.72 Selbstredend bezog sich eine solche Ausformulierung nicht auf Modedesign, da diese Disziplin a priori eher dem Styling73 zugeordnet war, das im Ruf des Unnützen, Unpraktischen, Oberflächlichen und Vergänglichen stand.
Die theoretische Forderung, ein beinahe asketisches Design anzustreben, das ein dementsprechendes Konsument/inn/enverhalten erforderte, konnte in den 1980er-Jahren nicht mehr durchgesetzt werden, schon allein, weil Marktinteressen die Verschiebungen zu einem Design im Sinne eines ästhetischen Aufwertens von Produkten aller Art – im Sinne des Stylings – privilegierten. Diese Herangehensweise prägt nicht nur mehr den Modebereich. ‚Ästhetische Dienstleistungen‘ vereinnahmen unter dem Paradigma einer ‚Kultur- und Kreativwirtschaft‘ vermehrt den gesamten Kunst- und Designbetrieb. Der Kultursoziologe Andreas Reckwitz schrieb dazu: [<<32]
„Der postmoderne Modedesigner vermag somit seine Stellung als Kreativstar, [die] ihm schon Ende des 19. Jahrhunderts zugewachsen ist, noch auszubauen und sich als eine medial sichtbare Figur zu inszenieren, die den Künstlermythos zitiert. Am vorläufigen Ende dieses Prozesses der Transformation des Modesystems ist die Modebranche als Knotenpunkt in der ästhetischen Ökonomie insgesamt aufgegangen, in der die Grenzen zwischen Mode, Design, Werbung, Medien, Kunst, Starsystem und Verkauf fließend geworden sind. […] Mode wird zum Bestandteil des Designs von Alltagsobjekten insgesamt, so wie Letztere sich in Gegenstände der Mode im weiteren Sinne verwandelt haben.“74
Andreas Reckwitz setzte sich mit der Figur des Kreativitätsdispositivs75 auseinander, die seiner Einschätzung nach seit den 1980er-Jahren in einer letzten Phase „in der kulturellen Prägekraft der creative industries, der Kreativitätspsychologie, dem erweiterten Starsystem, der globalen postmodernen Kunst sowie der politischen Planung der creative cities“76 eine neue Hegemonie hervorbrachte. Der zugehörige Forschungsansatz, die Wirtschaftsästhetik, untersucht die Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Kunst – wobei eine klare Zielsetzung vorformuliert, wie die Befunde aus der künstlerischen Praxis im Rahmen von Management- und Marketingprozessen genutzt werden können.77 „Das Doppel von Kreativitätswunsch und Kreativitätsimperativ“ reicht heute laut Reckwitz „weit über die Felder von Arbeit und Konsum hinaus. Es umfasst die gesamte Struktur des Sozialen und des Selbst der Gegenwartsgesellschaft.“78
Der Mythos des ‚Kreativen‘ unterlag in den letzten Jahrzehnten einer Ökonomisierung, Popularisierung und Multiplikation, sodass (Mode-)Designer/innen keinen speziellen Anspruch darauf haben, kreativ zu arbeiten, da dies gegenwärtig keine wirklich originelle Herangehensweise mehr darstellt. Anstelle der Kreativität ist im Industriedesign das ultimative Moment technologischer Innovation getreten, das [<<33] marktwirtschaftliche Vorteile verspricht und auch den High-End-Modesektor beeinflusst. Heutzutage vermeiden Modedesigner/innen bei ihrer Selbstdarstellung tendenziell die Vokabeln ‚kreativ‘ und ‚innovativ‘, eher werden rational bedingte Designprozesse mit spezifischen Konzeptionen kommentiert oder diesen stehen affektive Designentscheidungen gegenüber. Derart spontan vermittelte Gestaltungsimpulse mit autobiografischem Hintergrund sind ganz im Zeitgeist eines omnipräsenten und schicken I like it/I love it verortet. Die von Unternehmer/innenkapital bezahlten, privilegierten High-End-Modedesigner/innen sind als hoch dotierte Dienstleister/innen innerhalb des Kreativitätsdispositivs der Creative Industries tätig. Im Rahmen deren Etablierung „bilden sich zeitgleich vor allem drei solcher kurzfristig marginaler, langfristig aber wirkungsmächtiger Branchen einer ästhetischen Ökonomie: die (Bekleidungs-)Mode, die Werbung und das Design“79, wie Reckwitz betonte. Die sanktionierte Zusammenarbeit von Kreateur/inn/en der ‚Moden‘ mit der Tourismus-, Unterhaltungs- und Luxusindustrie setzt auf die gleichzeitig destruktiven und erneuernden Faktoren der Warenzirkulation – egal ob Kleidungsstücke, Accessoires, Kosmetika oder Schmuck –, die der Logik eines ästhetischen Konsumismus folgen. Werbung, Public Relations, Management und Marketing sind mittlerweile selbstverständlich in die Entwurfspraxis eingebunden.80 Dieser Konnex schließt in seiner Überbewertung des ‚Marktes‘ jene Modedesigner/innen aus, die sich aus finanziellen Gründen keinen Werbeapparat leisten können. Investor/inn/en, das Personal von Marketingabteilungen, Modedesigner/innen, Modefotograf/inn/en, PR-Agent/inn/en und Moderedakteur/inn/e/n sind in der heutigen ‚Modeszene‘ so eng miteinander verknüpft, dass die gegenseitigen, ‚kreativen‘ Abhängigkeiten kaum mehr wahrgenommen werden, sondern als Kooperationen laufen.81 Modedesigner/innen sind bereits zu Beginn des Entwurfsprozesses dazu gezwungen, die Vermarktungsstrategien und deren konkrete Umsetzung mitzudenken,82 was im Rahmen der Konzeption der meisten künstlerischen Ausbildungen im Übrigen als selbstverständlich angesehen wird. Mit dieser Tendenz geht im Fachbereich Modedesign die Etablierung der vom Design relativ abgekoppelten Ausbildungsformate Modemarketing sowie Mode- und Textilmanagement-Studiengänge einher.83 [<<34]
Doch stehen Entwerfer/innen und Künstler/innen in einem paradoxen Verhältnis zum ‚Markt‘, der einerseits das wirtschaftliche Überleben sichern soll, aber andererseits seine ,eigenen Logiken‘, politische und ökonomische Argumente als Instrumente der Herrschaft über die Gestaltung aufzwingt. Die Setzung des Begriffs der Creative Industries verdeutlicht die Situation einer politisch gewollten Industrialisierung der Kreativität zugunsten einer ökonomischen Verwertbarkeit, wie sie in Großbritannien seit der Amtszeit Tony Blairs konkret angestrebt wurde.84 Mit der neoliberalen Wirtschaftsordnung sind ‚Design und Kunst‘ zu Industriezweigen geworden. Das akademische Ausbildungswesen hat die offizielle Funktion Künstler/innen hervorzubringen, die ‚Kunst‘ im Sinne von Investitionsobjekten für den Museumsmarkt, für Galerist/inn/en oder Sammler/innen ‚produzieren‘, während Designobjekte nach wie vor zumeist als Prestigeobjekte und nur in Ausnahmefällen als Investitionsobjekte fungieren. Da Kunst- und Designbetrieb nunmehr an eine größtmögliche Kommerzialisierung gekoppelt sind, haben sich die Synergien zwischen Modedesign als angewandter Kunst – per definitionem einer Disziplin, die Gebrauchsgegenstände hervorbringt – und den bildenden und darstellenden Künsten verstärkt. Grundsätzlich bleibt der Entscheidungsrahmen für freie künstlerische Produktionen weiter gespannt als für das Design von Gebrauchsgegenständen. Nach wie vor subsumiert der Begriff „Produktdesign“ den Gestaltungsprozess von Dingen, die in Serienproduktion hergestellt und als Massenartikel vermarktet werden. Um Distinktionsgewinne für industrielle Massenerzeugnisse zu erreichen, hat sich eine spezifische Marktstrategie für die Bewerbung von Design entwickelt, die sich am ‚Künstlertum‘ anlehnt, während umgekehrt die Kunst in den Massen- und Kapitalmarkt drängt. In dieser ökonomisierten Annäherung der Disziplinen Design und Kunst hat die ‚künstlerische Freiheit‘ keine Bedeutung, weil Künstler/innen und Designer/innen vermehrt ökonomisch orientierte Strategien verfolgen, die auf die Artefakte einwirken und diese als Investitionsware banalisieren – so zum Beispiel wenn Designprodukte als artist’s oder limited editions in Galerien angepriesen werden, was der Kunsttheoretiker Walter Grasskamp bereits 1992 als „‚Verkunstung‘ des Designs“ kritisierte:
„Statt in der ästhetischen Domäne des Design, dem Gebrauchswert, zu verbleiben, dem noch die eitelsten Gestalter der Moderne stets Rechnung getragen haben, desertieren die Junggestalter in die Galerien und Kunstmärkte, wo sie mit schräg aufgepepten Design-Unikaten der Kunst deren ästhetische Domäne, den Ausstellungswert, streitig machen. Gewiß war dem Design immer schon eine Prise Ausstellungswert eigen, war es doch stets auch eine [<<35] Inszenierung der Dinge. Doch geht es jetzt ums Ganze, um den Ausstellungswert als Show-Effekt. Sogar um den Preis einer demonstrativen Unbrauchbarkeit ihrer Gestaltungen, wie sie nachgerade in Mode gekommen ist, setzen sie auf den Ausstellungswert des Design, um das unästhetische Ziel beider Künste, den Tauschwert, zu realisieren.“85
Mit dieser Taktik entkommen Modedesigner/innen dennoch nicht dem Zwang, saisonale Kollektionen statt Einzelstücke zu schaffen. Das Genre der Kleidermode ist dem institutionalisierten Modewandel verpflichtet,86 während den sogenannten ‚freien‘ künstlerischen Produktionen zumindest das Privileg bleibt, gewisse Spielräume in der Herstellungsplanung zu genießen, sofern dies der Ausstellungs- und Galerienbetrieb weiterhin zulässt. Zahlreiche Ausstellungen zu Mode und Kunst versuchen die vorhandenen Synergien publikumswirksam zu forcieren. Parallel zur verstärkten Musealisierung von vestimentären Artefakten setzte eine breite soziologische, kunst- und kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Mode beziehungsweise deren Musealisierung als ‚Kunst‘ ein.87
1.3 Designwissen – Wissen zum, durch und über Modedesign
Die Verwissenschaftlichung des Designs schreitet mit dem Anspruch voran, die Entwurfs- und Herstellungsprozesse von Artefakten aus industrieller Produktion in einen Wissenschaftskanon zu fassen, um eine Methodologie des Designs zu entwickeln und deren Produktivität für andere Disziplinen zu erforschen.88 Gui Bonsiepe stellte als [<<36] Designtheoretiker dazu trocken fest: „Das kalte Bad der Verwissenschaftlichung und Rationalisierung dürfte einem auf Technik und Industrie ausgerichteten Beruf nicht erspart bleiben.“89 Die Entwicklung einer Designmethodologie steht und fällt laut Bonsiepe mit der „Hypothese, dass es beim Gestalten Invarianten gibt, aus denen sich ein Gerüst für das Gestalten bauen lasse“.90 Doch unterschiedliche Entwurfsprozesse implizieren, dass sie aus sich heraus spezifische Entwurfsmethoden entfalten, die sich nicht verallgemeinern lassen, was dem Ziel einer Methodologie entgegenstünde. Doch gerade dieser „Widerspruch wäre auszutragen“.91
Die wissenschaftliche Einsicht, dass Entwurfsprozesse die Welt gestalten, dass sie jede alltägliche Form, jedes alltägliche Ding genau bestimmen92 und nicht nur Wissenschaft und Forschung als ‚Entwicklungsmotoren‘ einsetzbar sind, ist in den Human- und Technowissenschaften selbstverständlich. In deren Verzahnung verschiedener Disziplinen wird nicht mehr allein deskriptiv-analytisch, sondern vermehrt kreativ geforscht, um Biofakte zu erzeugen.93 In der Pharmaindustrie spricht man mittlerweile vom Wirkstoffdesign und Arbeitsprozesse unterliegen einem Prozessdesign. Medikamente und Bekleidung wirken gleichermaßen auf menschliche Körper ein und verlinken sich bei der Entwicklung biofunktionaler, medizinischer Textilien, die Wirkstoffe über die Kleidung in die Haut transferieren bzw. den Körper gegen Keime und Bakterien schützen.94
Die Verwissenschaftlichung des Designs95 verspricht auch den Modeakteur/inn/en enormen Prestigegewinn, da deren Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen physischer und psychischer Natur verstärkt wahrgenommen wird. In diesem Prozess wird das Styling, jene Tätigkeit der Oberflächengestaltung, die gerade das Modedesign von ‚harten‘ ingenieurmäßigen Industriedesign-Disziplinen96 und von der Architektur trennt, aufgewertet. Denn für eine erfolgreiche Markteinführung benötigen insbesondere neue und ungewohnte technologische Entwicklungen eine kundengerechte [<<37] Verpackung – ein optimiertes Styling –, damit sie an bestehende ästhetische Gewohnheiten anschlussfähig werden. Aktuell wird als gangbare Zukunftsvision der textilen Körperhülle die Funktion einer Schnittstelle zwischen Körper und technologisierter Umwelt eingeschrieben, und als unmittelbares ‚intelligentes‘ Medium im Sinne von techno fashion konzipiert.97 Jenseits des militärischen Gebrauchs sind die Zielsetzungen und der tatsächliche Nutzen ‚hochtechnologisierter‘ Bekleidung noch nicht abzuschätzen, da derzeit vorwiegend Studien und Prototypen vorliegen, die für eine zivile Nutzung und um weltweit wettbewerbsfähig zu sein erst Produktions- und Marktreife erlangen müssen. Diese verstärkte Entwicklung zur Kooperation von Modeindustrie und Technologiekonzernen zeichnete sich 2013 mit dem Wechsel des Yves-Saint-Laurent-CEO Paul Deneve zum Computerhersteller Apple öffentlich ab, nachdem er eine langjährige Karriere in der Modebranche hinter sich hatte.
Hatte Mart Stam den Begriff des Industriedesigners noch nicht unter besonderer Berücksichtigung der Bekleidungsgestaltung in die (deutschsprachige) Welt gesetzt,98 so sehr haben die Publikationen zu Mode im Kontext von Design und Technologie in den letzten Jahren zugenommen. Doch steht bisher kein ausreichendes Theoriekorpus zur Verfügung, der Designtheorie als eigenständige akademische Disziplin bestätigen würde, und es steht nach wie vor infrage, ob dies anzustreben wäre.99 Die Unschärfe des Gegenstandes basiert paradoxerweise gerade auf den theoretischen Schriften zum Design. Victor Papanek behauptete, dass jeder Mensch grundsätzlich ein Designer sei, oder zumindest alles, was wir tun, auf Design beruhe, wenn dies im Sinne einer telesis „bewußtes Handeln zur Herstellung sinnvoller Ordnung“ darstelle.100 Laut der Designtheoretikerin Claudia Mareis favorisieren „diejenigen Positionen, die an das intellektuelle Erbe des Design Methods Movement der 1960er und -70er Jahre anschließen […] insbesondere technische bzw. technikaffine Designtätigkeiten als Untersuchungsgegenstand“, wie zum Beispiel aus „der Architektur, den Ingenieur- und Planungswissenschaften oder der Informatik“.101 Derartige Designforschungsansätze wiesen gleichzeitig „gewisse technokratische und androzentrische (auf ‚Männlichkeit‘ ausgerichtete) Prägungen“ auf.102 [<<39]
„Auch wurde im Design Methods Movement dezidiert zwischen den Vorgehensweisen von Designern und (Natur-)Wissenschaftlern unterschieden. Nur vor diesem Hintergrund ist es heute zu verstehen, dass Design als Disziplin der ‚Synthese‘ oder des ‚Dazwischen‘ postuliert wird: zwischen den Disziplinen, zwischen den Dingen, zwischen Kunst und Wissenschaft, zwischen Erkennen und Handeln… Analogien zu zeithistorisch relevanten Wissensmodellen sind da kaum von der Hand zu weisen. Zum einen gilt dies mit Blick auf die in den 1960er Jahren virulente Debatte zu den ‚zwei Kulturen‘ der Geistes- und Naturwissenschaften […], zum anderen hinsichtlich kybernetischer Leitideen.“103
Die Konzeption von Design als Hybriden „wird vom Topos eines fehlenden ‚Dritten‘ angeleitet“ und diesem Dritten gegenüber bleiben die Dichotomien zwischen Theorie und Praxis, Ideellem und Materiellem aufrecht.104 Dagegen schlug Mareis vor, „Design als eine historisch kontingent gewachsene Wissenskultur zu verstehen und ihre multiplen Praktiken, Mechanismen und Prinzipien zu befragen“.105
Für die theoretische Auseinandersetzung mit Kunst und Design stellt die dreifache Typologie Christopher Fraylings, die von Alain Findeli näher bestimmt wurde, ein Raster dar,106 das im Hinblick auf Modedesign sinnvoll anzuwenden ist.107
1. Unter Forschung für Kunst und Design108 wären im Hinblick auf das Berufsbild des Modedesigners/der Modedesignerin das elementare Erlernen von Praktiken und der Researchprozess zu verstehen, welche die Entwürfe und Modelle von Modekollektionen antizipieren. Das Wissen darüber ist später implizit in den Kollektionsteilen respektive Kleidungsstücken enthalten.
2. Forschung durch Kunst und Design ist eine Art projektgeleitete, wissenschaftliche Forschung, die für die Praxis produktiv gemacht wird.109 Diese kann alle Versuche im Modebereich einschließen, die auf eine verbesserte (Entwurfs-)Technik zur Herstellung von Bekleidung abzielen, genauso wie jedwede Gestaltungsprozesse, textiltechnologische Verfahren, experimentelle Produktionstechniken und [<<40] Materialforschung etc. Damit wären die partizipative Erfassung der jeweiligen Effekte und der eventuelle Nutzen für andere Disziplinen verbunden.
3. Zur Forschung über Kunst und Design zählt im Besonderen die Konzeption von theoretischem Wissen, von Mode- bzw. Designgeschichte und die Erstellung kanonischer Texte, welche praxisorientierte, vestimentäre Wissensbestände in Theorie überführen. Findeli kritisierte, dass diese meist eine mangelnde Relevanz für die Designpraxis aufweisen würden, wenn die Fragestellungen dafür mehrheitlich auf die jeweiligen soziologischen, historischen oder anthropologischen Forschungsdisziplinen ausgerichtet blieben.110
Obwohl derzeit eine Verschiebung zur Interpretation methodisch-systematischer Prozesse des Designs zu beobachten ist,111 verbleibt erfahrungsgeneriertes Modedesign-Wissen strukturell in der Kategorie des impliziten, stillen, intuitiven Wissens. Dieses ‚geheime‘ Wissen durch Erfahrungen, das Designer/innen im Laufe ihres Arbeitslebens sammeln, wird grundsätzlich erwartet, um konkurrenzfähig zu sein. Es kann nicht als explizites, als speicherbares und als solches übertragbares Wissen zur Verfügung stehen, denn gerade dieses spezielle Wissen zeichnet einzelne Designer/innenpersönlichkeiten aus.112 Jene kognitiven Prozesse werden von Nigel Cross als Design Thinking oder Designerly Ways of Knowing untersucht.113
Designwissenschaft verfolgt mit der Anrufung des Designs als Wissen das Ziel dieses stille, implizite Wissen, das im Körper verortet ist, jenes inkorporierte ‚Vermögen‘ zu externalisieren und dieses ,habituelle Können‘ zum Sprechen zu bringen, damit es für weitere Produktionsprozesse reproduzierbar und verwertbar wird. Claudia Mareis verwies mit Nachdruck darauf, dass Designforschende
„künftig nicht umhinkommen, sich über praxisbasierte und angewandte Fragestellungen hinaus, in einer differenzierten und kritischen Weise mit den Kriterien und Werten, aber auch mit den Mythen und Kulturen sowohl des wissenschaftlichen als auch künstlerischen Arbeitens auseinanderzusetzen, wenn in einer ernstzunehmenden Weise zu einer kritischen Geschichtsschreibung des Wissens beigetragen werden soll.“114 [<<41]
Dahin gehend und im Sinne des Philosophen Michel Foucault ist es möglich und wünschenswert, dass Modedesigner/innen auch als Forschende ihr eigenes Tun verwissenschaftlichen und damit aktiv in die „Wahrheitsspiele“115 der Produktion und Konstitution von „Designwissen“116, in die Konjunktion von Macht und Wissen eingreifen.
1.4 Genealogische Machtaspekte der (Mode-)Designtheorie
Das Studium der Objekte und Prozesse von unterschiedlichen Bekleidungskulturen schafft in zahlreichen Disziplinen interdependente Wissensbeziehungen. Die postkoloniale Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak merkte an, dass Theorie und Praxis voneinander abhängig und durchdrungen seien.117 Der Designtheoretiker Gui Bonsiepe pflichtete dem zu, wenn er schrieb: „Theorie macht explizit, was implizit bereits in der Praxis steckt.“118 Design und dessen Diskurse – und somit auch das Modedesign – reflektieren, was globale Wirtschaftsbelange sind, nämlich unter dem Banner der Globalisierung einen Wirtschaftsfundamentalismus auszurufen, der die Welt nach hegemonialen Interessen formt und dabei rücksichtslos über die sozialen und politischen Beziehungen der Menschen hinweg waltet.119 Spivak verortete die Machtbeziehungen zwischen Theorie und Praxis folgendermaßen:
„Since practice is an irreducible theoretical moment, no practice takes place without presupposing itself as an example of some more or less powerful theory. The notion of writing in this sense actually sees that moment as itself situatable. It is not the notion of writing in the narrow sense so that one looks at everything as if it is written by some sort of a subject and can be deciphered by the reading subject.“120 [<<42]
Das Spannungsverhältnis zwischen Hand- und Kopfarbeit als Gestaltungsprozesse sowohl künstlerischer als auch industrieller Produktion zeichnet eine lange Historie von Theorie-Praxis-Kontroversen aus. Design erhält über die Produktionsprozesse der gestalteten Dinge eine politische Dimension. Dabei ist es gleichgültig, ob Designer/innen der ‚Demokratisierung‘ von massengefertigten Produkten zuarbeiten oder die Gestaltung von Luxuswaren erarbeiten, da diese beiderseits als Identifikationsobjekte einer Gesellschaft deren Werte und Normen strukturieren. Dieser Aspekt prägte im 19. Jahrhundert die Diskurse zur Industrialisierung und Massenproduktion. Die Mode- und Textilindustrie ist nach wie vor auf manuelle Tätigkeiten innerhalb des mechanisierten und automatisierten Produktionsablaufs angewiesen. Die Konsequenzen daraus spiegeln sich in neokolonialen Strukturen der Ausbeutung von Menschen in ‚armen‘, ehemals kolonialisierten Ländern wider, die nun als ‚Werkbänke der Welt‘ fungieren. Der Herstellungsvorgang und der Designvorgang sind getrennte Produktionssphären, in denen mit Beginn der Ära des Wirtschaftskolonialismus die Bewohner/innen der ‚westlichen‘ Hemisphäre als ‚kreative Wissensgesellschaft‘ privilegiert sind. Die ‚Entwicklungsländer‘ erhalten heute einen Technologie- und Know-how-Transfer, der erklärtermaßen die Vorteile der ‚Geberländer‘ im Blick hat. Bonsiepe hob die globale soziale Verantwortung, die Designer/innen auch in diesem Zusammenhang tragen, hervor und kritisierte an der Begrifflichkeit Design dessen Beliebigkeit. Die weltweit bekannten Namen von Modedesigner/inne/n, die eher als Stylist/inn/en arbeiten, wie Pierre Cardin, Calvin Klein, Giorgio Armani u. v. a., werden mit einem Arsenal an profanen Dingen assoziiert, wie etwa Unterhosen, Taschen, Parfüms, Kosmetika etc. Dies habe in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, dass Designer/innen nur Umhüllungen schaffen würden, statt sich mit „intelligenten Problemlösungen“ zu beschäftigen.121 Der Bereich der Mode bringt das Design in den „Ruf der ästhetischen Spielerei, der Boutiquisierung der Gegenstandswelt“.122 Eine ähnliche Diagnose stellte der Architekt Adolf Loos bereits vor mehr als hundert Jahren, als er nicht nur gegen das Ornament, sondern auch gegen jedwede Übertriebenheiten der Moden seiner Zeit ins Feld zog, und einzig die Herrenbekleidung jenseits industrieller Herstellung – als Sache eines versierten (englischen) Schneiderhandwerks – positiv bewertete.123 William Morris schätzte die Industrialisierung noch 1892 als einen „unakzeptable[n] Unfall der Geschichte“ ein. Als „sozialistischer Moralist“ argumentierte er nicht „grundsätzlich [<<43] gegen die Maschinerie und das Fabriksystem“, sondern kritisierte die damit verbundenen Eigentumsverhältnisse, während Gottfried Semper um 1850 die industrielle Entwicklung als unumkehrbar ansah.124