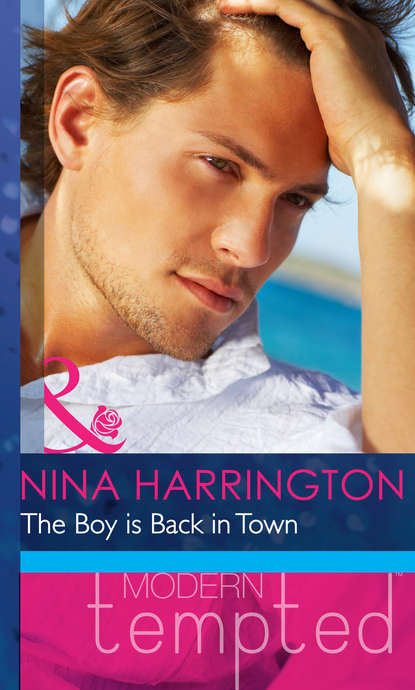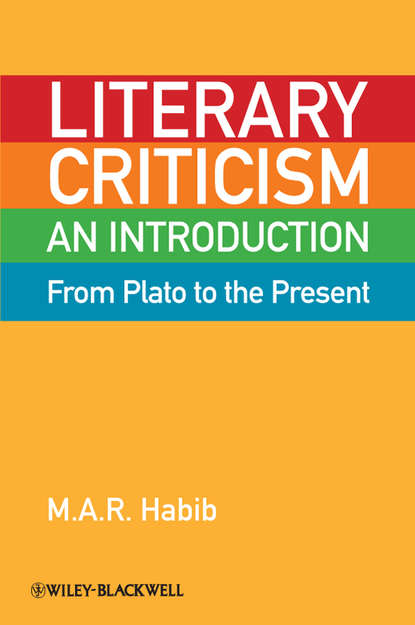- -
- 100%
- +
Nur noch ein Flackern am dunstigen Himmel wies auf die Feuersbrunst hin. Er war in Sicherheit.
* * *
Drei Tage später folgte Kraeh einer befestigten Straße, die nach Brisak führen würde; zumindest hatte dies der freundliche Schäfer behauptet, der seinen Weg gekreuzt hatte. Natürlich hätte er nach seinem überstürzten Verlassen der Stadt, in der er das Wirtshaus in Brand gesteckt hatte, auch einen weniger auffälligen Pfad durch die Wälder einschlagen können, doch schien es ihm sinnvoller, der einmal geglückten Strategie treu zu bleiben. Wer würde einen Flüchtling schon auf dieser Straße erwarten, wo dermaßen viel Betrieb herrschte? Unentwegt überholten ihn Abenteurer, Soldatentrupps, meist jedoch Bauern und Holzfäller, die Wagen angefüllt mit ihren Waren, die sie in Brisak gegen einen guten Preis zu verkaufen trachteten. Niemand schenkte dem alten Bettler, für den man ihn zweifelsohne hielt, besondere Aufmerksamkeit. Anfangs war er noch nervös geworden, wenn sich Hufgetrappel genähert hatte, nun grüßte er die Soldaten in ihren hell wattierten Wappenröcken gelegentlich sogar. Für gewöhnlich fing er sich daraufhin ein »Aus dem Weg da!« ein, zuweilen aber auch einen mitleidigen Blick, gefolgt vom Klimpern einiger Kupferstücke, welche über den Pflasterstein rollten, ehe er sie einsammelte.
Die Sonne stand im Zenit, ein flüsternder Wind ging durch seinen Bart, während er in einen wurmdurchlöcherten Apfel biss, der von der Ladefläche eines vorbeiholpernden Karrens gehüpft war. In der Tat war er zu einem Bettler und obendrein zu einem Dieb geworden, denn manchmal musste er dem Hüpfen von Äpfeln, Birnen und Nüssen ein wenig nachhelfen. Doch fühlte er sich deshalb nicht elend. Er hatte alles, was ein Mann brauchte: ein Ziel und ein Feindbild. Diese verdammten Zwillinge hatten seiner Retterin und Gönnerin das Leben genommen, dafür würden sie bezahlen.
Hauptsächlich von diesem Gedanken angetrieben, schlug er sich mehr schlecht als recht durch, bis er schließlich in der Ferne die zackigen Mauern Brisaks ausmachte. Mehr als einmal hatte er in letzter Zeit von der Gastfreundschaft jener Menschen profitiert, deren Gehöfte in der Nähe der Straße lagen. Teilweise gegen das wenige Geld, welches man ihm zugeworfen hatte, öfter allerdings umsonst, war ihm ein spärliches Mahl und ein Platz in den Ställen zugestanden worden. Früher, erinnerte er sich, hatte er die Nächte unter freiem Himmel geliebt. Heute war ihm das einsame Bibbern zusammengekauert unter Felsvorsprüngen, Hecken und kahlen Baumkronen zuwider. Immer wenn er sich dazu genötigt sah, fühlte er sich am nächsten Morgen wie gerädert. Schmerzende Knochen, steife Glieder – nein, das Übernachten im Freien war etwas für junge Leute. So dachte er, während die Abendsonne ihr friedliches, goldrotes Licht über die weiten Felder und Baumgruppen ergoss, die sich vor ihm auftaten. Die Szenerie war vertraut, auch wenn das Umland der Festung sich enorm erweitert hatte. Obwohl es ihn noch einen halben Tagesmarsch kosten würde, eines der mächtigen Tore zu erreichen, fühlte er sich schon beinahe Zuhause. Das Krähen eines Hahns von einem Misthaufen lenkte sein Augenmerk auf ein Hofgut. Vom steinernen Schornstein, der wie ein erhobener Zeigefinger aus dem Dach ragte, zogen Rauchschwaden gen Himmel. Hier würde er, hoffentlich zum letzten Mal, um Unterschlupf bitten.
Gegen die Vernunft hoffte er, Heikhe in Brisak anzutreffen. Wer weiß, überlegte er, als seine auseinanderfallenden Stiefel durch den Matsch des Zugangs zum Hof schmatzten, vielleicht richtet sie ein Fest anlässlich meiner Rückkehr aus und stellt mir eine Leibgarde zur Seite, die mich sicher nach Erkenheim geleitet.
Der verwitterte Sandstein, aus dem die Wände des Haupthauses des Gehöfts bestanden, war von Wind und Regen abgeschliffen. Eine gestutzte Ulme lehnte sich an das Gemäuer und diente als zusätzlicher Tragebalken für das löchrige Ziegelsteindach. Wo Sturm und Hagel die Ziegel gebrochen hatten, war Moos und Stroh in die Löcher gestopft worden. Ein schäbiger Anblick.
Ehe Kraeh an die knauflose Tür klopfen konnte, öffnete sie sich. Ein von roten Adern durchzogenes Augenpaar glotzte ihn unter einer wettergegerbten Stirn hervor unschlüssig an. Der Mann war ärmlich gekleidet und stank nach Schweiß. Seine breiten, nackten und behaarten Unterarme hielten eine schartige Axt.
»Wat dich brucht an min Hof?«, fragte der Bauer säuerlich. Seine Wurstfinger umklammerten den Schaft der Axt, dass die hornhäutigen Knöchel bleich hervortraten.
Kraeh machte einen Schritt zurück und hob die Hände, um zu signalisieren, nicht auf Streit aus zu sein.
»Mein Name ist Henfir«, sagte Kraeh in ruhigem Tonfall. »Ich wollte lediglich um eine Schlafgelegenheit bitten.«
Die Knöchel des Bauern nahmen nun die rot gebräunte Farbe der übrigen Haut an, da sich sein Griff um die Axt entspannte. Der Bauer machte jedoch keinerlei Anstalten, ihn hereinzubitten, darum fügte Kraeh hinzu: »Es soll euer Schaden nicht sein. Ich kann bezahlen.« Er senkte seine Hände und beförderte zwei Kupferstücke ins Flackerlicht, das aus dem Inneren des Hauses drang.
»Brunai«, stellte sich der Mann knapp vor und versetzte dem Jungen, der nun neugierig hinter ihm hervorlugte, einen Klaps auf den Hinterkopf.
»Kumm rin«, zeigte Brunai sich nun freundlicher, »min Fruwe het die Nachtemahl beriet.«
Den Weg gab er allerdings erst frei, nachdem Kraeh ihm seine restlichen Geldstücke überreicht hatte. In der Stube saß bereits die ganze Familie zu Tisch, bis auf Brunais Frau, die zu den Tonschalen, welche schon dastanden, eine weitere füllte. Kraeh dankte und fragte sich, auf was die drei Mädchen, die vier Jungs und der Hausherr warteten. Merkwürdigerweise gesellte sich die Frau, der die Schmerzen der Geburten ins abgeschlaffte Gesicht geschrieben standen, nicht zu ihnen. Mit einem sorgenvollen Blick zog sie sich mit ihrem Essensanteil, der wegen des nicht eingeplanten Gastes spärlich ausfiel, in einen Nebenraum zurück.
Brunai erhob sich und faltete die Hände. »Wir lobben dir Gott, der du libbest dein guote Knächte.«
Da er wieder Platz nahm, machte sich die Familie über das Essen her; eine klebrige Pampe aus Milch und aufgelösten Haferflocken, die im Mund knirschte, wegen des mit Erde ausgewaschenen Topfes, wie Kraeh vermutete. Niemand sprach ein Wort. Die jüngste Tochter vergaß über das Bestaunen des Fremden das Essen, was ihr nach einiger Zeit den drohenden Blick ihres Vaters eintrug. Wären nicht zwei der Söhne im Wege gewesen, hätte der Hausherr seine Missbilligung bestimmt mit einem Schlag unterstrichen, die stumme Drohgebärde reichte jedoch aus. Das Mädchen schlang den Brei in sich hinein, ohne sich ein weiteres Mal zu trauen, auch nur den Kopf zu heben.
Das Mahl war rasch zu Ende. Brunais Frau räumte mithilfe der ältesten Tochter – einem hübschen Ding, bald im heiratsfähigen Alter – den Tisch ab, stellte ihrem Mann eine tönerne Flasche sowie zwei Becher hin und verließ gemeinsam mit den Kindern die Stube.
Der Bauer schenkte erst sich, dann Kraeh ein, leerte seinen Becher in einem Zug, schenkte sich nach und schob dem Fremden dann den zweiten Becher hin. In seiner befremdlichen Sprache hob er an, sein Leid zu klagen. Wie viele sei er den Versprechungen des Kaisers auf gutes Land und niedrige Steuern folgend aus dem fernen Süden hierher übergesiedelt. Zwei Söhne habe ihn allein die Reise gekostet. Nach zwei Sommern habe ein Pilz beinahe die gesamte Ernte vernichtet und er sei gezwungen gewesen, den Großteil der gepachteten Äcker brachliegen zu lassen, weil er sich kein neues Saatgut habe leisten können. Zudem seien wegen des Krieges mit den Sihhila gegen die Versprechungen des Kaisers dann doch Steuern erhoben worden, die er nicht zu entrichten imstande gewesen sei. Nun gehöre selbst »dis klih Hus, was sin war« Gunthertocht, der Herrin von Brisak. Kraeh konnte es kaum fassen. Sollten sich seine Hoffnungen erfüllen? Heikhe musste mittlerweile eine alte Frau sein, aber es war nicht unmöglich, dass sie das Zepter noch in der Hand hielt.
Sein Gegenüber, das sich in einem fort in Selbstmitleid erging, erregte in Kraeh kein Mitgefühl. Die Art, in der der Bauer seine Frau und seine Kinder behandelte, machte Kraeh eher wütend. Doch da er nichts daran ändern konnte, bat er den Hausherrn nach einem zweiten Becher des schlecht gebrannten Obstlers, den ihm der Bauer in großzügiger Geste gereicht hatte, ihm seinen Schlafplatz zu zeigen. Schwankend führte Brunai Kraeh zu den Stallungen außerhalb des Haupthauses. Er wies auf eine kläglich von Stroh bedeckte Stelle, die, hätte er es sich leisten können, wohl von einem weiteren Ochsen eingenommen worden wäre. Verstimmt über den Fremden, der so unerfreulich wenig Anteil an seiner Lebensgeschichte genommen hatte, raunzte er einen unwirschen Gutenachtwunsch und machte sich auf in sein Ehebett, wo seine Frau zu ihrem Gott betete, er möge zu betrunken sein, um Interesse an ihrem schon zur Genüge ausgebeuteten Körper zu haben. – Ihre Gebete wurden nicht erhört.
Einen Augenblick sann Kraeh nach, während er es sich so gemütlich wie unter den gegebenen Umständen möglich machte, ob er nicht ein seltsames Leuchten in den wässrigen Äuglein seines Gastgebers gesehen hatte, als er sich vorhin vom Tisch erhoben hatte. War es Gier gewesen? Seine weite Tunika war ihm beim Aufstehen weggerutscht und hatte damit möglicherweise den Blick auf den kostbaren Knauf Lidunggrimms freigegeben …
Aus dem Stroh hatte Kraeh ein Knäuel geformt, das ihm als Kopfkissen diente. Die Halme stachen ihm unangenehm in den Nacken. Seinen Umhang gebrauchte er als Decke. Nicht einmal eine Kerze hatte Brunai ihm dagelassen. So lag er im milchigen Licht des Mondes, das durch die Ritzen im Gebälk über ihm in die Stallung fiel.
Die Ochsen scharrten im Schlaf gelegentlich mit ihren Hufen. Im ganzen Stall stank es nach ihren Ausscheidungen. Draußen bellte ein Hund. Vermutlich war er damit beschäftigt, sein Revier gegen Füchse und andere Räuber zu verteidigen. Und noch etwas war zu hören: das Zanken von Katzen. In Kraehs Ohren klang es immer wie das Jammern kleiner Kinder. Ein unheimliches Geräusch. Er fragte sich, weshalb der Hund dem Streit kein Ende bereitete. Wahrscheinlich hatte der Bauer ihn darauf abgerichtet, die Katzen in Frieden zu lassen, da sie den Hof von den kleineren Plagen wie Mäusen und Ratten säuberten, die nicht in das Beuteschema des Hundes passten.
Auch wegen der Unbequemlichkeit hing er diesen Gedanken eine Weile nach, bis ein Knarren an der Stalltür ihn in die Realität zurückholte. Mit einem Mal wurde ihm klar, dass auch er wohl in ein gewisses Beuteschema geraten war. Ein unterdrücktes Streitgespräch verschaffte ihm genügend Zeit, Stroh zusammenzuklauben und seinen Mantel so darüber auszubreiten, dass es den Anschein erregte, er läge er noch immer an dem Platz, von dem er sich nun schleunigst entfernte.
Keinen Wimpernschlag zu früh, duckte Kraeh sich, als die Tür aufging. Brunai schlich, gefolgt von zweien seiner Söhne, auf leisen Sohlen zu der präparierten Schlafstätte. Einer trug eine abgedämmte Laterne und alle drei hatten Knüppel in den Händen. Ohne Zaudern – das hatte Brunai seinen Söhnen offensichtlich erfolgreich eingebläut, ehe sie den Stall betreten hatten – schlugen sie auf das Stroh ein. Es dauerte lächerlich lange, ehe der Mantel verrutschte und die drei ihren Fehler erkannten.
Kraeh war in der Zwischenzeit aus seinem Versteck hinter einem schlafenden Ochsen hervorgetreten und versperrte breitbeinig die Tür.
Der Bauer und seine Söhne zuckten zusammen, als Kraeh einen Pfiff ausstieß. Der kurze Moment des Schreckens wich jedoch schnell der Habsucht, als Brunais Blick den Greis auf der Schwelle musterte.
»Giffen mir dat!«, stieß er zwischen seinen faulen Zähnen hervor und deutete dabei auf Kraehs Hüfte.
»Was?«, fragte der Alte betont langsam. »Das hier?«
Das magische Schwert fuhr aus der Scheide. Mondlicht huschte über die Klinge und die Lider der drei Augenpaare, die darauf gerichtet waren, weiteten sich. Noch nie hatten sie etwas derart Wertvolles gesehen. Und es war zum Greifen nahe; allein die gichtigen Finger eines steinalten Fremden trennten sie davon, es in ihren Besitz zu bringen.
»Giffen uns dat«, wiederholte der größere der beiden Söhne seinen Vater, »und du kunnst fortegahn.«
Beinahe taten Kraeh die Narren leid. Ohne Frage, er war alt, nicht mehr als ein erbärmlicher Abglanz seiner einstigen Größe, aber genau das würde den dreien zum Nachteil gereichen. Früher hätte er sich vielleicht damit begnügt, ihnen mit ihren eigenen Knüppeln den Hintern zu versohlen, dieser Tage würde er besser sichergehen …
»Du hast recht, ich werde verschwinden«, schleuderte er jenem ältesten Sohn herablassend entgegen, dessen Stirnfalten und Gestik verrieten, dass er die größte Möglichkeit eines unbeschadeten Angriffs in seiner linken, der waffenlosen Seite entdeckt zu haben glaubte.
»Aber ich gehe mit all meinen Sachen, insbesondere dieser.« Dabei drehte er Lidunggrimm so in seiner Hand, dass dem jungen Mann hätte klar werden müssen, wie wenig ausgereift sein Angriffsplan war. Wären sie gemeinsam auf ihn losgegangen, hätten sie eine Chance gehabt, doch das Zaudern Brunais und dessen jüngeren Sohnes bot Kraeh die Möglichkeit, den brutalen von oben herab geführten Schlag des Knüppels mühelos zu parieren. Das Holz splitterte, als es auf die Klinge traf. Kraeh machte einen Satz zurück und zog dem Bauernjungen die Schneide längs über den Bauch. Fassungslos schaute dieser an sich herab. Der Schmerz hatte sein Bewusstsein noch nicht erreicht und so versuchte er, blass vor Schock, seine Eingeweide mit den Händen an ihrem angestammten Platz zu halten. Natürlich war sein Unterfangen vergeblich. Seine Innereien quollen hervor, flutschten durch seine gespreizten Finger und klatschen auf den Stallboden. Er wankte und fiel. Der Vater stürzte neben seinem Sohn zu Boden, nahm den sterbenden Körper in seine Arme und begann, heftig zu schluchzen.
Kraeh wusch die Klinge an einer Decke ab, die über einer Koppel hing, schob sie in ihre Scheide und verließ ohne ein weiteres Wort den Stall. Er empfand keinerlei Mitleid, nur ein Gefühl des Ekels begleitete ihn nach draußen in die kalte Nacht.
Ärgerlich darüber, seinen Mantel zurückgelassen zu haben, beschleunigte er seinen Schritt, um zu verhindern, dass die Kälte, die der feuchte Dunst des Morgens mitbrachte, sich in seinen Gliedern festsetzte. Die Mauern der alten Feste Brisaks wuchsen und Kraehs Gemüt verdüsterte sich, während der goldene Schimmer der Sonne sich auf den Wehrgängen ausbreitete und die Gestalten der Wachposten von den Zinnen abhob. In der Ferne grollte ein Donnerschlag und Kraeh deutete ihn unwillkürlich als schlechtes Omen. Eine Gruppe von drei Wagen näherte sich dem mächtigen Tor, auf das auch er zuhielt. Er korrigierte seinen Gang, und als die Sonne als ganzer runder Ball am wolkenlos blauen Himmel stand, fing er die Gruppe nicht weit von den Mauern entfernt ab. Es waren Händler, die Wagen angefüllt mit Erz, das in den nordöstlich gelegenen Minen abgebaut worden war. Ihr Sprecher, ein feister Kerl, der auf dem vordersten der Wagen vom Kutschbock aus seine Peitsche auf die langhaarigen Lastpferde knallen ließ, hatte keine Einwände, dass der fremde Alte sich ihnen anschloss. Das Schlusslicht des kurzen Zuges bildeten zwei schwer beladene Frauen, die, froh, den langen Weg endlich hinter sich zu haben, trotz ihrer Last zu Scherzen aufgelegt waren. Kraeh lachte ein wenig über ihre derben Sprüche und schließlich, nur wenige Schritte trennten sie noch von den nun offenen Flügeln des Tores, gelang es ihm, der einen ein Stück zerfransten Stoffes abzuschwatzen, das ihr bis dahin als Schal gedient hatte. »Ich kuf mir ehn nuwes, glänzlicheres«, sagte sie lächelnd und zeigte dabei zwei Reihen schlecht gepflegter Zähne. Kraeh band sich den Stoff um die Hüften, was den beiden ein neuerliches Gelächter entlockte. Allmählich gewöhnte er sich daran, dass ihn, den alten Sonderling, niemand ernst nahm, und auch sein Ohr stellte sich auf die Sprache des ländlichen Volkes ein.
Als sie auf Höhe der Stadtwachen anlangten, hatte auch er ein Grinsen aufgesetzt. Zwischen den herumalbernden Frauen fiel er nicht weiter auf und der Soldat, dem eine Mischung aus Müdigkeit und Strenge ins Gesicht geschrieben stand, winkte sie weiter. Jetzt grinste Kraeh nicht mehr. Er wünschte den Weibern einen schönen Tag und verschwand im Gewimmel, das in den engen Gässchen hinter dem zweiten Verteidigungsring schon zu dieser frühen Morgenzeit herrschte.
Kraeh war dergleichen Menschenmassen nicht mehr gewohnt. Ihm schwindelte. All diese Leute, dachte er, alle mit ihrer eigenen Geschichte, ihren eigenen Träumen, ihren eigenen Zielen und Beweggründen. Er blieb stehen, um sich zu sammeln.
Ein breitschultriger Mann, der einen schweren Sack auf dem Rücken schleppte, rempelte Kraeh so heftig an, dass dieser beinahe das Gleichgewicht verlor. Ohne ein Wort der Entschuldigung stapfte der Mann weiter in das undurchschaubare Gewusel. Ein weiterer Ellbogen rammte Kraehs Rippen. Diesmal ging es so schnell, dass er nicht einmal die dazugehörige Person ausfindig machen konnte.
Einfach stehen bleiben war keine gute Idee gewesen. Er setzte sich in Bewegung. In Ermangelung eines besseren Einfalls folgte er der sich kaum merklich nach oben windenden Hauptstraße, die ihn an ihrem Ende zu dem Palas im Zentrum der Stadt führen würde. Zu seiner Rechten erkannte er nach einiger Zeit eine Abkürzung: ein steiles Treppchen, an dessen einer Seite Schießscharten angebracht waren. Sie musste aus einer Ära stammen, da Brisak noch wesentlich kleiner gewesen und jene breite Mauer, an der er nun entlangging, die äußerste gewesen war. Doch auch hier war geschäftiges Treiben im Gange, allerdings waren es vornehmlich kleinere Soldatengruppen, die an ihm vorbei nach oben marschierten oder ihm leichtfüßig entgegenkamen, immer mindestens zwei Stufen auf einmal überspringend.
»Ein Kupfer für einen alten Veteranen.«
Irgendetwas an der versoffenen Stimme erregte Kraehs Aufmerksamkeit. Er sah sich um und entdeckte eine kümmerliche Gestalt, die am Rand des Gässchens auf einer Stufe saß. Der linke Ärmel ihrer schmutzigen Tunika hing schlapp herab. Das Gesicht des Einarmigen war von einer tiefen Narbe verunstaltet, die sich von der linken Stirnseite bis zur rechten Wange zog. Die Verletzung hatte den Mann auch noch ein Auge gekostet, dessen leere Höhle wund und entzündet zu den jungen Burschen, die an ihm vorbeihasteten, hochblickte. Kraeh blieb kurz vor dem Alten stehen.
»Ein Kupfer«, bat der Bettler erneut.
»Tut mir leid, ich habe selbst kein …«
»Kraeh die Kriegskrähe!«, unterbrach ihn der am Boden Sitzende ungläubig.
Erschrocken sah Kraeh sich um; niemand hatte den Bettler beachtet. Er kniete sich zu ihm nieder und legte einen Zeigefinger auf die Lippen.
»Du bist es wirklich, nicht wahr?«, fragte die erbärmliche Person, diesmal leiser.
»Aye«, gestand Kraeh.
»Ich wusste es. Ich habe zwar nur noch ein Auge, aber das lässt sich nicht so leicht täuschen.«
Er probierte sich an einem Lächeln, da seine Lippen allerdings außer Übung waren, glich das Ergebnis doch eher einer jener Fratzen, welche man zur Wintersonnwende als Masken zur Schau stellte, um böse Geister zu vertreiben oder einfach Kinder zu erschrecken.
Er bekam ein wohlwollendes Nicken zur Bestätigung. »Fürwahr, ein gutes Auge ist dir geblieben.«
»Du hingegen hast aber nicht die geringste Ahnung wer ich bin, hm?«
»Um ehrlich zu sein, nein«, gab Kraeh zu.
»Kann’s dir nicht übel nehmen«, meinte der Bettler, gab aber einen Laut von sich, der entfernt an ein Knurren erinnerte. »War damals dabei, als wir die Wutach gestürmt haben«, fuhr er fort. Die Vergegenwärtigung jener längst vergangenen Tage schien den Bettler seine Enttäuschung vergessen zu lassen. »Und auch in Triberkh, damals«, er gackerte, »auf der anderen Seite, versteht sich. Dort hab ich mir auch diese schönen Andenken geholt.« Er deutete auf seinen Armstumpf und das fehlende Auge.
»Tja, wir haben euch seinerzeit ganz schön in den Arsch getreten«, konnte Kraeh sich nicht verkneifen zu antworten. Viele seiner Freunde waren an jenem Tage gefallen, als sie gegen Niedswar den Seher und dessen Horden in die Schlacht gezogen waren. Er musste sich ermahnen, die Tatsache im Gedächtnis zu behalten, nur einen einfachen Soldaten vor sich zu haben, der schlicht den Befehlen seiner Vorgesetzten gehorcht hatte und nichts von den größeren Zusammenhängen gewusst haben konnte. Auf die Gefahr hin, seinem Gegenüber das Einzige zu nehmen, was er noch hatte, fragte er: »Wollen wir die alten Zeiten nicht ruhen lassen und uns gemeinsam ein Ale genehmigen? Gibt’s das Goldene Horn noch?«
»Schon, aber nicht für alte, arme Hasen wie uns«, erwiderte der Veteran bitter, fügte aber hinzu: »Mein Neffe hat nen Laden unten bei den Netzflickern, bei dem hab ich einen gut.«
Kraeh nahm die Einladung gerne an, immerhin waren seine Taschen noch leerer als die des Mannes, dem er gerade auf die Beine half.
»Mein Name ist übrigens Thorbilt«, grunzte dieser, als er endlich stand.
»Sehr erfreut. Meinen kennst du ja.«
Unwillkürlich rannte Thorbilt ein Schauer den Rücken hinab. Ja, den kannte er nur zu gut.
* * *
Als sie in der kleinen, schmuddeligen Schenke saßen, die zu dieser frühen Tageszeit bis auf Thorbilts Neffen leer war, spürte Kraeh die Müdigkeit wie einen Geröllhaufen über sich zusammenbrechen. Vor ihm stand ein Krug abgestandenen Ales. Rotfar, der Neffe, ein stattlicher, für die Umgebung auffällig gut gekleideter Mann mittleren Alters, hatte ihnen gegenüber Platz genommen. Ehrfürchtig hatte Thorbilt Kraeh vorgestellt, zu schnell und zu entschlossen, als dass Kraeh die Möglichkeit gehabt hätte, es zu verhindern. Während er an seinem schalen Ale nippte, bat er den Wirt, seine Anwesenheit in der Stadt möge unter ihnen dreien bleiben. Am liebsten hätte er sich sofort auf einer der beiden Eckbänke des Raums, der von den Nachbarhäusern verdunkelt wurde, ausgebreitet und geschlafen. Er wollte aber nicht unhöflich erscheinen, außerdem bot sich ihm endlich die Gelegenheit zu erfahren, was in seiner Abwesenheit alles vorgefallen war. Bisher war er überaus vorsichtig gewesen, nicht einer falschen Person eine unbedachte Frage zu stellen, doch die beiden wussten ja ohnehin schon, wer er war.
Die Offensive der Sihhilas im Osten, erfuhr er, habe nach der Verwüstung einiger Grenzstädte geendet. Verhandlungen zwischen den beiden Großreichen seien wohl wieder aufgenommen, die größeren Städte dennoch in Alarmbereitschaft versetzt worden.
Auf seine Frage, ob er Königin Heikhe im Palas antreffen könnte, tauschten die beiden Verwandten einen sorgenvollen Blick.
Rotfar musterte Kraeh eine Weile, bevor er kopfschüttelnd verneinte. »Wo hast du denn gesteckt all die Jahre?« Der Ausdruck seines Gesichts hellte sich kurz auf. »Ist es so, wie die Legenden sagen; bist du aus dem Jenseits zurückgekehrt, um das Land von seinem Joch zu befreien?« Ein Zwinkern seines linken Auges machte deutlich, wie wenig er von dem Gerede der Leute hielt. Als Kraeh nichts sagte, verdunkelten sich seine Züge wieder.
»Heikhe wurde Verrat vorgeworfen, ebenso wie Erkentrud, deren Feste geschliffen wurde, ehe der Wiederaufbau abgeschlossen war. Das alles geschah vor mehr als drei Jahrzehnten. Der Kaiser begnadigte seine Schwester. Man sagt, seitdem sei sie seine Gefangene am Hofe in Dundulch, der Hauptstadt des Reiches, von dem wir mittlerweile Provinz sind.«
Es war also wahr! Kraeh kämpfte gegen seine Müdigkeit. Kaiser Gunther war der kleine Junge, den er einst am jenseitigen Ufer des Rheins an den Feind verloren hatte. Er, Rhoderik, Sedain, Heikhe und die schöne Lou hatten ihn für tot gehalten. Der Seher musste ihn fernab aufwachsen haben lassen, wobei er es irgendwie über seinen eigenen Tod hinaus geschafft hatte, Gunther seinen Größenwahn einzuimpfen. Es wunderte Kraeh wenig, dass der Bauer, der ihn hatte ausrauben wollen, von den Geschehnissen an den hohen Höfen nichts mitbekommen hatte und daher glaubte, immer noch von Heikhe regiert zu werden. Vielleicht hielt man das einfache Landvolk aber auch bewusst in einem falschen Glauben. Kraeh wollte gerade eine diesbezügliche Frage stellen, als Rotfar fortfuhr: »Im Palas wirst du niemand Geringeren vorfinden als Eli den Düsteren. Nach der Auflösung des Senates letzten Herbst, hat der Kaiser ihn eingesetzt, damit er die südlichen Gebiete verwaltet.«