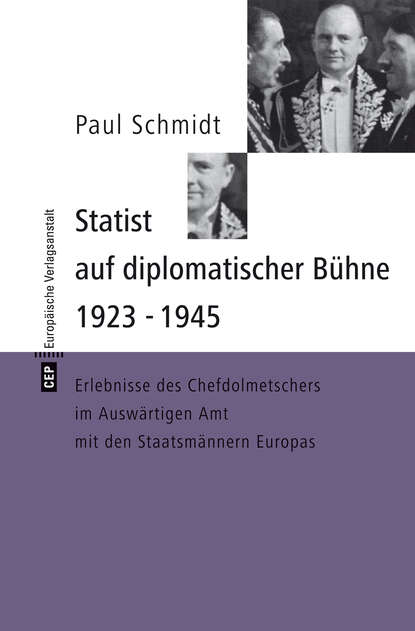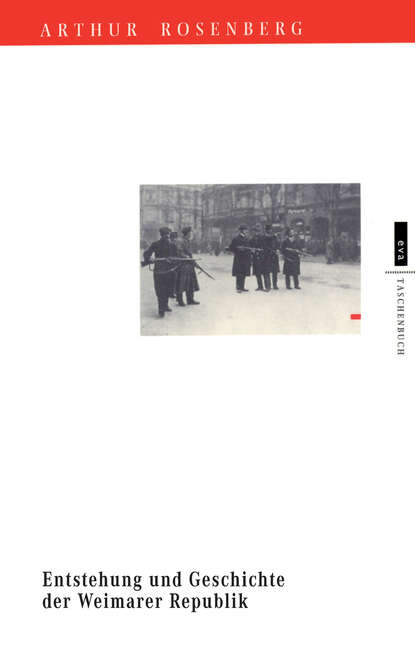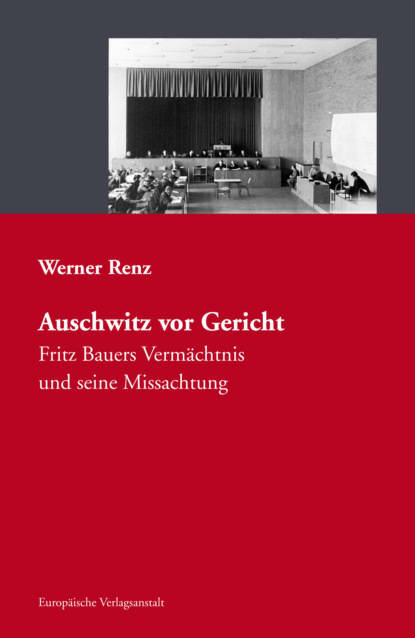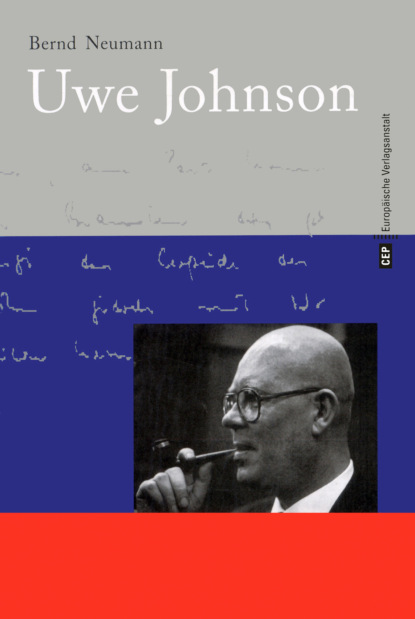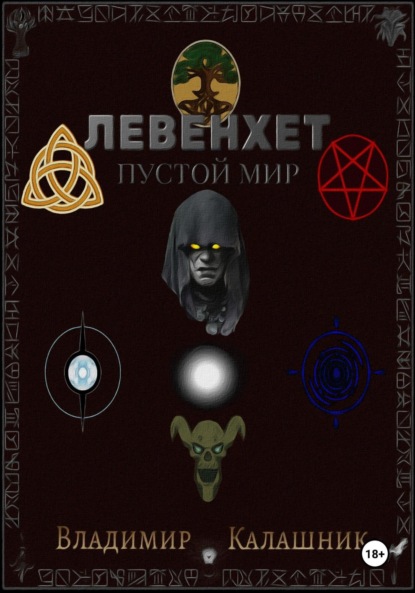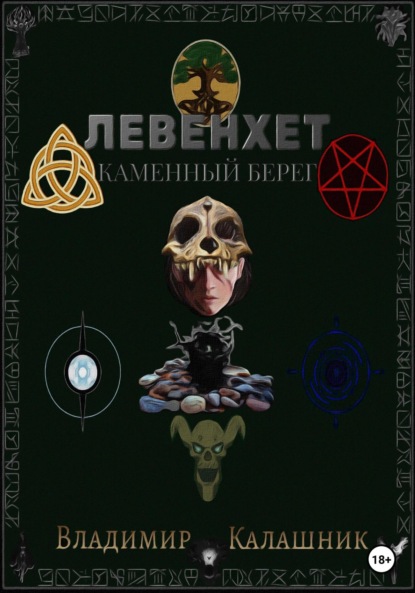Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945
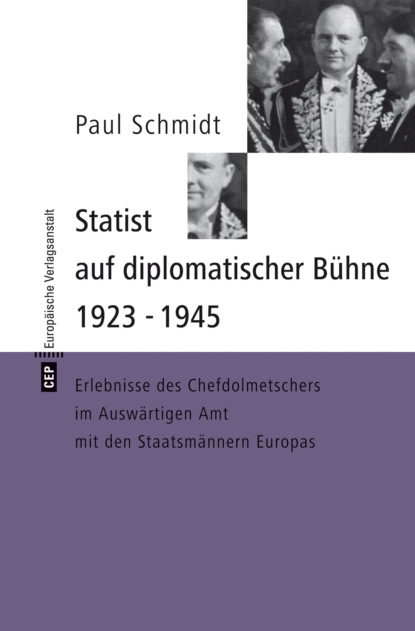
- -
- 100%
- +
Allmählich verließ Briand seinen Konversationston, er erwärmte sich, seine Stimme nahm immer mehr jenen volltönenden, dunklen Klang an, der seine Zuhörer oft veranlaßte, sie mit einem Cello zu vergleichen.
„Was bedeutet nun dieser heutige Tag für Deutschland und für Frankreich? Das will ich Ihnen sagen: Es ist jetzt Schluß mit jener langen Reihe schmerzlicher und blutiger Auseinandersetzungen, die die Seiten unserer Geschichte beflecken, es ist Schluß mit dem Krieg zwischen uns, Schluß mit den langen Trauerschleiern. Keine Kriege, keine brutalen Gewaltlösungen soll es von jetzt ab mehr geben. Ich weiß, daß Meinungsverschiedenheiten zwischen unseren Ländern auch heute noch bestehen, aber in Zukunft werden wir sie genau so wie die Einzelpersonen vor dem Richterstuhl in Ordnung bringen. Deshalb sage ich: fort mit den Gewehren, den Maschinengewehren, den Kanonen! Freie Bahn für die Versöhnung, die Schiedsgerichtsbarkeit und den Frieden!“
Mit erhobener Stimme hatte der alte Mann auf der Tribüne diese Worte fast in beschwörendem Tone ausgerufen. Donnernder Beifall antwortete ihm. Minutenlang konnte er nicht weitersprechen. Ruhig und zufrieden gingen seine Augen über die aufgewühlte Versammlung.
Dann blickte er zu Stresemann hin und hob etwas die Hand, um sich Ruhe zu verschaffen. In die lautlose Stille, die darauf eintrat, fielen die nun folgenden Worte wie die Schläge einer tiefen Glocke. „Ihnen aber, meine Herren Vertreter Deutschlands, möchte ich nur noch eines sagen: was Heldentum und Kraft anbetrifft, brauchen sich unsere Völker keine Beweise mehr zu liefern. Auf den Schlachtfeldern der Geschichte haben beide eine reiche und ruhmvolle Ernte gehalten. Sie können sich von jetzt ab um andere Erfolge auf anderen Gebieten bemühen.“ Jetzt war kein Halten mehr. Viele der Delegierten erhoben sich von ihren Sitzen, schrien ihre Begeisterung in irgendeiner Sprache hinaus und brachten dem „Mann mit dem Cello“ eine lang andauernde, überwältigende Ovation dar.
Er sprach dann noch eine ganze Weile weiter, mit tiefem Gefühl, mit Humor und mit Sarkasmus. „Schwierigkeiten gibt es noch reichlich; Herr Stresemann und ich stehen jeder in seinem Land an einem Posten, der uns allzu sehr damit in Berührung bringt. Und diese Schwierigkeiten sind nicht etwa verschwunden, weil er aus der Wilhelmstraße und ich vom Quai d’Orsay in dieses schöne Genf gekommen sind.“
„Wenn Sie aber nicht nur als Deutscher und ich nicht nur als Franzose hierher kommen, sondern wenn wir beide uns daneben auch als Bürger einer höheren, völkerverbindenden Gemeinschaft fühlen, dann werden wir in dieser Atmosphäre des Völkerbundes alle Schwierigkeiten überwinden.“
Als Briand geendet hatte, wollte der Beifall nicht aufhören. Ein kanadischer Delegierter durchbrach alle in Genf sonst üblichen Schranken der Formalität, stieg auf seinen Stuhl und brachte mit wehendem Taschentuch drei Hurras auf den französischen Ministerpräsidenten aus, die von der sonst so ernsten und gesetzten Versammlung mit der Begeisterung einer Schulklasse aufgenommen wurden.
Damit war die erste Sitzung, die wir imVölkerbund erlebten, zu Ende. Sie war für uns alle ein großes Erlebnis, für mich eines der größten während meiner ganzen Laufbahn. Nach den Szenen dieses Vormittags konnte kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß Deutschland nach den Jahren des Krieges und der Unruhe der Nachkriegszeit jetzt endgültig wieder den Anschluß an die internationale Welt gefunden hatte und als ein vollgültiges Mitglied in den Kreis der Nationen aufgenommen worden war. Daran änderte auch die Tatsache nichts, daß wir in vielen Punkten noch durch die Folgen des Krieges behindert blieben, daß die deutsche Rechtsopposition in ihrer Kleinmütigkeit und aus parteitaktischen Erwägungen heraus das Ergebnis der Politik Stresemanns zu verkleinern suchte, und daß eine der bayerischen Regierung nahestehende Zeitung die Aufnahme des Reiches in den Völkerbund in fetten Lettern als „Demütigung Deutschlands“ bezeichnete.
Nach den Ereignissen des 10. September war Deutschland in Genf Trumpf. Die deutsche Delegation stand im Mittelpunkt des Interesses. Stresemann wurde innerhalb und außerhalb des Völkerbundes zum Helden des Tages. Seine Popularität zeigte sich unter anderem auch darin, daß er im Volke vielfach nur mit seinem Vornamen genannt wurde. „J’ai vu Gustave“, konnte man immer wieder von groß und klein in den Genfer Kinos, in der Straßenbahn oder auf den Promenaden sagen hören. Es war für ihn ein Triumph auf diesem sonst so kühlen internationalen Pflaster, wie er wohl selten dort jemand beschieden worden ist.
Die nächsten Tage vergingen wie im Fluge. Die Sitzungen jagten einander, im Plenum, in den Kommissionen und auch im Völkerbundsrat. Diese höchste internationale Instanz tagte damals in einer großen Glasveranda, die zum Hotel National gehörte, in dem das Völkerbundssekretariat seinen Sitz hatte. Etwas erhöht stand hier am einen Ende des länglichen Raumes der hufeisenförmige Ratstisch, an dem Stresemann einige Tage später zum ersten Male Platz nahm.
Im Innenraum des Hufeisens saßen die beiden amtlichen Dolmetscher des Völkerbundes, ein Engländer und ein Franzose, sowie die Stenographen. Die Verhandlungssprachen waren auch hier, wie in der Vollversammlung, Englisch und Französisch. Alles, was auf Französisch gesagt wurde, übersetzte der Engländer sofort ins Englische und umgekehrt. Das Übersetzungssystem war genau das gleiche, wie ich es zuerst im Haag kennengelernt hatte. Jeder Redner sprach so, als fände die Verhandlung nur in einer Sprache statt, ohne Unterbrechung, während der betreffende Dolmetscher sich möglichst genaue Notizen machte und dann die Rede in der Ichform, d. h. so, als spräche der Delegierte wörtlich noch einmal, die Ausführungen in die andere Sprache übertrug. Dieses System ermöglicht zweisprachigen Konferenzteilnehmern sofort eine Kontrolle des Dolmetschers. Gelegentlich kam es vor, daß einer der Delegierten, z. B. wie schon erwähnt, Chamberlain, den Dolmetscher unterbrach, wenn er seiner Ansicht nach diese oder jene Stelle nicht ganz richtig wiedergegeben hatte. Allerdings erfolgten solche Unterbrechungen verhältnismäßig selten, denn die Völkerbundsdolmetscher waren hervorragende Meister ihres Faches. Außerdem hatte der Völkerbund das gleiche System, für das auch Geheimrat Gautier bei schriftlichen Übersetzungen eintrat. Die Dolmetscher übersetzten immer nur in ihre Muttersprache. Insofern war für mich die Aufgabe schwieriger, da ich ja immer nur in eine fremde Sprache übersetzen mußte, denn es war natürlich nicht angängig; zur Übersetzung der oft hochpolitischen Ausführungen des deutschen Außenministers einen Ausländer zu verwenden.
Meine Lage war auch in anderer Hinsicht unbequemer als die der Völkerbundsdolmetscher. Ich konnte schon aus formellen Gründen nicht unter ihnen im Innenraum Platz nehmen, da ja Deutsch keine amtliche Verhandlungssprache war, sondern mußte mich auf ein kleines, sehr unbequemes Stühlchen hinter den jeweiligen deutschen Ratsdelegierten setzen. Mein Schreibpult mußte ich mir in Gestalt eines Aktenköfferchens, das ich auf die Knie legte, selbst mitbringen. Dazu kam, daß ich als kleines Anhängsel der Ratstafel mit meinem Stuhl in den schmalen Gang hineinragte, der hinter den Sitzen der Ratsmitglieder und unmittelbar vor den Stühlen der Sekretäre und Sachverständigen ausgespart war, so daß jeder Vorbeikommende über mich stolperte und ich für die Sekretariatsmitglieder, die dort oben zu tun hatten, immer ein Stein des Anstoßes war. Meine Arbeitsbedingungen waren daher noch ungünstiger als in Locarno.
Zudem herrschte bei den deutschen Ratsdelegierten vielfach immer noch die Theorie des „Sprachautomaten“. Sie machte sich während der Ratsverhandlungen für mich in besonders unangenehmer Weise bemerkbar, denn diese hatten niemals durchgehend ein und dasselbe Thema zum Gegenstand wie eine Konferenz, die zur Lösung eines ganz bestimmten Problems einberufen wird. Der Völkerbundsrat verhandelte an einem Vormittag oft die allerverschiedensten Dinge, vom Kampf gegen das Opium, von Mandatsfragen und Wirtschaftsproblemen bis zum Minderheitenschutz und zum Mädchenhandel. Der Delegierte am Ratstisch, d. h. meistens der Außenminister, wurde vor und während der Sitzung von den Sachreferenten genau informiert, während sie für mich im Drang der Geschäfte keine Zeit fanden und nur hinterher empört waren und behaupteten, ich hätte ihnen mit meiner unzureichenden Übersetzung in diesem oder jenem Punkt ihre Politik für ein ganzes Jahr durcheinandergebracht. Erst später setzte sich die Erkenntnis durch, daß genaue Sachkenntnis beim Dolmetscher eine unerläßliche Vorbedingung ist. Von da ab hatte ich es leichter und konnte reibungslos meine Aufgabe erledigen. Denn auch hier galt ja, wie im Haag, nur der französische oder der englische Text der deutschen Erklärungen, so daß ein witziger Pressechef der Reichsregierung den Nagel auf den Kopf traf, wenn er mich mit den Worten kritisierte: „Heute hat aber der Reichsminister wieder eine recht ungenaue deutsche Übersetzung Ihrer französischen Rede verlesen.“
Unter diesen Umständen waren die ersten Jahre im Völkerbund, vor allem die Ratssitzungen, für mich eine rechte Nervenanspannung. Auf meinem kleinen Stühlchen hockend, den Kopf tief über meine improvisierte Schreibunterlage gebeugt, machte ich fieberhaft Notizen, wenn der deutsche Delegierte, wie mir schien, hoch über mir und von mir weg in den Raum hineinsprach, und mußte mich sehr zusammennehmen, mich nicht durch Nebengeräusche oder durch die sich an mir vorbeiwindenden Sekretäre ablenken zu lassen. Wenn ich dann aufstand, sah ich die gespannten Gesichter der Ratsmitglieder zu mir gewandt; Chamberlain schien in meiner Einbildung immer ein besonders kritisches Gesicht zu machen. Vor der Ratstafel saß etwas tiefer die Weltpresse an langen Tischreihen wie das Publikum in einem Theater vor der Bühne und paßte, wie mir schien, ebenso kritisch auf meine Übersetzung auf wie Chamberlain. Weiter hinten das Publikum mit Lorgnons und Operngläsern, die in der ersten Zeit auch nicht gerade beruhigend auf mich wirkten. Hinter mir glaubte ich die deutschen Sachverständigen manchmal leise Kritik an meiner Übersetzung üben zu hören. Gelegentlich rief mir auch dieser oder jener im allerletzten Augenblick noch schnell etwas zu – hätte er es doch vor der Sitzung getan und mich so gründlich über sein Spezialproblem informiert wie den Außenminister!
Bei diesen Ratssitzungen bewunderte ich übrigens immer von neuem Stresemanns phantastisch schnelle Auffassungsgabe. In kritischen Situationen während der Debatte genügten oft ein paar Worte, die ihm ein deutscher Sachverständiger schnell von hinten zuflüsterte – wobei ich den Hals reckte und die Ohren mächtig spitzte –, um ihn zu langen Ausführungen über einen ihm vorher völlig unbekannten Gegenstand, meist in sehr plastischen und treffenden Formulierungen, instand zu setzen.
So waren denn diese Ratstagungen, die in den ersten Jahren in vierteljährlichem Abstand stattfanden, für mich jedesmal ein richtiggehendes Staatsexamen, und ich war heilfroh, wenn ich am Ende der acht Tage, die diese Sitzungen meistens dauerten, wieder im Zuge saß, um mich an sprachlich weniger aufregende Verhandlungsorte zu begeben.
Die Herbsttagung des Völkerbundes im Jahre 1926 hatte neben den Szenen beim Einzug der deutschen Delegation noch einen zweiten Höhepunkt. Das war ein Ereignis, welches sich in völliger Stille hinter den verschlossenen Türen eines kleinen, unscheinbaren Restaurants in einem verschlafenen französischen Dorf jenseits der Schweizer Grenze abspielte: das Gespräch von Thoiry zwischen Briand und Stresemann, das damals eine Weltsensation war und nach London und Locarno eine weitere Etappe auf dem Wege der Annäherung zwischen den beiden Völkern und der friedlichen Regelung der zwischen ihnen bestehenden Probleme bildete. In noch stärkerem Maße als das Gespräch zwischen Herriot und Stresemann auf der Londoner Konferenz von 1924 war diese Zusammenkunft von einem Geheimnis umgeben, das eines Detektivromanes würdig gewesen wäre.
Der deutsche und der französische Außenminister mußten sich auch im Jahre 1926 vor einer unerwünschten Einmischung ihrer Rechtsopposition in ihre Friedensarbeit schützen. Wären ihre Bemühungen vorzeitig, d. h. im ersten Entwicklungsstadium des langsamen Sichherantastens an die Schwierigkeiten, Gegenstand der öffentlichen. Diskussion im Parlament und in der Presse geworden, so wären sie bei der Kompliziertheit der Fragen, um deren Regelung es sich handelte, mit großer Wahrscheinlichkeit zum Mißerfolg verurteilt gewesen. Daher war diese Geheimhaltung unbedingt notwendig.
So begann der Aufbruch der beiden Minister am Morgen des 17. September 1926 unter höchst geheimnisvollen Umständen. Den wachsamen Augen der Journalisten, welche die Hotelhallen des Métropole und des Hotel des Bergues fast ständig bewachten, konnte natürlich die Abfahrt von Stresemann und Briand nicht verborgen bleiben. Sofort schlossen sich ihnen mehrere Wagen mit Pressevertretern an, denn irgendwie war trotz äußerster Geheimhaltung der Presse doch bekanntgeworden, daß eine Zusammenkunft geplant war.
Plötzlich hielten die Ministerwagen etwas außerhalb von Genf am Seeufer, und Briand und Stresemann begaben sich auf ein Motorboot, um auf das jenseitige Ufer hinüberzufahren. Schon glaubten sie, ihre Verfolger von der Weltpresse auf diese Weise abgeschüttelt zu haben. Einige der Journalisten aber kehrten in rasendem Tempo wieder nach Genf zurück, brausten unter den Flüchen sämtlicher Verkehrspolizisten durch die Stadt hindurch und fuhren das jenseitige Ufer des Sees entlang, so daß sie gerade noch zurechtkamen – als die beiden Außenminister das Motorboot verließen und zwei an der Landungsstelle haltende Wagen bestiegen, die sich sofort in Richtung auf die französische Grenze in Bewegung setzten. Lachend fuhren die Journalisten hinterher. Sie glaubten, nun gewonnenes Spiel zu haben.
Aber auch dieser Fall war in dem Schlachtplan vorgesehen, den Briand und Stresemann einige Tage vorher in einer Ecke jenes dunklen und engen „Wandelganges“ des Hotels Victoria zwischen zwei Sitzungen entworfen hatten. Die französischen Zollstellen an der Grenze waren angewiesen worden, sämtliche ab 9 Uhr früh die Grenze passierenden Autos genauestens auf ihre Papiere zu prüfen. Dadurch würden die beiden Ministerwagen vor etwaigen Verfolgern einen Vorsprung erhalten, der nicht mehr einzuholen war.
Genau so wirkte sich diese Maßnahme an jenem Morgen auch aus. Die beiden Ministerwagen fuhren ungehindert über die Grenze, und die Journalisten mußten zu ihrem Ärger eine hochnotpeinliche und langwierige Zolluntersuchung über sich ergehen lassen, die wohl eine halbe Stunde lang dauerte.
Briand und Stresemann waren ihnen nun doch entkommen. Zwar fuhren ihre Verfolger nach Erledigung der Zollformalitäten noch eine Weile lang kreuz und quer durch die Gegend jenseits der Grenze. Sie telefonierten an verschiedene bekannte Hotels und Speiselokale bis nach Annecy und selbst nach Aixles-Bains, aber es war alles vergeblich. Die beiden Außenminister hatten von dem Grenzübergang aus einen Haken geschlagen, waren in das nicht allzu weit entfernt gelegene Dörfchen Thoiry in die Gastwirtschaft des Père Léger gefahren und unterhielten sich dort im Anschluß an ein ausgezeichnetes Frühstück über zwei Stunden lang. Als sie aber danach vor die Tür des Hauses traten ... begrüßte sie ein mehrstimmiges Oh und Ah der Pressevertreter! Es waren zwar nur ganz wenige, denen der Treffpunkt bekanntgeworden war, aber das genügte, um die Nachricht noch am Abend des Tages in der ganzen Welt als große Sensation zu verbreiten.
Entdeckt wurde das Geheimnis durch einen eigenartigen Zufall. Die Weisung an die französischen Grenzstellen wegen der genauen Kontrolle des Grenzüberganges hatte sich nur auf Autos bezogen. Einer der Journalisten aber, ein Franzose, wenn ich mich recht erinnere, hatte die Verfolgung auf dem Motorrad unternommen und war daher fast so unbehelligt über die Grenze gelangt wie die beiden Minister selbst. Er hatte dann von Thoiry aus einigen Freunden den Tip gegeben, und auf diese Weise war die kleine Journalistengruppe vor dem Hause des Père Léger zustandegekommen.
Bei dem eigentlichen Gespräch von Thoiry war als Dolmetscher nur der Vertraute Briands, Professor Hesnard, anwesend. Von deutscher Seite hatte lediglich Legationssekretär Feine die Fahrt als Begleiter Stresemanns mitgemacht. Ich selbst war in Genf geblieben.
Hesnard erzählte mir aber noch am Abend des Tages ziemlich ausführlich, wie die Unterhaltung verlaufen war, denn er betrachtete mich schon damals durchaus als ein Mitglied der „engeren Familie“, das über kurz oder lang doch mit diesen vertraulichen Besprechungen oder ihrer Fortsetzung befaßt sein würde.
Die Lösungsmöglichkeiten, die von Briand und Stresemann ins Auge gefaßt wurden, beruhten im wesentlichen auf einer beschleunigten Beendigung der Besetzung deutschen Gebietes als Gegenleistung für deutsche Wirtschafts- und Finanzhilfe bei der Sanierung der äußerst ernsten französischen Wirtschaftslage. Briand mochte sich wohl darüber klar sein, daß die besetzten Gebiete in Deutschland als Pfand von Jahr zu Jahr an Wert verlieren würden, und daß daher zu jenem Zeitpunkt ein höherer Preis für ihre Aufgabe zu erzielen sei als später. So wurde denn von der Möglichkeit einer Stützung des französischen Franken durch Flüssigmachung eines Teils der deutschen Eisenbahnobligationen gesprochen. Es wurden auch deutsche Konzessionen im Rahmen der Pariser Handelsvertragsverhandlungen erwogen. Hesnard ließ durchblicken, daß bei diesen finanziellen Erörterungen beide Gesprächspartner, die ja auf diesem Gebiet keine Sachverständigen waren, in recht vagen Begriffen gesprochen hätten. Auch sei nicht klar geworden, ob die zusätzliche finanzielle Last für Deutschland wirklich tragbar sei.
Stresemann hatte aber nicht nur die Räumung des Rheinlandes in die Debatte geworfen, sondern auch von der Rückkehr der Saar zum Reich gesprochen. Er hatte ein paar hundert Millionen Goldmark dafür angeboten. Eng zusammen damit hing ein anderes Geschäft mit Belgien, das ebenfalls wegen seiner schwierigen Finanzlage vielleicht bereit gewesen wäre, Eupen-Malmedy gegen eine Regelung des Problems der im Kriege in Belgien in Umlauf gesetzten Markbeträge zurückzugeben. Darüber hatten schon vorher, zum Teil unter Einschaltung des Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht, Verhandlungen stattgefunden, die allerdings von Frankreich mit sehr scheelen Augen angesehen worden waren.
Briand seinerseits brachte neben den finanziellen und wirtschaftlichen Fragen vor allen Dingen Abrüstungsangelegenheiten zur Sprache. Frankreich sei durch die von Zeit zu Zeit immer wieder festgestellten Mängel in der deutschen Abrüstung, vor allem aber durch die halbmilitärischen Verbände, wie den Stahlhelm und andere, sehr beunruhigt, denn durch diese Organisierung seiner wehrfähigen Jugend erhalte sich Deutschland eine große Reservearmee.
Weiter, als Lösungsmöglichkeiten in großen Umrissen anzudeuten, sind Briand und Stresemann wohl damals in Thoiry nicht gegangen. Aber allein die Tatsache, daß überhaupt ein derartiger Ausgleich als etwas praktisch Realisierbares in Erwägung gezogen werden konnte, war schon ein außerordentlich großer Schritt vorwärts. Die Freude und Genugtuung darüber hat wohl beide Gesprächspartner an jenem Nachmittag die Schwierigkeiten aus den Augen verlieren lassen, die sich der praktischen Durchführung ihrer Pläne damals noch entgegenstellten. Daß sie aber durchaus auf dem richtigen Wege waren, ergibt sich daraus, daß 1929 auf der Haager Konferenz eine Lösung im Ausgleich zwischen Reparationen und Rheinlandräumung tatsächlich gefunden wurde, die im großen gesehen den Gedankengängen von Thoiry entsprach.
Voller Begeisterung über die Perspektiven, die sich vor ihm eröffnet hatten, kehrte Stresemann am Spätnachmittag von seinem geheimnisvollen Ausflug wieder nach Genf zurück. „Die Räumung des Rheinlandes ist nur noch eine Frage von Monaten“, rief er einige Tage später in einer Pressekonferenz den deutschen Journalisten zu. Er hatte auf verschiedene Angriffe der Rechtspresse geantwortet und sich dabei in eine Art Kampfstimmung gegen die deutschnationale Opposition hinreißen lassen. Sie wurde ihm in den nächsten Jahren noch oft vorgehalten, denn es zeigte sich, daß die materiellen und politischen Schwierigkeiten, die den in Thoiry in Aussicht genommenen Lösungen entgegenstanden, doch größer waren, als die beiden „unverbesserlichen Optimisten“, wie sich Briand einmal in einer Rede bezeichnete, vorausgesehen hatten. Insbesondere hatten sie wohl die harten Realitäten der finanziellen und wirtschaftlichen Vorbedingungen ihres Planes damals noch nicht klar genug erkannt. Es dauerte noch mehrere Jahre, bis die Dinge zur Lösung reif waren.
Am Tage nach Thoiry kehrte Briand nach Paris zurück. Die großen Tage in Genf waren nun vorüber, und die deutsche Delegation bekam einen Vorgeschmack von der Monotonie der routinemäßigen Völkerbundsarbeit.
Stresemann verließ mit einem großen Teil der „Prominenten“ der Delegation am 22. September nachmittags um 5 Uhr Genf unmittelbar im Anschluß an einen Empfang der ausländischen Presse. „Voller Hoffnung kehre ich nach Deutschland zurück“, waren die letzten Worte, die ich dabei zu übersetzen hatte.
7
DIE WIRTSCHAFT HAT DAS WORT (1927)
Viele Worte über die Wirtschaft und von der Wirtschaft hatte ich im Jahre 1927 zu übersetzen. Wirtschaftsfragen standen fast die ganze Zeit für mich im Vordergrund. Aber nicht nur für mich, denn auch die Welt schien in diesem Jahre in ihren politischen Bemühungen etwas einzuhalten und ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich der Wirtschaft zuzuwenden.
Fast routinemäßig nahm ich, nun schon im dritten Jahre, im Januar meine Tätigkeit bei den deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen in Paris wieder auf, arbeitete im Mai auf der ersten großen Weltwirtschaftskonferenz des Völkerbundes in Genf, wurde anschließend daran zum Kongreß der Internationalen Handelskammer nach Stockholm geschickt, nahm unmittelbar darauf an den Besprechungen zwischen dem Reichsverband der deutschen Industrie und seinem englischen Gegenstück, der Federation of British Industries, in Berlin teil und kehrte dann wieder zu meinem Ausgangspunkt Paris zurück, wo im August schließlich das große dreijährige Werk, der deutsch-französische Handelsvertrag, abgeschlossen werden konnte.
So sah ich knapp dreiviertel Jahre nach den eindrucksvollen Szenen, die sich beim Eintritt Deutschlands in den Völkerbund abgespielt hatten, am 4. Mai 1927 den Reformationssaal in Genf wieder, in dem im September vorher die Vollversammlung getagt hatte. Auch jetzt wieder war hier in dem überfüllten Saal eine Art Vollversammlung zusammengetreten, aber auf Stresemanns Platz saß der Träger eines anderen weltberühmten Namens als erster Delegierter Deutschlands: Carl Friedrich von Siemens, der Seniorchef der bekannten deutschen Firma. An Stelle des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt nahm den zweiten Platz Staatssekretär Trendelenburg vom Reichswirtschaftsministerium ein. Prälat Kaas war durch den Fraktionskollegen Clemens Lammers vom Reichsverband der deutschen Industrie (übrigens nicht identisch mit dem späteren Reichsminister) ersetzt worden, die Interessen der Landwirtschaft nahm der ehemalige Reichsminister Dr. Hermes wahr, und der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund wurde durch sein Vorstandsmitglied Eggert vertreten.
Einen ähnlichen Querschnitt durch das Wirtschaftsleben ihrer Länder stellten die anderen Delegationen dar. An Stelle der großen Namen der europäischen Politik, wie Briand und Chamberlain, traten die Koryphäen der Wirtschaftswissenschaft, der berühmte Schwede Gustav Cassel oder der Herausgeber der weitverbreiteten englischen Wirtschaftszeitschrift „Economist”, Sir Walter Layton, bekannte Industrielle, wie Loucheur aus Frankreich oder Pirelli aus Italien, und der Allgewaltige – auch dem Umfang nach – der Gewerkschaftsbewegung, Léon Jouhaux, dessen donnernde Volksreden immer etwas an Büchners „Danton“ erinnerten.
Wenn man genauer hinsah, so entdeckte man zwischen dieser Vollversammlung der Weltwirtschaftskonferenz und den Tagungen des Völkerbundes im gleichen Saal noch weitere Unterschiede. Sie hätten zur damaligen Zeit auf politischem Gebiet eine Sensation ersten Ranges dargestellt, und selbst in dieser nüchternen Wirtschaftsatmosphäre erregten sie erhebliches Aufsehen. Das war erstens ein unscheinbares Schild auf einem der Tische mit der Aufschrift „Sowjetunion“. Die Bank war zur Eröffnungssitzung zwar noch leer, da die Russen sich verspätet hatten, aber sie war danach immer voll besetzt von Delegierten, die einen sehr lebhaften und äußerst kritischen Anteil an den Debatten nahmen. Eine weitere Sensation wäre in einer politischen Versammlung des Völkerbundes ein anderes kleines Schild gewesen, auf dem „Vereinigte Staaten“ zu lesen stand. Das erregte unter den Wirtschaftlern allerdings kaum Aufsehen, denn auch ohne daß Amerika Mitglied des Völkerbundes war, hatten sich längst die engsten Beziehungen von Europa zu den Vereinigten Staaten und von diesen zur ganzen Welt angesponnen, so daß eine amerikanische Delegation den hier versammelten Prominenten aus Industrie, Handel und Landwirtschaft der Welt etwas Selbstverständliches war.