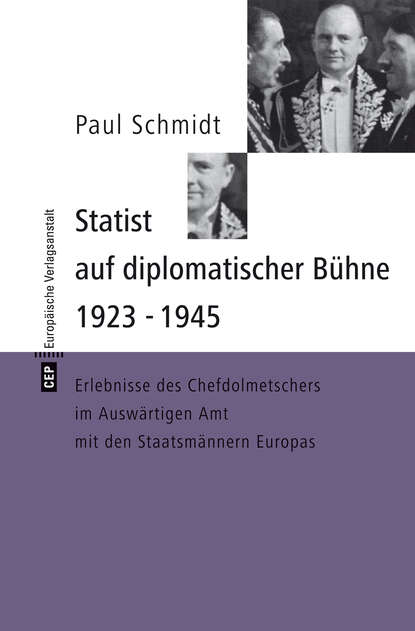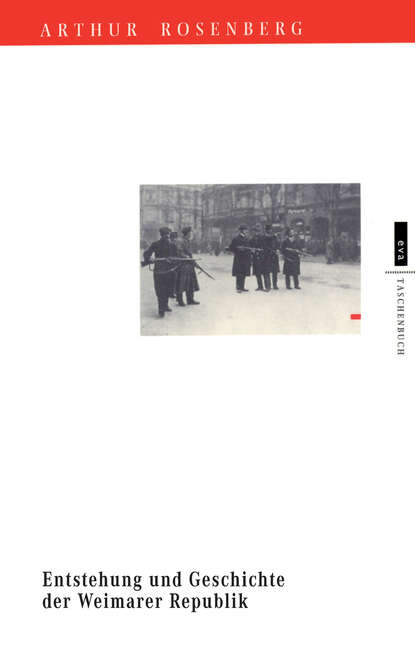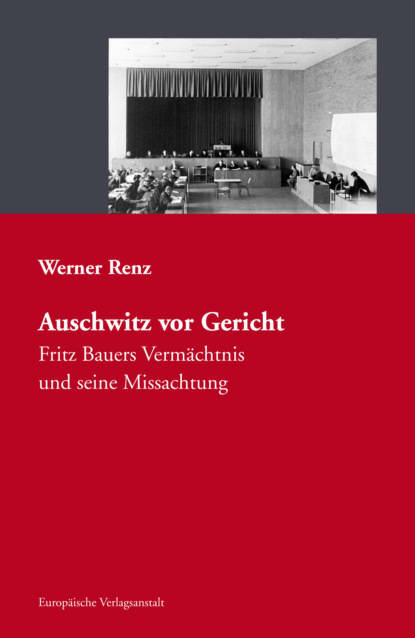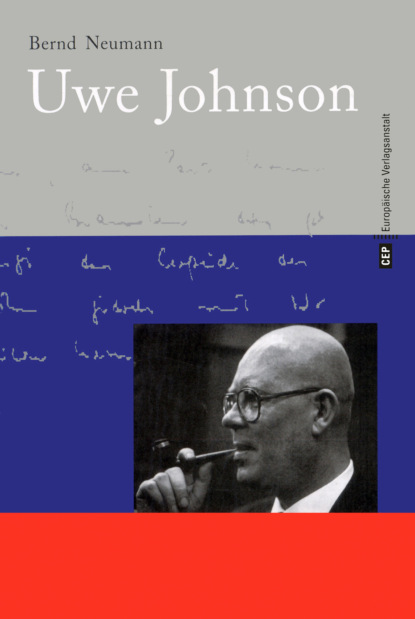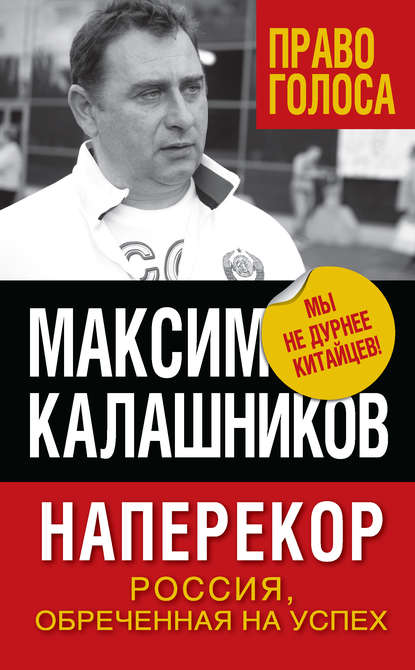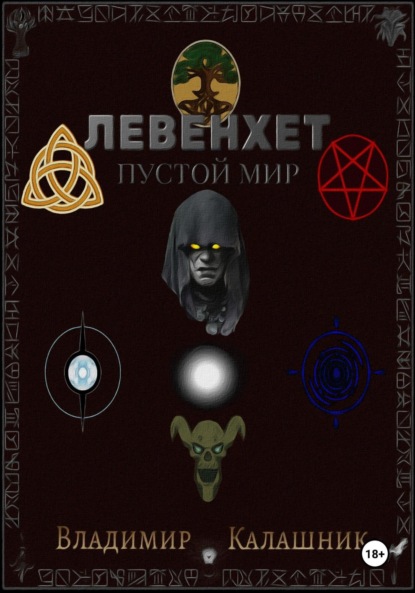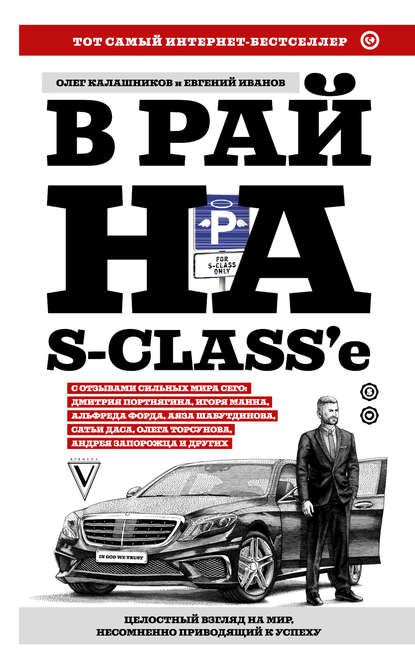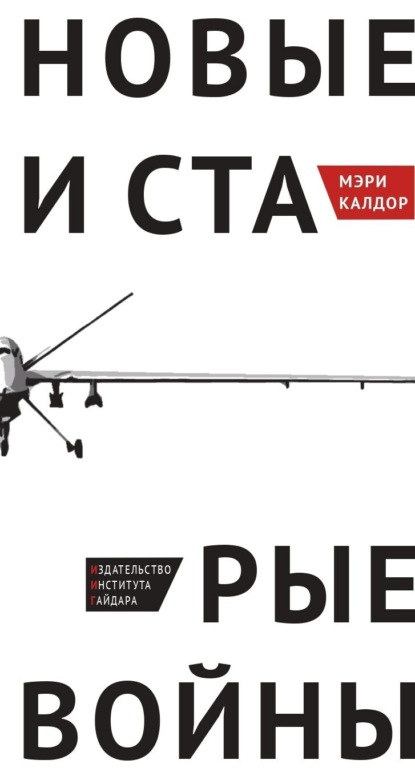Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945
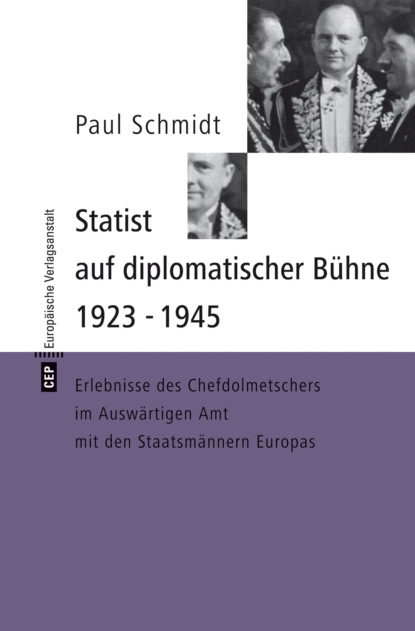
- -
- 100%
- +
Die Geschichte war natürlich nach wenigen Stunden in aller Munde. Besonders die Journalisten bemächtigten sich dieses Zwischenfalles, der ja vielleicht besser als viele Worte die Schwierigkeiten beleuchtete, die auf der Konferenz zu überwinden waren. In Berlin erschienen sogar einige Zeitungen mit dicken Überschriften von dem „versagenden deutschen Dolmetscher“, und da der Name diskreterweise nicht genannt wurde, erhielt ich einige Tage später aus Deutschland einige besorgte Anfragen von Freunden, die schon gefürchtet hatten, daß ich bei der ersten Gelegenheit Schiffbruch erlitten hätte. Übrigens hatte auch der englische Dolmetscher, der MacDonalds Rede ins Deutsche übersetzte, bei unserer Delegation einiges Aufsehen erregt. Seine Übersetzung war zwar inhaltlich völlig einwandfrei, aber er war, wie viele Engländer, eine Zeitlang in Dresden in Pension gewesen und sprach daher manchmal reinstes Sächsisch. Schwierige Reparationsfragen in London auf Sächsisch auseinandergesetzt zu bekommen, wirkte aber auf die deutschen Delegierten selbst in den schwierigsten Situationen doch etwas erheiternd. Ein Lächeln huschte dann wohl gelegentlich über die sonst so ernsten Gesichter von Marx und Stresemann. Das hätte unter Umständen bei den übrigen Delegationen zu völlig falschen Rückschlüssen über die Aufnahme gewisser Vorschläge auf deutscher Seite führen können, wenn nicht aus den Antworten sofort der wahre Sachverhalt klargeworden wäre.
Inzwischen aber bereitete ich mich auf den großen Augenblick vor. Nach einem guten Abendessen und einem noch besseren Tropfen fuhr ich mit Marx und Stresemann am Abend dieses für mein Leben so wichtigen Tages zu der um 9 Uhr im englischen Auswärtigen Amt beginnenden Sitzung. Unversehens fand ich mich mit den Großen Europas an einem Tisch. Ich hatte meinen Platz links neben Stresemann, genau dem Premierminister MacDonald gegenüber, der mich manchmal, wenn er sich bequem auf seinem Präsidentenstuhl zurechtrückte und dabei die Beine weit von sich streckte, unter dem Tisch anstieß. Rechts von MacDonald saß der französische Ministerpräsident Herriot, auch heute noch als Präsident der französischen Kammer eine einflußreiche Persönlichkeit, ein großer, vierschrötiger Mann, mit einem fast eckig anmutenden Kopf, aus dem ein Paar gutmütige, forschende Augen gelegentlich einen mißtrauischen Blick auf meinen Nachbarn Stresemann fallen ließen; zur Linken MacDonalds saß der englische Schatzkanzler Philip Snowden. Er war vielleicht die markanteste Gestalt der ganzen Konferenz. Aus seinem hageren Gesicht blitzten ein Paar strenge, ja unerbittliche blaue Augen. Mit seiner Kritik machte er vor niemandem und nichts halt. Er war der Mann der unverblümten Wahrheiten. Von der Politik hielt er anscheinend nichts und von der Diplomatie noch weniger. Mit eiskalter Schärfe, ja vielfach mit einer in dieser Umgebung außergewöhnlichen Grobheit vertrat er seinen Standpunkt. Und meistens stand er dabei auf seiten der Deutschen gegen die Franzosen. Ich sollte Snowdens Art in den nächsten Tagen während der Konferenz und später auch bei anderen Gelegenheiten, wie der zweiten Reparationskonferenz 1929/30 im Haag, noch sehr genau kennenlernen. Rechts neben Herriot sah ich den belgischen Ministerpräsidenten Theunis.
Im Hintergrunde saßen die Berater der Alliierten; sie reichten ihren Ministern oft Zettel mit kurzen Bemerkungen oder Schriftstücke während der Beratungen zu, und man konnte daraus für den Gang der Verhandlungen manches entnehmen, wenn man wußte, wer die Herren in der zweiten Reihe waren und welches Gebiet sie als Sachverständige vertraten. Auch die deutsche Seite hatte ihre Sachberater mitgebracht, die ich hinter mir mit ihren Papieren rascheln und halblaute Bemerkungen austauschen hörte.
Von diesem unerwarteten Zusammentreffen mit den europäischen Staatsmännern war ich nicht so beeindruckt, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Ich war beinahe überrascht, wie selbstverständlich mir nach einigen Minuten meine Umgebung erschien.
Das lag nicht zuletzt an der wenig formellen Atmosphäre, die diese Beratungen kennzeichnete. Ich hatte mir früher immer Verhandlungen zwischen Ministerpräsidenten und Außenministern als eine sehr steife Angelegenheit vorgestellt. Hier aber sprachen die Vertreter der einzelnen Nationen so ruhig und im Gesprächston miteinander, als handele es sich nicht um eine hochpolitische internationale Konferenz, sondern vielmehr um eine Clubversammlung. Wenn man von der Sprache absah, hätte man keinen Unterschied zwischen den deutschen und den anderen Mitgliedern dieses „Clubs“ feststellen können. Das traf jedoch nur auf die äußere Form zu. Inhaltlich merkte man sehr bald, daß das Land, welches Marx und Stresemann vertraten, in dem nur wenige Jahre zurückliegenden Kriege besiegt worden war, und daß die anderen als Fordernde am Tisch saßen.
Ich kam infolge der plötzlichen Ablösung von Michaelis mitten in eine Debatte hinein, die bereits vorher begonnen hatte. Es handelte sich bezeichnenderweise um die Frage der Sanktionen. Das war ein äußerst wichtiger Punkt, denn mit der Begründung, Sanktionen wegen Nichterfüllung von Reparationsverpflichtungen verhängen zu müssen, war ja Poincaré in das Ruhrgebiet einmarschiert. Nun sollte beraten werden, in welcher Weise Sanktionen bei einer Verletzung des Dawes-Planes durchgeführt werden könnten. Ruhig und sachlich hatte Marx die deutschen Einwendungen gegen das erneut auf Grund des Versailler Vertrages in Aussicht genommene Sanktionsrecht vorgebracht. Snowden trat der deutschen Auffassung bei, aber Herriot machte sofort Vorbehalte. Während der Ausführungen von Marx hatte er sich wiederholt an seinen Finanzminister Clémentel und an einen Beamten des Quai d’Orsay, den heutigen französischen Botschafter in London, Massigli, gewandt.
In dem der Konferenz vorliegenden Entwurf über die Sanktionsbestimmungen war vorgesehen, daß im Falle eines „flagrant default“, d. h. einer offensichtlichen Verfehlung Deutschlands, der Sanktionsfall eintreten sollte. Angesichts der Tatsache, daß Poincaré wegen sehr geringfügiger „Verfehlungen“ Deutschlands die Ruhraktion unternommen hatte, war es natürlich der deutschen Seite darum zu tun, von vornherein die Bestimmungen auszuschalten, wonach in Zukunft geringfügige Vorfälle zum Anlaß eines gewichtigen Vorgehens unter dem Vorwand von Sanktionen ergriffen würden.
Daher wurde stundenlang über die Auslegung dieses englischen Ausdruckes hin- und herdebattiert. Snowden ergriff wiederholt das Wort und stellte sich dabei auf den deutschen Standpunkt, indem er nachdrücklich zum Ausdruck brachte, daß im Englischen dieser Ausdruck unter allen Umständen den bestimmten Willen zum Begehen einer Verfehlung bedeute, daß daher eine böswillige Absicht vorliegen müsse. Das war genau der Standpunkt der deutschen Delegation. Wäre Anfang 1923 dem Sanktionsparagraphen eine solche Auslegung gegeben worden, so hätte die Ruhrbesetzung nicht stattfinden können.
An und für sich war diese ganze Diskussion natürlich im Rahmen der größeren Probleme, um die es sich in London handelte, verhältnismäßig belanglos. Mir zeigte sie jedoch, besonders nach dem Zwischenfall Michaelis, welche weittragenden Folgen einzelne Formulierungen im internationalen Verkehr oft haben können, und ich habe mich in der Folge bei meinen Übersetzungen immer an diese ersten Beispiele aus meiner Laufbahn erinnert.
Den ganzen Abend verbrachte die Konferenz mit der Diskussion dieser und ähnlicher Punkte. Eine Einigung wurde in keiner Hinsicht erzielt, und man vertagte sich auf den nächsten Vormittag.
Erleichtert erhob ich mich mit der deutschen Delegation. Meine Aufgabe bei der Übersetzung der Ausführungen von Marx und Stresemann war insofern erleichtert worden, als man mir nur die französische Fassung anvertraut hatte. Ins Englische übersetzte der spätere Generalkonsul Kiep, damals noch Legationssekretär, der nach dem 20.Juli 1944 von der Hitlerjustiz ermordet wurde.
Zum ersten Male sprach an jenem Abend auch Stresemann persönlich mit mir. Er war so freundlich, mir einige anerkennende Worte über meine Arbeit zu sagen, und bat mich, ihn von nun ab bei allen Verhandlungen zu unterstützen. Auch der Reichskanzler deutete an, er sei nach dem Ruhrzwischenfall mit Herriot vom Vormittag sehr erfreut gewesen, daß sich dank meiner ruhigeren Sprache trotz der umstrittenen Punkte und der delikaten Fragen, die auf der Sitzung behandelt worden seien, keine Schwierigkeiten mit Herriot mehr ergeben hätten.
Von nun an fuhr ich regelmäßig mit Marx und Stresemann vor- und nachmittags in die Konferenzsitzungen, die manchmal im britischen Auswärtigen Amt, manchmal auch in den Räumen des englischen Premierministers im Unterhaus stattfanden.
Heute erscheinen mir die damals in den offiziellen Sitzungen behandelten Fragen verhältnismäßig unwichtig gegenüber der politischen Entwicklung, die sich in Privatgesprächen anbahnte. Auch hier spielten sich die wichtigsten Vorgänge außerhalb der Verhandlungsräume ab.
Das Ereignis, das alles andere, was auf der Konferenz sonst noch geschah, an Wichtigkeit übertraf und dessen Rückwirkungen weit über die Lebensdauer des Dawes-Abkommens hinausreichten, war die erste persönliche Begegnung, die hier in London nach dem Weltkriege von 1914 zwischen dem deutschen und dem französischen Außenminister stattfand. Es war das erstemal seit über zehn Jahren, daß sich die außenpolitischen Vertreter dieser beiden Nachbarvölker unter vier Augen in einer fast zweistündigen persönlichen Aussprache gegenübersaßen.
Es war nicht ganz leicht gewesen, diese Begegnung zustande zu bringen. Im Anschluß an jene Abendsitzung, an der ich zum ersten Male als Dolmetscher für Stresemann auftrat, hatte Herriot noch persönlich darum gebeten, daß man keinen Versuch machen möge, eine Besprechung mit dem deutschen Reichskanzler oder dem Reichsaußenminister herbeizuführen. Aber bereits an einem der nächsten Tage hatte er durch einen Vertrauensmann seinen Wunsch übermitteln lassen, mit der deutschen Delegation in Fühlung zu kommen. Daraufhin waren zunächst formelle Höflichkeitsbesuche ausgetauscht worden, die nur von sehr kurzer Dauer waren und bei denen von allem anderen als von Politik gesprochen wurde. Ich hatte allerdings schon bei diesen kurzen Gelegenheiten den Eindruck, daß sich Herriot bemühte, Marx und Stresemann so freundlich wie möglich entgegenzukommen. Er hatte sogar versucht, mit ihnen etwas deutsch zu sprechen, und erschien beide Male aufgeräumt und zugänglich.
Einige Tage später kam durch Vermittlung MacDonalds ein wirkliches politisches Gespräch, zwar nicht mit Marx, der ja als Reichskanzler der eigentliche Gesprächspartner des französischen Ministerpräsidenten gewesen wäre, sondern mit dem Reichsaußenminister Stresemann zustande. Aber da die außenpolitischen Probleme dem Reichskanzler fern lagen, war die Kombination Stresemann-Herriot natürlich die bei weitem günstigere.
Bezeichnend für die Stimmung in Frankreich war es, daß diese Besprechung mit großer Sorgfalt vor der Öffentlichkeit geheimgehalten werden mußte. Es wurde uns gesagt, daß Herriot der öffentlichen Meinung seines Landes gegenüber eine persönliche Aussprache mit dem deutschen Außenminister nicht vertreten könne und daß ihm die Rechtsopposition in der Kammer und sogar innerhalb seines Kabinetts die größten Schwierigkeiten machen würde, wenn über das Zusammentreffen mit Stresemann auch nur das geringste verlaute. In Frankreich sei man natürlich argwöhnisch und werde aus dieser Begegnung den naheliegenden Schluß ziehen, daß in London eben doch nicht nur über die Reparationen verhandelt worden sei, sondern darüber hinaus die als tabu bezeichneten politischen Fragen, vor allen Dingen das Ruhrproblem, behandelt worden seien, entgegen den Zusicherungen, die Herriot vorher in Frankreich hatte abgeben müssen.
So wurde denn diese Unterredung mit einem Geheimnis umgeben, das eines Detektivromanes würdig gewesen wäre. Die Hallen der Delegationshotels waren natürlich Tag und Nacht von der Presse der ganzen Welt belagert. Nicht einen Schritt konnten die Staatsmänner tun, ohne daß es mindestens einem Journalisten sofort auffiel. Wenn einer der Außenminister mit einem der großen Autos, die die englische Regierung ihnen zur Verfügung gestellt hatte, irgendwohin fuhr, folgte ihm meist ein ganzes Rudel von Journalistenwagen; mit einem Geschick, das man sonst nur auf Sechstagerennen im Berliner Sportpalast anzutreffen pflegte, hängten sie sich an das „Hinterrad“ des betreffenden Ministerwagens und verloren es auch im dichten Gewühl der Londoner Straßen nicht mehr.
Um dieser „Verfolgung“ zu entgehen, verließen Stresemann und ich das Hotel zu Fuß durch einen Nebenausgang. Ich glaube, es war sogar die Lieferantentreppe. Wir schlenderten dann gemächlich Piccadilly entlang und blieben an einigen Schaufenstern stehen, um den Eindruck zu erwecken, daß wir nur einen Bummel durch die Straßen machen wollten, sollte uns doch einer der Journalisten aufgespürt haben und uns gefolgt sein. Es war alles genau so, wie es in den Detektivgeschichten beschrieben wird. Es spielten sogar richtige Detektive dabei mit. Das waren die beiden englischen „Inspectors“ von Scotland Yard, die für Stresemanns Sicherheit zu sorgen hatten; sie waren die einzigen, die über unser eigentliches Ziel Bescheid wußten. Sie folgten uns so „unauffällig“, wie das in ihren Dienstvorschriften vorgesehen ist, und wie sie es, besonders in England, durch lange Übung meisterhaft verstehen. Durch nichts unterschieden sich die beiden freundlichen englischen Gentlemen, die im eifrigen Gespräch miteinander scheinbar ihre Umgebung völlig vergessen hatten, von den übrigen Straßenpassanten, ganz im Gegensatz zu ihren kontinentalen Kollegen in Deutschland oder in Frankreich, denen man, damals jedenfalls, am Schlapphut und Regenmantel oder dem ungerollten Regenschirm, wenn nicht gar an einem wachtmeisterlichen Schnurrbart, den Beruf oft sofort ansah.
Im dichtesten Gewühl des Piccadilly Circus erwartete uns ein englischer Wagen, den wir mit einiger Hast bestiegen, und in dem sich nach einigen hundert Metern unsere beiden „Inspectors“ zu uns gesellten. Wir fuhren einmal die große Straße bis zum Buckingham Palace entlang und bogen dann in die Mall ein, wo wir vor dem großen Gebäude des Royal Automobile Club hielten.
Unsere beiden englischen Kriminalpolizisten gingen uns in das Gebäude voran, wechselten ein paar schnelle Worte mit dem uniformierten Portier und geleiteten uns dann zum Fahrstuhl, der sich sofort in Bewegung setzte, ohne auf noch andere gerade vom Eingang herkommende Fahrgäste zu warten. In einem Film hätte diese Szene auch nicht naturgetreuer dargestellt werden können.
In einem der oberen Stockwerke gelangten wir dann nach einigem Hin und Her in ein Zimmer, an dessen Tür das Schild „Private“ hing. Wir gingen hinein, während unsere beiden englischen Begleiter plötzlich verschwunden waren.
Auf unseren Gesprächspartner Herriot brauchten wir nicht lange zu warten. Er erschien schon ein paar Augenblicke nach unserem Eintreffen. Sicherlich war er auf ebenso geheimnisvolle Weise an den Ort unserer Zusammenkunft gelangt wie wir. Er hatte niemand mitgebracht, denn es sollte ja ein Gespräch von Mann zu Mann werden, abseits und außerhalb der diplomatischen Gepflogenheiten. Körperlich machte Herriot wieder den gleichen etwas unbeholfenen Eindruck auf mich wie das erstemal. Er war so ganz anders als das Bild, das ich mir von einem Franzosen gemacht hatte. Er hätte ebensogut ein pommerscher Landwirt sein können mit seinen breiten Schultern, seinem massigen Kopf und seinem riesigen Umfang. In diesem gewaltigen Körper aber steckte ein echt französischer Geist mit all seiner feingeschliffenen Formulierungskunst und seiner scharfen, verstandesmäßigen Durchdringung der Probleme. Herriot hatte ein gutmütiges, offenes Gesicht und richtete seine großen Augen fest und forschend auf Stresemann und mich. Wie bei der ersten Begegnung auf der Konferenz hatte ich auch diesmal den Eindruck, daß von Zeit zu Zeit ein gewisses Mißtrauen in seinen Blicken aufleuchtete. Das geschah zwar immer nur für ganz kurze Zeit, aber es war doch nicht zu verkennen.
Mit einem halben Lächeln reichte Herriot Stresemann und mir die Hand und nickte dabei freundlich mit dem Kopf. Dann ließ er seinen schweren Körper in den dritten Sessel an dem kleinen runden Tisch sinken, streckte behaglich die Beine von sich, holte eine große Pfeife hervor und stopfte sie langsam und bedächtig aus einem noch größeren Tabaksbeutel. Was ich allgemein über Pfeifenraucher bemerkt habe, fiel mir auch hier wieder ein. „Er raucht die Friedenspfeife“, schoß es mir durch den Sinn.
Ehe das Gespräch begann und meine Aufmerksamkeit durch die technische Seite meiner Aufgabe in Anspruch genommen wurde, hatte ich noch ein paar Augenblicke lang so deutlich wie selten das Gefühl, der Eröffnung eines neuen Kapitels, ja eines ganz neuen Buches in der Geschichte der beiden Nachbarvölker, der Deutschen und der Franzosen, beizuwohnen. Fast körperlich wurde mir bewußt, daß in diesem Augenblick von den beiden mir gegenübersitzenden Männern eine unsichtbare, aber trotzdem äußerst reale, scharf trennende Grenze überschritten wurde.
Aus diesen Überlegungen wurde ich durch Stresemanns Stimme herausgerissen, der gleich zu Beginn der Unterhaltung ohne Umschweife auf die Kernpunkte des damaligen deutsch-französischen Verhältnisses zu sprechen kam.
„Gerade Sie als alterfahrener Parlamentarier, Herr Herriot, werden verstehen“, erklärte Stresemann mit einer leicht näselnden, metallisch preußischen Stimme, „daß ich unmöglich vor den Reichstag hintreten kann, um ihm die Annahme des Dawes-Abkommens zu empfehlen, ohne daß über den Hauptpunkt, der die Gemüter in Deutschland seit Anfang des vergangenen Jahres bewegt, die Ruhrfrage und ihre Liquidation, etwas von mir gesagt wird.“
Während ich Herriot diese Worte übersetzte und er mir sehr aufmerksam zuhörte, denn er verstand nur sehr wenig Deutsch, verfolgte ich voll innerer Spannung sein Mienenspiel. Ich war durchaus darauf gefaßt, daß er bei der Erwähnung des ominösen Wertes Ruhr wieder so erregt aufbrausen würde wie in der ersten großen Sitzung der Konferenz. Mit einer gewissen Überraschung stellte ich jedoch fest, daß er völlig ruhig blieb und daß sein Interesse auch bei den nachfolgenden Ausführungen Stresemanns nicht geringer wurde und sich in seinen Mienen keinerlei Ablehnung widerspiegelte. Im Gegenteil, von Zeit zu Zeit nickte er sogar zustimmend oder sagte auf deutsch „Ja“ zu diesem oder jenem Punkt.
Stresemann hatte also offenbar die richtige Taktik gewählt. Als er sah, daß Herriot sich der Erörterung dieser Fragen in einem Gespräch von Mann zu Mann nicht entziehen wollte, ergriff er die Gelegenheit mit beiden Händen und gab Herriot ein umfassendes Bild der politischen Lage in Deutschland. In solchen Situationen erwies sich Stresemann immer als Meister. Je länger er sprach, desto mehr erwärmte er sich für die Gedankengänge, die ihm am Herzen lagen, und um so klarer und eindringlicher wurden die Formulierungen, die er zu den einzelnen Punkten fand.
Er schilderte die Gefühle, die die Ereignisse an der Ruhr im deutschen Volk wachgerufen hatten, und zeigte an einzelnen Beispielen, wie sehr ihm die Rechtsopposition unter Ausnutzung dieser natürlichen patriotischen Aufwallung schon während der Vorverhandlungen über das Dawes-Abkommen immer neue Schwierigkeiten bereitet habe. Deshalb müsse hier in London unter allen Umständen gleichzeitig mit der Reparationsvereinbarung auch die Aufhebung der Besetzung des Ruhrgebietes beschlossen werden.
Stresemann hütete sich als geschickter Politiker wohl davor, in diesem Augenblick auf die Rechtsfrage einzugehen. Denn daß der Ruhreinfall Poincarés eine Verletzung des Versailler Vertrages bedeutete, hatte man nicht nur bei uns in der Pressepolemik gegen Frankreich festgestellt, es war auch in der Note des konservativen englischen Außenministers, Lord Curzon, Anfang des Jahres den Franzosen bescheinigt worden. Wie sich später herausstellte, vertrat auch Herriot den Standpunkt, daß die Ruhraktion zu Unrecht erfolgt war. Daß Stresemann es vermied, dieses für Frankreich ungünstige Moment hier zu erwähnen, zeigte den großen Taktiker im hellsten Licht. Es hat bei so delikaten Verhandlungen keinen Zweck, dem Partner gleich von vornherein sein ganzes, von ihm selbst im Innern vielleicht längst erkanntes Unrecht vorzuhalten und dadurch lediglich eine menschlich verständliche Widerstandsregung hervorzurufen.
Herriot stellte den deutschen innerpolitischen Schwierigkeiten Stresemanns die Opposition im eigenen Lager, in der französischen Kammer und sogar in der eigenen Regierung, besonders von seiten des französischen Kriegsministers, entgegen.
„Ich habe überhaupt nur an der Londoner Konferenz teilnehmen können“, fügte Herriot temperamentvoll hinzu, „weil ich in der Kammer und im Senat versprach, daß hier in London von der Ruhr und von politischen Dingen nicht gesprochen würde. Es sollte nur ein Beschluß über die Durchführung des Dawes-Planes gefaßt werden.“
„Eine eigenartige Konferenz, auf der vom Thema nicht gesprochen werden darf“, warf Stresemann sarkastisch ein, aber Herriot störte sich nicht an diesem ironischen Zwischenruf, sondern fuhr fort: „Dieses Versprechen glaubte ich ohne weiteres abgeben zu können, weil mir MacDonald bei unserer Zusammenkunft in Chequers ausdrücklich versichert hatte, daß die Ruhr auf der Londoner Konferenz mit keinem Wort erwähnt werden würde.“
Stresemann schüttelte den Kopf. „Sie können sich mein Erstaunen vorstellen“, sprach Herriot weiter, „als am zweiten Tage nach Eröffnung der Verhandlungen in London MacDonald mir in einer Verhandlungspause unversehens auf die Schulter klopfte und mich fragte, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt:,Was machen wir nun mit der Ruhr, Herr Herriot?’ Ich wäre fast zu Boden gesunken vor Überraschung.“
Herriot hatte sich warm geredet bei der Schilderung dieses Zwischenfalles und stellte nun in sehr temperamentvoller Weise die Schwierigkeiten dar, auf die er sich in Frankreich gefaßt machen müsse, wenn er trotz des abgegebenen Versprechens Zugeständnisse in der Frage der Ruhrräumung machen würde.
„Die unausbleibliche Folge wäre der Sturz meiner Regierung. Und damit wäre der Sache des Friedens und der Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland ein schlechter Dienst geleistet, denn mein Nachfolger wäre entweder Poincaré, der schon jetzt eifrig gegen mich arbeitet, oder ein anderer, ihm geistesverwandter Politiker der Rechten.“
Diese anscheinend unabänderlich negative Reaktion Herriots wirkte auf Stresemann wie ein kalter Wasserstrahl. Jetzt aber zeigte sich seine zweite große Eigenschaft. Er ließ sich auch von einem anscheinend unüberwindlichen Hindernis nicht abschrecken. Beharrlich bemühte er sich immer von neuem, seinem Ziel näherzukommen. Insofern war diese grundlegende Aussprache mit dem französischen Ministerpräsidenten charakteristisch für Stresemanns gesamte Außenpolitik, so wie ich sie in den folgenden Jahren miterlebte.
Er versuchte auf einem anderen Wege bei Herriot Verständnis für die Notwendigkeit und die Möglichkeit eines Nachgebens in der Ruhrfrage zu gewinnen. Dieser hatte im Verlauf seiner Bemerkungen auf das ungeheure Mißtrauen hingewiesen, das in Frankreich immer noch gegenüber Deutschland herrschte, und hatte angedeutet, man müsse zunächst einmal feststellen, ob Deutschland auch wirklich abgerüstet habe, ehe Frankreich auf politischem Gebiet zu Konzessionen bereit sein würde. Herriot hatte die Frage der Militärkontrolle mit der Räumung der Ruhr verbunden und dabei gleichzeitig auf die Befürchtungen Frankreichs wegen der nationalistischen Tendenzen in der deutschen Innenpolitik hingewiesen.
Stresemann erwiderte schlagfertig, das beste Mittel, den nationalistischen Bestrebungen in Deutschland entgegenzuarbeiten, bestehe für Frankreich darin, Deutschland gegenüber eine vernünftige Politik zu verfolgen, wodurch den nationalistischen Elementen das Wasser abgegraben werde. Er zeigte, wie stark in Deutschland die Kräfte seien, die einer deutsch-französischen Verständigung positiv gegenüberstünden. Er wies insbesondere auf die Haltung der deutschen Industriellen hin, die trotz der Agitation Hugenbergs in ihrer großen Mehrheit für die Annahme des Sachverständigengutachtens eingetreten seien. Die Elemente der Vernunft und der Verständigung hielten in Deutschland den nationalistischen Strömungen durchaus die Waage. Es sei das klügste, was Frankreich tun könne, diesen vernünftigen Elementen durch eine geeignete Politik zu einem Übergewicht zu verhelfen.