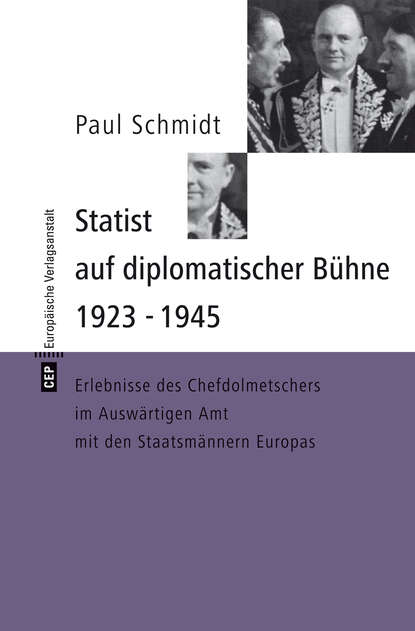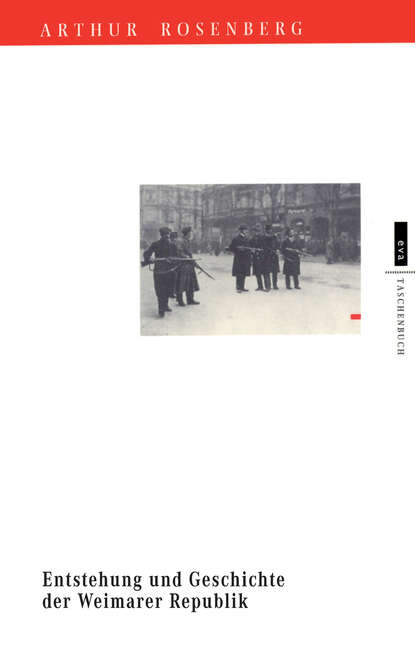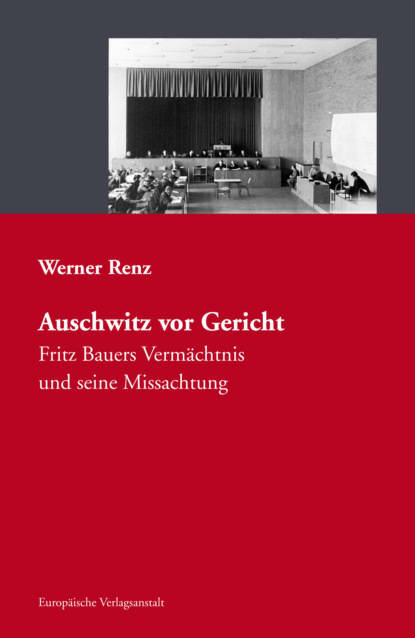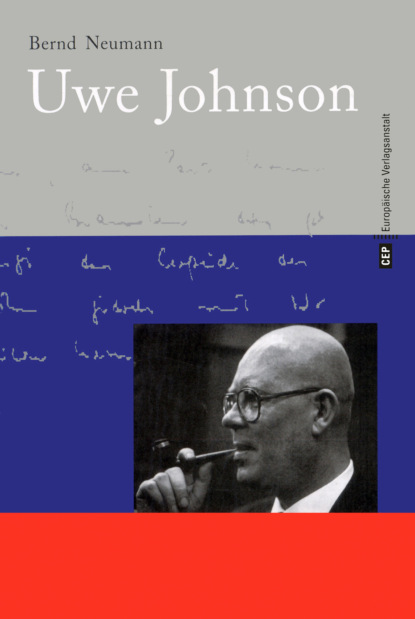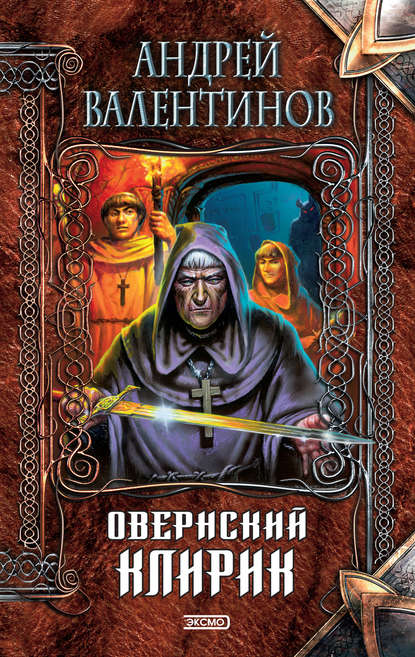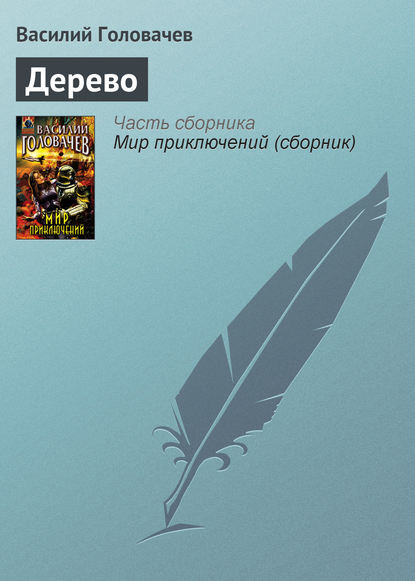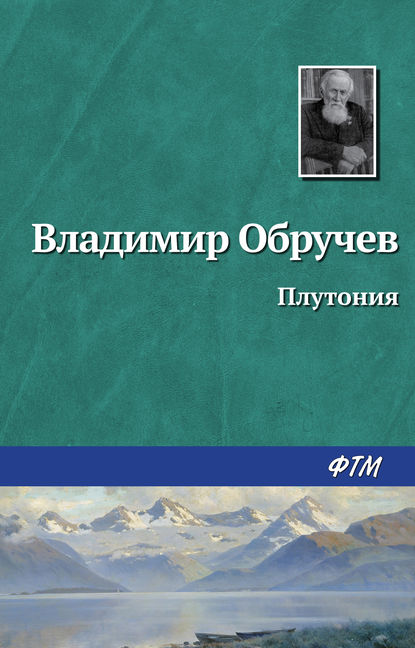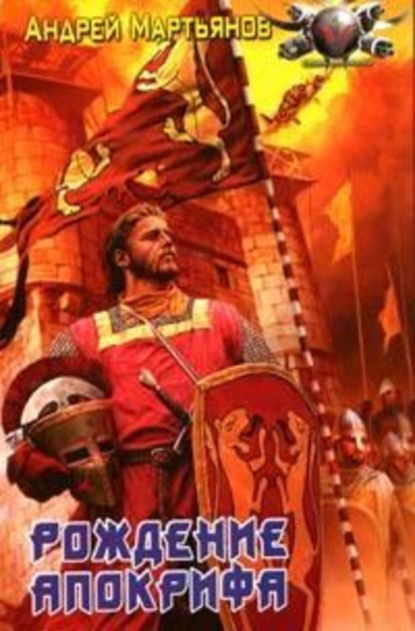Statist auf diplomatischer Bühne 1923-1945
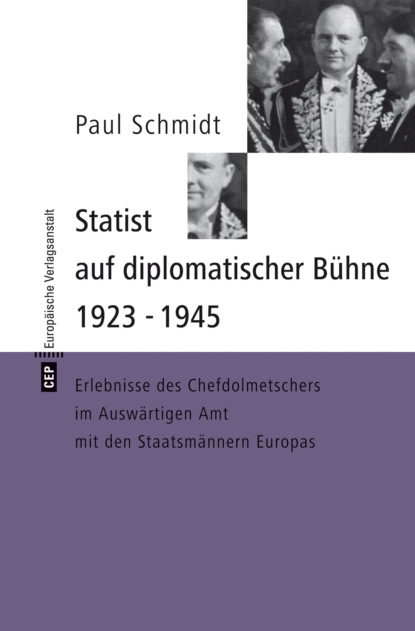
- -
- 100%
- +
In diesem Zusammenhang kam Stresemann auf die Gesten zu sprechen, die Frankreich ohne große Opfer Deutschland gegenüber machen könne, und deren Wirkung im Reich sehr nachhaltig sein würde. Auch hierbei handele es sich in erster Linie um die Liquidation des Ruhrunternehmens. Einer der wichtigsten psychologischen Faktoren sei dabei eine Amnestie für die sogenannten Ruhrverbrecher, die von Militärgerichten abgeurteilt worden seien.
In diesem Punkt erklärte sich Herriot ohne weiteres zu einer Geste bereit. Es war charakteristisch für seine menschliche Einstellung und zeigte sein wirkliches Verständnis für die Lage, daß er wörtlich dazu bemerkte: „Ich liebe Frankreich und ich liebe jeden, der für Frankreich kämpft; deshalb habe ich volles Verständnis dafür, daß Deutschland für jeden eintritt, der im Ruhrkampf für Deutschland gekämpft hat.“
Wer das Kernproblem der Liquidation der Ruhrunternehmung auf rein menschlichem Gebiet so klar erkannt hat und es offen zugibt wie dieser Franzose, dachte ich mir bei diesen Worten, der ist in seinem Innern sicherlich ebenso wie Stresemann von der Notwendigkeit überzeugt, gleichzeitig mit dem Dawes-Abkommen auch eine Vereinbarung über die Ruhrräumung zu treffen. Dies genau so offen auszusprechen wie sein Einverständnis in der Amnestiefrage, hinderten ihn wohl nur die Schwierigkeiten im eigenen Lager. Herriot war ein „homme de bonne volonté“, aber er fühlte sich nicht stark genug und war zu sehr in das Spiel der französischen Parteien verwickelt, als daß er sofort eine kühne Initiative hätte ergreifen können, um das von ihm als notwendig Erkannte durchzusetzen.
Zwei Stunden zog sich dieses wahrhaft historische Gespräch in Rede und Gegenrede hin. Immer wieder und mit immer eindringlicheren Argumenten ging Stresemann zum Angriff vor. Man merkte deutlich, wie er mit jedem Male überzeugender auf Herriot wirkte, der sich jedoch stets von neuem hinter der Opposition im eigenen Lager verschanzte; besonders der Name des Kriegsministers Nollet, des früheren Leiters der alliierten Kontrollkommission in Deutschland, fand dabei wiederholt Erwähnung.
Offensichtlich fühlte sich Herriot zu unsicher, um irgend etwas Positives zuzusagen. Während sich das Gespräch immer länger ausdehnte, sank die Temperatur von Viertelstunde zu Viertelstunde merklich. Herriot wurde immer nervöser, weil er die mit steigendem Nachdruck von Stresemann geforderte Räumung des Ruhrgebietes nicht zugestehen konnte, und Stresemann wurde seinerseits immer ungeduldiger, weil er so gar keine konkrete Wirkung seiner Worte verspürte.
Schließlich geriet das Gespräch vollends ins Stocken, minutenlang saßen sich die beiden Männer schweigend gegenüber. Nicht etwa, daß sie sich im Laufe des Gespräches auseinandergeredet und sich persönlich entzweit hätten. Ganz im Gegenteil, menschlich waren sie sich beide sicherlich nähergekommen. Denn sie hatten ohne Umschweife in aller Offenheit nicht als Politiker, sondern als Männer, die um den europäischen Frieden besorgt waren, miteinander geredet, hatten dabei aber erkennen müssen, wie fast hoffnungslos groß die Schwierigkeiten waren, die sich ihnen entgegenstellten.
Am Ende einer solchen Gesprächspause holte Herriot auf einmal tief Luft, so, als habe er sich zu einem schweren Entschluß durchgerungen. Ich fürchtete schon, er wolle Stresemann sagen, er müsse leider einsehen, daß sie beide nicht in der Lage seien, über die Ruhrräumung eine Einigung zu erzielen, und daß es besser sei, die Unterredung abzubrechen.
Zu meiner Überraschung aber trat genau das Gegenteil ein. Irgendwie ungehemmter und befreiter, redete sich Herriot die ganze Abneigung von der Seele, die er von vornherein gegen das Ruhrabenteuer empfunden hatte. Er sei sich darüber klar, daß die jetzige Stimmung in Deutschland, über die sich Frankreich so beunruhige, letzten Endes das Werk Poincarés sei, und er stimme Stresemann durchaus darin zu, daß man durch eine vernünftige Politik die nationalistische Haltung gewisser deutscher Kreise am besten eindämmen könne. In dieser Erkenntnis wolle er daher Stresemann zusagen, daß er sich nach Paris begeben werde, um dort seinen ganzen Einfluß zugunsten einer Räumung des Ruhrgebietes, von deren Notwendigkeit er selbst überzeugt sei, geltend zu machen. Es sei durchaus ungewiß, mit welchem Erfolg er aus Paris zurückkehren werde; vielleicht werde er überhaupt nicht zurückkommen, weil er mit der Möglichkeit rechne, bei dem Vorschlag einer Ruhrräumung oder der bloßen Andeutung, daß er mit Stresemann trotz seiner gegenteiligen Zusage über diese Frage gesprochen habe, gestürzt zu werden.
„Auf jeden Fall verspreche ich Ihnen aber, Herr Stresemann, daß ich alles in meinen Kräften Stehende tun werde, Ihren begreiflichen Wunsch nach irgendeiner Abmachung über die Ruhrräumung zu erfüllen und Ihnen dadurch Ihre Stellung gegenüber Ihren eigenen Landsleuten zu stärken“, fügte er ernst hinzu. Man glaubte ihm ohne weiteres, daß er dieses Versprechen halten würde, sah ihm aber gleichzeitig die Besorgnis an, die er wegen des zu erwartenden Kampfes in Paris hegte.
Bei diesen Worten hellte sich die vorher recht düster gewordene Atmosphäre der Unterredung zusehends auf. Mir fiel das Wort von dem Silberstreifen wieder ein. Es zeigte sich tatsächlich ein erster Hoffnungsschimmer am Horizont. In Deutschland hatte man angesichts der Ereignisse des letzten Jahres und der französischen Politik seit Beendigung des Krieges die Franzosen im Unterbewußtsein immer irgendwie als einer Einigung mit Deutschland abgeneigt angesehen. Nun hatte sich innerhalb von zwei Stunden bei diesem Franzosen, der uns hier gegenübersaß, das Gegenteil herausgestellt. Das war etwas, was mich mit großer Hoffnung für die Zukunft erfüllte. Daß diese Erwartungen nicht unberechtigt waren, zeigten nicht nur die nächsten Tage auf der Londoner Konferenz, sondern auch die nächsten Jahre der deutsch-französischen und europäischen Politik. Dieses wahrhaft historische erste Gespräch bewies mir, daß selbst größte Schwierigkeiten von Männern guten Willens überwunden werden können. Bildete doch diese Aussprache hinter den verschlossenen Türen des englischen Automobilclubs in London den ersten Auftakt zu jener glücklichen Entwicklung in den Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland, die gegen Ende der 20er Jahre ihre konkreten Ergebnisse zeitigte. Unbeachtet von der großen Öffentlichkeit wurde in dieser Stunde der Grundstein für das spätere europäische Gebäude gelegt.
Aber auch die „Eingeweihten“, ja selbst die deutsche Delegation in London wußten zunächst nichts davon. Auf dem Rückweg ins Ritz-Hotel, den wir diesmal ohne Umwege im Wagen zurücklegten, erteilte mir Stresemann den Auftrag, eine Aufzeichnung über das Gespräch auf Grund meiner Dolmetschernotizen anzufertigen und mit niemandem, auch nicht mit dem Reichskanzler, über das Vorgefallene zu sprechen. Ich durfte meine Aufzeichnung auch nicht diktieren, sondern mußte sie mit eigener Hand niederschreiben. Stresemann wollte die zarte Pflanze der neuen Verständigungspolitik, die an die Stelle der reinen Gewaltpolitik treten sollte, vor allen schädlichen Einwirkungen schützen. Er selbst war von dem Gespräch hoch befriedigt.
So saß ich denn am Abend jenes Augusttages in einem kleinen Zimmer im obersten Stockwerk des Ritz-Hotels, von dem aus der Blick weit über die Dächer Londons schweifte. Ich war tief beeindruckt von der Aufgabe, die mir anvertraut worden war, von dem plötzlichen Hineingestelltsein in die große Politik, und füllte Seite um Seite meiner ersten außenpolitischen Aufzeichnung, auf die noch unzählig viele andere in den nächsten 21 Jahren folgen sollten.
Als ich 1939 in das Ministerbüro versetzt wurde und in den Panzerschränken des historischen Zimmers der „grauen Eminenz“ in der Wilhelmstraße 76 herumstöberte, fand ich auch diese erste eigenhändige Aufzeichnung wieder. Die reichlich ungelenken Ausführungen, die ich damals als Anfänger in London niedergeschrieben hatte, machten mir deutlicher als vieles andere den ungeheuren Unterschied klar, der zwischen einem Stresemann und den „Staatsmännern“ bestand, für die ich in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg Aufzeichnungen anzufertigen hatte. Und das unerwartete Wiedersehen mit der hoffnungsvollen Zeit zu Beginn der Ära Stresemann bestärkte das Gefühl für die herannahende Katastrophe, das sich mir seit 1933 immer mehr aufgedrängt hatte.
Herriot begab sich tatsächlich an einem der nächsten Tage nach Paris. Der Finanzminister Clémentel und der Kriegsminister Nollet begleiteten ihn. Von der Fühlungnahme zwischen Herriot und Stresemann war auch nicht das geringste in die Öffentlichkeit durchgesickert, aber mit jenem feinen Witterungsvermögen, das ich bei den großen Journalisten, mit denen ich in der Folgezeit so oft zusammengekommen bin, immer bewundert habe, schrieb die englische Presse sehr treffend, daß von Herriots Reise nach Paris Erfolg oder Mißerfolg der Konferenz abhinge. Wie gut die Presse informiert war, ersah ich mit Staunen aus der Meldung einer Nachrichtenagentur, in der klipp und klar ausgesprochen wurde, daß zwischen Herriot und seinem Kriegsminister Nollet ein schwerer Konflikt in der Frage der Räumung des Ruhrgebietes ausgebrochen sei. Nollet habe sich scharf gegen jede derartige Maßnahme ausgesprochen und wolle die Räumungsfrage mit der Militärkontrolle verknüpfen, um auf diese Weise Zeit zu gewinnen.
Daß ich voller Spannung alle Nachrichten aus Paris verfolgte, war nur natürlich. Sprechen durfte ich ja mit niemand über das, was mich bewegte, und so hatte ich um so mehr Zeit zum Nachdenken. Wie recht Herriot in seiner Beurteilung der kritischen Situation seines Kabinetts in Frankreich gehabt hatte, erfuhr ich einen oder zwei Tage nach der Unterredung aus der Äußerung eines französischen Delegationsmitgliedes, mit dem ich in einer Verhandlungspause ins Gespräch kam.
Solche Gespräche waren nicht selten. Die jüngeren Mitglieder der französischen Delegation waren zu mir nicht nur in London, sondern auch bei späteren Gelegenheiten immer außerordentlich freundlich. Ich war nach meiner Arbeit auf der Konferenz gewissermaßen in die „Familie“ der technischen Mitarbeiter der einzelnen Delegationen aufgenommen worden. Genau so wie unsere Chefs trafen auch wir Kleineren und Kleinsten uns in der Folge immer wieder an den verschiedensten Stellen Europas zu gemeinschaftlicher Arbeit. Man wurde immer näher mit den einzelnen Sekretären und Sachverständigen der anderen Delegationen bekannt, man tauschte ungezwungen kritische Bemerkungen über die hohen Minister aus, und es bildete sich eine richtiggehende internationale Kameradschaft zwischen uns heraus. Im Laufe der Zeit gehörte ich mehreren solcher internationalen Familien an, deren Mitglieder sich in fast regelmäßigen Zeitabständen trafen.
Da war zunächst die Reparationsfamilie, wie ich sie zum ersten Male in London kennenlernte. Dann trat später eine allgemein politische Familie in Erscheinung, mit der ich zum ersten Male in Locarno und später beim Völkerbund in Genf auf den regelmäßigen Ratssitzungen und Vollversammlungen zusammentraf. Daneben bestand noch die Wirtschaftsfamilie, deren Mitglieder sich bei den Wirtschaftsverhandlungen und Weltwirtschaftskonferenzen begegneten, und den Abschluß bildete die mit Militärs stark durchsetzte Abrüstungsfamilie. Die Minister mochten kommen und gehen, aber die Sekretäre und die technischen Berater blieben meistens dieselben und bildeten auf diese Weise einen nicht zu unterschätzenden, internationalen Zusammenhalt, der durchaus den Namen einer Familie verdiente.
Daß für mich persönlich außerdem noch ein starker Kontakt zu den Dolmetschern bestand, insbesondere später zu den hervorragenden Könnern des Völkerbundes in Genf, ist selbstverständlich. Aber auch hier fiel mir besonders angenehm das freundliche Entgegenkommen meiner ausländischen Kollegen auf, die mich, den Neuling und den Jüngsten in ihrem Kreise, unterstützten und mir in manchen beruflich schwierigen Augenblicken, an denen es nicht fehlen sollte, Mut zusprachen.
Als damals in London bei solch einer „Familienunterhaltung“ einer der Sekretäre der französischen Delegation so ganz leichthin, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt, erklärte: „Wer weiß, ob Herriot überhaupt aus Paris wieder zurückkommt“, konnte ich wegen meines Schweigegebotes das Gespräch natürlich nicht vertiefen und nach dem Warum fragen. Aber ich fürchtete, daß die pessimistische Voraussage von Herriot sich nun doch bewahrheiten würde. Mit Stresemann sprach ich in den ganzen Tagen nicht über die politische Lage oder den Verlauf der Konferenz. Er hatte den Kopf mit anderen Dingen zu voll, und ich war ja auch schließlich nur der Dolmetscher, mit dem er keine tiefgründigen Gespräche führen würde.
Um so erfreuter war ich, als an einem der nächsten Tage ein Kommuniqué über die kritische Sitzung des französischen Ministerrates in Paris herauskam, in dem es hieß, daß das Kabinett dem Ministerpräsidenten Herriot „einmütig seine volle Zustimmung“ erteilt habe, und daß dieser sich bereits auf dem Rückweg nach London befinde.
Die Konferenz hatte inzwischen mehrere Unterausschüsse gebildet, in denen die einzelnen technischen Fragen über die Durchführung des Dawes-Planes beraten wurden. Interessant erschien mir insbesondere der Einfluß, der sich von außenher, von seiten der Bankiers, geltend machte; sie sollten die Gelder für die Deutschland zu gewährende Anleihe aufbringen, welche zur Ingangsetzung des Dawes-Planes notwendig war. Diese nüchternen, unsentimentalen Rechner stellten dafür eine Reihe von Bedingungen auf, die lediglich von wirtschaftlichen und finanziellen Überlegungen diktiert waren und sich in vielen Punkten mit den deutschen Forderungen deckten.
Auch die Bankiers hielten eine völlige Wiederherstellung der Souveränität des Reiches über das Ruhrgebiet für unumgänglich. Sie glaubten, das Risiko einer Anleihe nur dann übernehmen zu können, wenn die Ruhrindustrie wieder völlig frei und ungehindert arbeite und die Wirtschafts- und Finanzlage des Reiches wieder so weit stabilisiert würde, daß auch nach rein wirtschaftlichen Erwägungen eine Hergabe von Kapital vertretbar sei.
Aber gerade diese Außerachtlassung der Imponderabilien schaffte wieder neue Schwierigkeiten. MacDonald erklärte einmal auf einer Sitzung, er werde als Führer einer Arbeiterregierung bei seiner Partei schwer in Mißkredit geraten, wenn sich herausstelle, daß er sich seine Handlungen von Kapitalisten habe vorschreiben lassen, und die Franzosen waren damals über die entgegengesetzte Auffassung dieser nüchternen Finanziers und Wirtschaftler hell empört, ähnlich wie im Jahre 1948 über die Entscheidungen der anglo-amerikanischen Wirtschaftssachverständigen in der Frage des Industrieniveaus und der großzügigeren Behandlung der gleichen Ruhrindustrie, um die es schon 1924 in London ging.
Kurze Zeit nach der Rückkehr Herriots aus Paris kam es zu einer zweiten Unterredung zwischen ihm und Stresemann. Diesmal fand sie im Rahmen der Konferenz ohne große Geheimnistuerei in einem Zimmer des englischen Auswärtigen Amtes statt. Herriot verbreitete sich dabei erneut über die innerpolitischen Schwierigkeiten, die er in Frankreich bei seiner letzten Anwesenheit gehabt habe. Aber er hatte sein Versprechen gehalten. Der Ministerrat hatte ihn ermächtigt, über die Ruhrräumung zu sprechen und sogar feste Abmachungen darüber zu treffen! Es sei nicht leicht gewesen, die französische Regierung und die Vertreter der Parteien zu diesem Zugeständnis zu bewegen. Er habe es mit der Verpflichtung erkaufen müssen, darauf zu bestehen, daß die Räumung erst … in einem Jahr durchgeführt würde.
Das war für Stresemann natürlich ein schwerer Schlag. „Ich muß Ihnen, Herr Herriot, zwar für Ihre Bemühungen in Paris danken. Sie haben das, was Sie mir vor einigen Tagen zusagten, gehalten, aber leider sehe ich keine Möglichkeit, mit Ihnen auf dieser Grundlage weiterzuverhandeln.“ Er erkenne die Schwierigkeiten der französischen Parlamentslage durchaus an. Aber wenn er sich vorstelle, daß er mit dieser Räumungsfrist vor den deutschen Reichstag treten solle, so sei er sicher, daß das ganze Londoner Abkommen abgelehnt werden würde. Die Folgen für Deutschland würden katastrophal sein, aber die Rückwirkungen würde auch Frankreich, ja ganz Europa zu spüren bekommen, Stresemann wurde bei diesen Ausführungen genau so temperamentvoll wie Herriot, wenn er von den Schwierigkeiten im eigenen Lande sprach. Seine Worte überstürzten sich, seine helle Stimme klang laut durch den Raum.
Herriot erwiderte ebenso heftig, daß er gar nicht daran denken könne, kürzere Räumungsfristen zuzugestehen. Er habe ohnehin schon mit Nollet und Foch in Paris die heftigsten Zusammenstöße gehabt; man habe ihm vorgeworfen, seine eigenen Ministerkollegen hintergangen zu haben. Er sei überhaupt nur nach Paris gefahren, weil er eingesehen habe, daß in der Räumungsfrage etwas geschehen müsse. Auch MacDonald habe ihn übrigens genau so wegen der Ruhr bedrängt, aber es sei jetzt, nachdem er mit so vieler Mühe in Paris ein einigermaßen befriedigendes Ergebnis erzielt habe, für ihn eine große Enttäuschung, wenn Stresemann nun erkläre, er könne sich damit nicht zufriedengeben.
Trotzdem versuchte Stresemann noch mehrmals, bei Herriot eine Verkürzung der Räumungsfrist durchzudrücken. Es dürfe sich nicht um Monate, sondern nur um Wochen handeln. Eine andere Lösung könne er gegenüber dem deutschen Parlament nicht vertreten.
Mit einem fast gequälten Gesichtsausdruck wiederholte Herriot seine Einwendungen, und man schien völlig festgefahren zu sein. In dieser Situation kam Stresemann auf einen Ausweg. Er sagte, in Deutschland würde nicht nur der Abschluß der Räumung, sondern auch deren Beginn von großer Bedeutung sein. Er frage daher Herriot, ob die Räumung wenigstens unverzüglich beginnen könne.
Diesen Gedanken griff Herriot sofort mit einer gewissen Erleichterung auf. Er meinte in erheblich ruhigerem Ton, daß sich darüber natürlich reden lasse und erwähnte dabei etwas von einem Räumungsplan, zu dessen Ausarbeitung er bereits Auftrag gegeben habe. Er würde ihn Strese mann in den nächsten Tagen vorlegen.
So hatte denn die beiderseitige Erregung doch ein gewisses Ergebnis gezeitigt. Stresemann konnte jedenfalls für sich buchen, daß er zwei Schritte vorwärtsgekommen war. Er hatte erreicht, daß die französische Weigerung, überhaupt Abmachungen über die Räumung zu treffen, nicht mehr aufrechterhalten wurde und hatte darüber hinaus eine gewisse Aussicht auf einen baldigen Räumungsbeginn gewonnen. Denn es war klar, daß Herriot in diesem Punkt mit sich reden lassen würde.
Als dann die Anleihefrage erörtert wurde und Stresemann von den Schwierigkeiten sprach, die von den Bankiers gemacht würden, brauste Herriot sofort wieder auf. Besonders ärgerlich schien er auf die Amerikaner, zu sein. Ein amerikanischer Bankier, erfuhren wir bei dieser Gelegenheit, habe ihm eine Liste von 25 Bedingungen überreicht, darunter eine ganze Reihe von politischen Forderungen, von denen die Bankiers die Gewährung der Anleihe abhängig machten. Wenn von den Banken der Versuch gemacht werde, sich in die Politik einzumischen, so verzichte er lieber auf den ganzen Dawes-Plan, rief er erregt Stresemann zu.
Über die Räumungsfrage wurde dann noch tagelang verhandelt. Langsam wurden Fortschritte gemacht. Der Kreis der Teilnehmer erweiterte sich. Marx und Luther begleiteten Stresemann. Der Reichsfinanzminister Luther beteiligte sich äußerst aktiv an den Verhandlungen, und zwar nicht nur auf seinem eigentlichen Sachgebiet, sondern auch in den politischen Fragen. Herriot brachte zu den vorerwähnten erweiterten Verhandlungen den belgischen Ministerpräsidenten Theunis und dessen Außenminister, Hymans, mit. Man trat zu sogenannten „Dreiecksbesprechungen“ zusammen. Die Engländer beteiligten sich nicht unmittelbar, um die Fiktion aufrechtzuerhalten, daß auf der Konferenz selbst nur vom Dawes-Plan gesprochen würde.
Aber indirekt versuchte Stresemann auch über MacDonald und über den amerikanischen Botschafter, Kellogg, den späteren Außenminister, auf Herriot einzuwirken. Beide versicherten ihm, ihr Möglichstes getan zu haben, konnten aber von keinem Erfolg berichten. Kellogg fügte noch hinzu, er glaube nicht, daß Herriot formell unter die einjährige Räumungsfrist heruntergehen könne, nehme aber an, daß er nach einer Einigung über das Dawes-Abkommen die Räumung doch in Etappen durchführen werde. Es bestehe also Aussicht, daß sie noch in diesem Jahre beginne.
In den nächsten Tagen überstürzten sich die Einzelbesprechungen zwischen den Delegationen Deutschlands, Frankreichs und Belgiens. Dabei wurde um die kleinsten Zugeständnisse in der nunmehr doch im Mittelpunkt der Londoner Konferenz stehenden Ruhrfrage gekämpft. So versuchte z. B. Stresemann, den Beginn der Räumungsfrist vom Tage der Unterzeichnung der Londoner Abmachungen auf den Zeitpunkt der Einigung zwischen den drei Delegationen vorzuverlegen, ein kleiner Unterschied, der aber doch zeigt, wie von deutscher Seite um jeden Fußbreit Gewinn gerungen wurde.
Im Verlauf dieser Verhandlungen beschwor Stresemann mit der Erklärung, er müsse um eine Verschiebung der Konferenz bitten, da er ohne Zustimmung des Berliner Kabinetts und der deutschen Parteien keinesfalls die einjährige Räumungsfrist annehmen könne, eine Krise herauf. Besonders die Belgier schienen über die Entwicklung sehr besorgt zu sein und ließen durchblicken, daß Herriot doch in der Lage sei, mit einer Teilräumung früher zu beginnen. Selbst Nollet versuchte, eine Unterbrechung der Konferenz, die durch die in Aussicht genommene Rückkehr des Finanzministers Luther zur Berichterstattung nach Berlin hervorgerufen worden wäre, zu unterbinden.
Diese „Dreiecksbesprechung“ fand im Garten der Amtswohnung Mac-Donalds hinter dem Hause Nr. 10 Downing Street statt, wo die Augusthitze Londons durch die leise Brise, die vom Green Park herüberwehte, gemildert wurde. Nach einiger Zeit kamen MacDonald und Kellogg hinzu und brachten auch ihrerseits ihre Bedenken gegen eine Vertagung zum Ausdruck. Als Stresemann aber beharrlich bei seinem Standpunkt blieb, daß angesichts der Unnachgiebigkeit der Franzosen eine Rücksprache in Berlin unumgänglich nötig sei, wolle man nicht den ganzen Vertrag in Gefahr bringen, stand Herriot auf, nahm Marx, Stresemann und mich beiseite und erklärte sich überraschenderweise bereit, doch eine Räumung in Etappen vorzunehmen. Er bat allerdings um absolute Diskretion, da er mit dieser Zusage über die ihm von Paris auferlegten Beschränkungen hinausgehe.
Marx und Stresemann gaben erleichtert ihrer Zufriedenheit über diese Zusicherung Ausdruck, erklärten aber gleichzeitig, daß sie wegen des ihnen auferlegten Schweigegebotes im gegenwärtigen Augenblick nicht viel damit anfangen könnten, wo es sich darum handele, die Zustimmung des Berliner Kabinetts und der deutschen Parteien zur Unterzeichnung des Dawes-Abkommens zu erreichen.
Herriot erwiderte nichts darauf, und die drei Staatsmänner kehrten mit mir wieder an den Gartentisch zurück, an dem die übrigen Teilnehmer der Besprechung mit gespannten Blicken auf uns gewartet hatten.
Zu meiner großen Überraschung begann dann Herriot ganz offen von der Geste einer etappenweisen Räumung zu sprechen. Er holte sogar eine Karte hervor, auf der, soweit ich sehen konnte, die Räumung in Etappen schon eingezeichnet war. Nun wurden Marx und Stresemann von allen Seiten bestürmt, die Berliner Reise Luthers aufzugeben und die Zustimmung aus Berlin telegraphisch einzuholen. Sie erklärten sich jedoch lediglich bereit, diese Frage noch einmal zu prüfen. Hätte ich schon eine größere Konferenzerfahrung gehabt, so hätte ich gewußt, daß dies natürlich die Aufgabe des Reiseplanes bedeutete.
Am Abend hörte ich dann aus einer Delegationssitzung, daß die Reise Luthers nun tatsächlich nicht stattfinden würde und daß ein langes Telegramm mit einer Darstellung der gesamten Konferenzlage und des Abkommens, so wie es sich aus den Beratungen bisher ergab, nach Berlin abgegangen sei.
Am nächsten Tage schon antwortete das Auswärtige Amt, in einer unter Vorsitz des Reichspräsidenten Ebert abgehaltenen Kabinettssitzung sei der Delegation grundsätzlich die Genehmigung zur Annahme des Abkommens und der letzten Vorschläge Herriots erteilt worden. Damit war die Krise überwunden.
Trotzdem machte Stresemann in einer weiteren Besprechung noch einen allerletzten Versuch, Herriot zur Verkürzung der ganzen Räumungsfrist zu bewegen. Er drang damit nicht durch, erhielt aber die allerdings recht wertvolle Zusage, daß der Dortmunder Bezirk und einige kleinere Gebietsteile sofort nach Unterzeichnung geräumt werden würden.