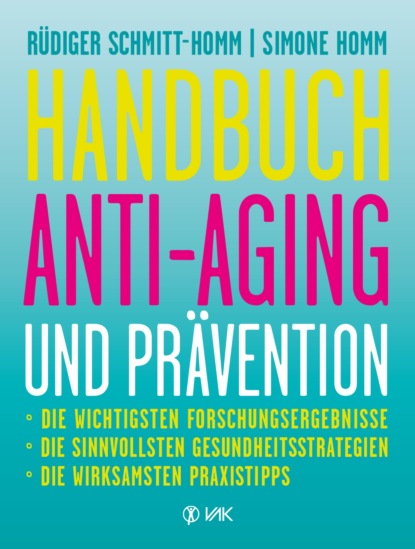- -
- 100%
- +
Natürlich geht es in diesem Buch auch um die klassischen Ideale von Jugendlichkeit wie Aussehen der Haut oder Bewahren einer schönen Figur – also das, was viele immer noch in erster Linie unter Anti-Aging verstehen. Doch damit sind die heutigen Möglichkeiten einer Beeinflussung der Alterung längst nicht erschöpft. Gezielte Alternsprävention ist der eigentliche Schlüssel für Gesundheit, Leistungsfähigkeit und ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter. Der Weg dahin ist eine lebenslange Aufgabe und die Chancen sind um so größer, je früher man beginnt.
Es ist an der Zeit zu handeln – Alternsstopp in der Praxis
Seit einigen Jahrzehnten ist man den Faktoren, die hinter der menschlichen Alterung stecken, auf der Spur. Und die Suche war bisher alles andere als erfolglos, im Gegenteil: Sie war eher zu erfolgreich für alle, die auf eine einfache Lösung gehofft hatten. Denn: Bis heute wurden mehr als dreihundert Einzelmechanismen beschrieben, die etwas mit unserem Altern zu tun haben. Allzu oft wurde die Aufdeckung eines neuen Mechanismus vorschnell als „die Ursache“ des Alterns bezeichnet – ein Fehler! Denn es ließ sich bisher in jedem Fall zeigen, dass eine einzelne Theorie zur Erklärung aller im menschlichen Körper ablaufenden Alterungsprozesse nicht ausreicht.
Der Streit unter den Anhängern verschiedener Theorien wurde nicht immer seriös ausgetragen und dies hat das Vertrauen in die Alternsforschung nicht gerade gefördert. Je komplexer die Alterung sich darstellte, desto lauter wurde der Ruf nach einer alles erklärenden Theorie, nach der Ursache des Alterns.
Wenig sinnvoll: Warten auf die eine Pille
Wäre unsere Alterung auf eine einzige übergeordnete Ursache zu reduzieren, könnte man auch darauf hoffen, mit nur einer Pille das Altern zu verhindern. Ein verlockender Gedanke nicht nur für die, die vom Zurückgewinnen ihrer Jugend träumen. Auch die Gegner jeglicher Art von Alternsintervention verweisen auf das theoretische Ziel, vielleicht einmal eine einzige Ursache zu finden. Nach ihrer Ansicht sollte das Altern beim Menschen überhaupt erst dann beeinflusst werden, wenn alle Fragen zur Alterung beantwortet sind.

„Die meisten Dinosaurier waren Vegetarier, sie haben niemals geraucht oder Alkohol getrunken – und wo sind sie jetzt?“
Warten, bis alle Fragen geklärt und alle möglichen Risiken ausgeschlossen sind? In jedem Fall wäre man auf der sicheren Seite. Doch die Vertreter dieser Abwartestrategie werden weniger. Aus gutem Grund. (Siehe „Nicht aufschieben, sondern handeln!“)
„Wenn das Schicksal ruft: Feuer!, so achten das die wenigsten; erst wenn sie hören: Rien ne va plus!, bekommen sie Lust, aber zu spät.”
LUDWIG BÖRNE [deutscher Publizist und Journalist, 1786–1837]
Der Alternsphysiologe Byung Pal Yu von der Universität Texas in San Antonio unterstützt die Praktiker. Er macht keinen Hehl daraus, was er davon hält, auf irgendwelche speziellen Entdeckungen zu warten: „In einer radikalen Abkehr von der bisherigen Vorstellung vom sogenannten eigentlichen Alterungsprozess stimmen heute die meisten Gerontologen darin überein, dass Altern nicht von einem einzelnen Faktor verursacht wird, der den gesamten Ablauf steuert, sondern dass Altern durch das Zusammenspiel verschiedener intrinsischer und extrinsischer Kräfte bestimmt wird.“
Die Ursachen für die Alterung beim Menschen sind extrem vielschichtig. Mit einer einzigen Pille gegen das Altern wird es also nichts werden.
Wer die Schrittmacher stoppt, der bremst das Altern
Zum Glück müssen wir nicht allen rund dreihundert Einzelmechanismen der Alterung Rechnung tragen. Alterung ist, wie gesagt, sehr komplex. Genau diese Tatsache, die Grundlagenforscher schon einmal die Haare raufen lässt, ist für uns eher von Vorteil. Denn die Komplexität ergibt sich daraus, dass viele Einzelfaktoren in Wechselwirkung zueinander stehen, einander verstärken oder von gemeinsamen übergeordneten Prozessen mitgesteuert werden. Eine Beeinflussung, die an wenigen zentralen Punkten ansetzt, kann deshalb weitreichende positive Effekte haben.
Roy Walford, einer der bekanntesten Alternsforscher des 20. Jahrhunderts, hielt schon früh nichts von der bisherigen Strategie der Gegenüberstellung und Aufrechnung der verschiedenen Alternstheorien. Dieser reduktionistische Blickwinkel ziele am Wesen der Alterung vorbei. Seine Kritik brachte ihm zunächst einiges Missfallen von Kollegen ein; wie man sich denken kann, vor allem von denen, die hofften, dass sich ihre eigene Theorie durchsetzen würde.
Nun, durchgesetzt hat sich heute eher die Ansicht von Walford, der nicht von „der Ursache“ des Alterns, sondern von verschiedenen „Schrittmachern“ sprach. Auch mit seinem persönlichen Eintreten für eine stärkere Anwendung der bereits zur Verfügung stehenden Mitteln stieß er lange auf den Widerstand konservativer Mediziner. Die Zahl der Gerontologen, die wie Walford wesentlich mehr konkrete Umsetzung forderten, nahm in den 90er-Jahren weltweit dennoch schnell zu.
Nicht aufschieben, sondern handeln!
Mindestens drei Gründe sprechen dafür, mit der Anwendung praktischer Alternsintervention nicht noch länger zu warten:
1. Die Forderung, erst dann konkret etwas zu unternehmen, wenn auch die letzten Geheimnisse aufgedeckt sind, gibt es merkwürdigerweise nur im Bereich der Alterung. Niemand würde auf die Idee kommen, Krankheiten wie Krebs, Alzheimer oder Allergien nicht zu behandeln – für keine dieser Krankheiten sind alle Fakten, geschweige denn die wirklichen Ursachen bekannt. Wichtig ist schließlich vor allem, dass Erfolg versprechende Maßnahmen existieren, die zum Nutzen der Menschen eingesetzt werden können.
2. Altern ist multifaktoriell, das heißt, an diesem Prozess sind mehrere Mechanismen beteiligt. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, dass letztlich nur eine Theorie des Alterns übrig bleibt, die sämtliche verschiedenen Teilvorgänge abdeckt. Noch unwahrscheinlicher ist, dass eines Tages eine einzige Pille alle Alternsprozesse verhindern kann.
3. Der letzte und wichtigste Punkt: Es existieren schon heute effektive und gut untersuchte Möglichkeiten, Alterungsprozesse zu beeinflussen und den Alterserscheinungen vorzubeugen.
Warum es bei der Alternsprävention weder absolutes Wissen noch absolute Sicherheit geben kann
Sind die heute vorliegenden wissenschaftlichen Fakten für konkrete Alternsbekämpfung „ausreichend”? Nehmen wir das Beispiel Melatonin (vgl. II.9). Schon Mitte der 90er-Jahre hielten führende Wissenschaftler angesichts des damaligen Erkenntnisstandes die Substitution beim Menschen für gesundheitlich sinnvoll. Andere lehnten den praktischen Einsatz ab. „Unzureichende Daten“, so das Argument.
Im vergangenen Jahrzehnt „explodierte“ das Wissen über diesen Naturstoff. Heute liegen mehr als 20 000 (!) wissenschaftliche Arbeiten vor, gerade auch über die praktische Anwendung. Das sind mehr Daten, als zu den meisten der herkömmlichen Arzneimittel jemals existieren werden. Unzählige Tierversuche bestätigen ein hohes Sicherheitspotenzial. Mehrere Millionen Menschen weltweit nehmen Melatonin seit mehr als 15 Jahren täglich ein.
Sind das nun „ausreichende” Daten? Die Mehrheit der Melatoninexperten sagt „ja“. Die zuständigen Behörden sind dennoch gegen die praktische Nutzung: Die lebenslange Einnahme sei noch „nicht ausreichend” untersucht. Das ist streng genommen korrekt. Zwar sprechen lebenslange Tests mit Tieren und Langzeitstudien bei Menschen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gegen jegliches Gefährdungspotenzial, selbst bei Einnahme über 50 oder mehr Jahre. Unanfechtbare Beweise wären aber erst in einem halben Jahrhundert oder später möglich.
60 Jahre zu warten, das wäre vielleicht eine denkbare Strategie für einen heute Zehnjährigen. Was aber, wenn ein Erwachsener ein solches Mittel nutzen möchte, um bestimmte Alternsprozesse, sein Krebsrisiko oder auch nur seinen Schlaf zu verbessern? Bis sich alle Langzeitaspekte zu Melatonin lückenlos klären ließen, wäre diese Person lange tot. Wie man sieht, ist die Nutzen-Risiko-Relation bei Mitteln gegen das Altern nicht nur schwer einzustufen, sie kann auch je nach Einzelfall sehr unterschiedlich ausfallen. Und es kommt noch etwas Entscheidendes hinzu:
Um absolut exakt zu bestimmen, wie effektiv ein einzelnes Mittel gegen das Altern beim Menschen ist, wären Langzeitstudien in extremen zeitlichen und finanziellen Dimensionen notwendig. Und selbst wenn man 50 Jahre Zeit hätte: Kein wissenschaftliches Institut und keine Firma der Welt könnte ein solches Projekt finanzieren – schon gar nicht bei natürlichen, nicht patentierbaren Substanzen wie Melatonin oder den vielen Antioxidantien. Zumindest darüber sind sich alle einig.
„Die Nation ist fortgeschritten in der Erkenntnis. Die Bürokratie ist nicht einmal in der Theorie nachgekommen, geschweige in der Praxis.”
FRIEDRICH LIST [deutscher Nationalökonom, 1789–1846]
Alternsintervention in Deutschland
Bei jedem Mittel gegen das Altern, das in den vergangenen 20 Jahren in die Schlagzeilen gelangte, lief die Diskussion immer nach dem gleichen Schema ab: Mögliche Wirkungen gegen Alterungsprozesse und der gesundheitliche Nutzen wurden jeweils ausführlich beschrieben und nicht selten wurden große Hoffnungen geschürt. So weit die Theorie. Sobald es aber um die praktische Umsetzung und vor allem um die konkrete Verfügbarkeit für die Bürger ging, mündeten alle Empfehlungen in Aussagen wie: „Noch immer sind nicht alle Fragen geklärt.“ Und: „Von einer konkreten Anwendung ist abzuraten, bis ausreichende Forschungsergebnisse vorliegen.“ Kommt Ihnen das bekannt vor?
Nun ist es ja durchaus redlich, ausreichende Erkenntnisse abwarten zu wollen. Der Begriff „ausreichend“ ist jedoch subjektiv und lässt Spielraum nach beiden Seiten. Allgegenwärtig sind die berechtigten Warnungen vor unseriösen vorschnellen Empfehlungen. Doch es gibt auch das andere Extrem, nämlich grundsätzlich jeden Wissensstand beim Thema aktive Prävention als „nicht ausreichend“ zu bezeichnen.
Neue Herausforderungen verlangen nach neuen Antworten
Die besondere Situation beim Thema Alterung machte eines sehr bald deutlich: Anders als bei der Zulassung von Medikamenten gegen Krankheiten können Behörden auf dem Gebiet der persönlichen Prävention nicht die Rolle des Vormunds für jeden Einzelnen einnehmen. Aus diesem Grund wurde in den USA und anderen Ländern den Bürgern die Nutzung von Mitteln wie hoch dosierten Vitaminen, Melatonin, DHEA oder Antioxidantien in Eigenverantwortung ermöglicht; und das geschah nicht etwa, weil die Behörden dort weniger sicherheitsorientiert wären als bei uns.
Der wichtigste Punkt: Die Beweislast wurde umgekehrt. Um jetzt erwachsenen Personen die Nutzung eines Wirkstoffs oder einer bestimmten Therapie für die persönliche Prävention zu verbieten, müssen Medizinbehörden ihrerseits eindeutige Belege für eine relevante gesundheitliche Gefährdung vorlegen. Der über Jahrzehnte alles blockierende Verweis auf angeblich nicht ausreichende Wirksamkeits- und Sicherheitsbeweise ist damit nicht mehr möglich beziehungsweise nun auf das reduziert, was er sein soll: ein Warnhinweis. Das hat die gesamte Situation grundlegend verändert.
In Deutschland hingegen versucht man immer noch, das Thema Alterungsprophylaxe in die Paragrafen althergebrachter Verordnungen des Gesundheits- und Medikamentensystems zu pressen. Ein Zustand, der nicht nur die praktische Umsetzung präventiver Strategien erschwert, sondern bereits vom Ansatz her den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen dieses immer wichtiger werdenden Bereichs nicht gerecht wird.
Bleibt abzuwarten, wie lange man in Deutschland auf diesem Gebiet den Entwicklungen in anderen Ländern hinterherhinkt. Letztlich wird allein der Druck aus der Bevölkerung die Lage verändern können. Dieses Buch soll deshalb dazu beitragen, nicht nur das Wissen, sondern auch die praktischen Möglichkeiten für aktive Alternsintervention zu verbessern. Die Zeit ist reif!
„Ich brauche Informationen. Eine Meinung bilde ich mir selbst.”
CHARLES DICKENS [englischer Novellist, 1812–1870]
Ein Tummelplatz für Schwindler
Kaum ein Gebiet der Wissenschaft ist so von unterschiedlichen Interpretationen, gegensätzlichen Meinungen und persönlichen Auffassungen geprägt wie die experimentelle Gerontologie, die sich mit konkreten Maßnahmen zur Beeinflussung des Alterns beschäftigt. Das gilt ganz besonders für die praktische Alternsbeeinflussung beim Menschen.
Bereits in seinem Bestseller von 1798 (Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern) stöhnte der berühmte Arzt Wilhelm C. Hufeland genau über diese spezielle Problematik. Dabei war die Unterscheidung zwischen seriösen und unseriösen Empfehlungen zum Thema Lebensverlängerung bis in die Neuzeit vergleichsweise einfach. Aufgrund des geringen Wissens um die Ursachen der Alterung waren die meisten feilgebotenen Jungbrunnen eher Strohhalme der Hoffnung als Ergebnis wissenschaftlicher Forschung.
„Dieses Problem war schon immer ein bevorzugtes für die klügsten Köpfe, ein Spielfeld für Tagträumer, und die größte Verlockung für Scharlatane und Schwindler.”
WILHELM CHRISTOPH HUFELAND [deutscher Arzt und Begründer der Makrobiotik, 1762–1836]
Für viele immer noch ein Tabuthema
Als sich im 20. Jahrhundert ernsthafte Wissenschaftler mit der Frage beschäftigten, wie eine Verjüngung beim Menschen praktisch möglich sein könnte, geschah etwas Merkwürdiges: Es änderte sich nämlich nichts an der Vorverurteilung der Praktiker. Nach wie vor genügte allein die Beschäftigung mit diesem Thema, um als unseriös zu gelten. Bis in die Gegenwart blieb der menschliche Alterungsprozess für Religiöse eine göttliche Bestimmung, für andere ein unumstößliches Naturgesetz und für wieder andere ein wissenschaftliches Mysterium, das sich kaum erschließen lässt. Und wenn, dann bestimmt nicht mit „einfachen“ Methoden.
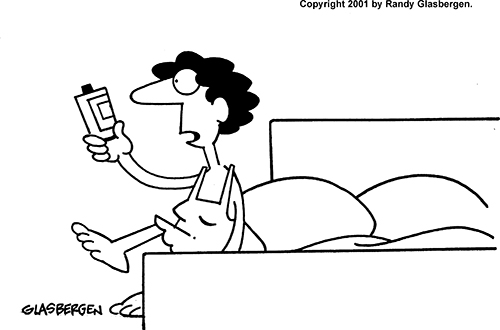
„Schritt 1: Tragen Sie die Wunder-Cellulite-Creme auf die Problemzonen auf. Schritt 2: Laufen Sie 15 Kilometer.“
„Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.”
ALBERT EINSTEIN [deutscher Physiker und Nobelpreisträger, 1879–1955]
Hohn und Spott für einige der wichtigsten Entdeckungen
Dies musste auch ein junger Wissenschaftler mit Namen Clive McCay erfahren, als er 1934 vortrug, der Alterungsprozess lasse sich in erheblichem Maße verzögern; und zwar allein durch Verringerung des Energieumsatzes mithilfe von Nahrungseinschränkung. Von den „seriösen“ Wissenschaftlern gab es Gelächter und bestenfalls mitleidige Minen.
Die Vorverurteilung war so absolut, dass niemand sich dafür interessierte, ob die von McCay gewonnenen Daten korrekt erhoben worden waren oder nicht. Sie waren es. Dennoch hat es ein halbes Jahrhundert gedauert, bis McCays Ergebnisse allgemein anerkannt wurden. Heute gilt die sogenannte kalorische Restriktion als die sicherste und sogar effektivste Methode, um Alterungsprozesse drastisch zu verzögern und die Lebensspanne entscheidend zu verlängern (vgl. II.12).
Anderen erging es noch schlimmer. Der Physiologe Eugen Steinbach unternahm noch vor McCay Studien zur Verjüngung. Er versuchte, unter anderem durch Drüsenverpflanzungen bei Tieren verjüngend wirkende Hormonveränderungen hervorzurufen, und erzielte damit beachtliche Erfolge. Als er seine Ergebnisse aber an jenem 5. Dezember des Jahres 1912 an der Wiener Akademie der Wissenschaften vortrug und von der Möglichkeit sprach, auch beim Menschen Alternsprozesse zu beeinflussen, sah er sich nur Anfeindungen gegenüber. Die Verunglimpfungen seitens seiner Kollegen wurden trotz oder gerade wegen des steigenden Interesses der Bevölkerung so erdrückend, dass Steinbach ins Exil ging und völlig resignierte. Heute, lange nach seinem Tod, gilt Eugen Steinbach als einer der Pioniere der Hormonbehandlung.
Doch die Problematik hat sich auch beim Thema Hormone bis ins 21. Jahrhundert nicht grundlegend geändert. Während Hormonsubstitutionen aus medizinischen Gründen (zum Beispiel Insulin) oder auch wegen des Lifestyles (Antibabypille) mittlerweile Routine sind, werden Ärzte, die Hormone gezielt gegen degenerative Alterung einsetzen, pauschal kritisiert. Staatliche Forschungsgelder gibt es kaum. Dabei lassen sich reparative und präventive Wirkungen oft nicht trennen. Ein Beispiel ist die Hormonoptimierung bei Frauen nach der Menopause (siehe Kapitel II.5).
„Wahrheiten werden, solange man sie nicht begreift, Dummheiten genannt.”
DANIEL SPITZER [österreichischer Satiriker, 1835–1893]
Vorsicht bei Übertragung von Tierstudien auf den Menschen
Nur ein Teil der Vorgänge beim menschlichen Alterungsprozess kann direkt am Menschen untersucht werden. Tierstudien sind deshalb in der experimentellen Gerontologie unverzichtbar und haben sich auch als äußerst reliabel erwiesen. Spätestens aber, wenn man die gewonnenen Erkenntnisse praktisch am Menschen anwenden will, wird die Frage nach der Übertragbarkeit neu aufgeworfen – zu Recht. Denn Tiermodelle können keineswegs immer eins zu eins auf den Menschen übertragen werden.
Lebensverlängerung durch Gelée royale?
Ein Beispiel dafür, wie Tierstudien fehlinterpretiert und damit in Misskredit gebracht werden, ist Gelée royale, der Futtersaft, mit dem Bienenköniginnen aufgezogen werden: Bienen leben nur etwa drei Monate. Werden sie aber im Larvenstadium nicht mit Honig, sondern mit dem ebenfalls von den Bienen produzierten Gelée royale gefüttert, entwickeln sie sich zu Königinnen mit einer Lebensspanne von mehreren Jahren. Entsprechend wurden in der Laienpresse Hoffnungen genährt, beim Menschen wirke dieser Saft ebenfalls lebensverlängernd. Das ist nicht der Fall. Ursache für diesen Effekt bei Bienen ist eine genetische Besonderheit, die bei anderen Insekten nicht vorliegt – und beim Menschen erst recht nicht.
Interessanterweise wird meist verschwiegen, dass die Königinnen durch die besondere Fütterung um ein Vielfaches schwerer werden als die anderen Bienen. Dieser Effekt soll natürlich möglichst nicht auf den Menschen übertragen werden. Unabhängig vom Aspekt Lebensverlängerung gibt es allerdings seriöse Hinweise auf gesundheitlich positive Effekte.
Mäuse haben nie Alzheimer
Es wäre schön, wenn kurzlebige Tiere immer einfach ein verkleinertes Modell der menschlichen Alterung wären. Leider ist dem nicht so. So laufen Nagetiere nicht Gefahr, typische menschliche Alterskrankheiten des Gehirns wie Parkinson oder Alzheimer zu erleiden. (Inzwischen gibt es allerdings genetisch gezielt veränderte Mäusestämme, bei denen sich Alzheimer imitieren und untersuchen lässt.) Krebserkrankungen hingegen lassen sich bei Mäusen und Ratten sehr gut untersuchen, weil die Tumorbildung dort recht vergleichbar mit der beim Menschen abläuft. Auch Nierenleiden sind bei Mäusen eine häufige Todesursache. Bei Fliegen wiederum, einem anderen wichtigen Forschungsobjekt in der Alternsbiologie, teilen sich die Zellen des erwachsenen Tieres nicht mehr. Entsprechend können sich bei ihnen keine Tumoren bilden.
Die Besonderheiten der verschiedenen Labortiere im Hinblick auf die Übertragbarkeit auf den Menschen sind heute ein eigener Forschungszweig. Jedes Tiermodell kann uns also nur ganz bestimmte Antworten für unsere eigene Alterung geben. Wird das allerdings berücksichtigt, lassen sich diese einzelnen Mosaiksteine dann zu einem sehr genauen Gesamtbild zusammensetzen.
Länger leben heißt nicht automatisch: besser leben
Ein Punkt, der gelegentlich auch von Wissenschaftlern wenig beachtet wird, sind qualitative Aspekte. Ein Beispiel: Angenommen, es wird ein neues Mittel gegen das Altern getestet. Und tatsächlich verlängert es die durchschnittliche Lebensdauer von Versuchstieren um 30 Prozent. In der Regel geht jetzt jeder stillschweigend davon aus, dass die gewonnene Lebenszeit auch qualitativ eine gute ist. In den meisten Fällen ist das auch so. Um allerdings sicher gehen zu können, müssen in den Studienberichten Angaben zum Zustand der Tiere und zur endgültigen Todesursache enthalten sein. Viele Untersucher beschränken sich aber ausschließlich auf Zahlen und sparen mit qualitativen Beschreibungen. Der Grund ist nicht immer Nachlässigkeit. Als Forscher läuft man leider schnell Gefahr, unseriös zu wirken, wenn man etwa betont, dass die untersuchten Tiere trotz ihres Alters ein „glänzendes Fell“ hätten oder „auffallend munter“ seien.
Wir jedenfalls haben versucht, für den nachfolgenden Praxisteil diese und andere kritische Aspekte bei der Beurteilung der vielfältigen Zahlen und Daten zu berücksichtigen.
*
Mit den wesentlichen Grundlagen, die wir bis hierher kennengelernt haben, mit der Kenntnis der Fallstricke, vor allem aber mit dem Wissen um die Beeinflussbarkeit der menschlichen Alterung ausgerüstet, können wir uns nun dem wichtigsten Teil des Buches widmen, der gezielten Beeinflussung unserer Alterung.
II. 1
Altersuhr Gene
„Die sicherste Methode, ein hohes Lebensalter zu erreichen, ist die geschickte Auswahl der Eltern.”
CHRISTOPH WILHELM HUFELAND [deutscher Arzt und Begründer der Makrobiotik, 1762–1836]
Variable Schrittmacher
An der Genetik scheiden sich die Geister. Die einen lehnen genetische Forschung als Eingriff in eine höhere Ordnung ab, andere sehen in diesem Gebiet einen Schlüssel, mit dem sich Krankheiten und auch das Altern besiegen lassen. Schon gibt es Stimmen, die angesichts der Fortschritte in der Grundlagenforschung zur Zellalterung bald eine Lebensspanne von 200 bis 300 Jahren beim Menschen für erreichbar halten. Starke Worte.
Weil dabei große Hoffnungen geweckt werden, möchten wir diesen Forschungsbereich nicht auslassen; auch wenn die Genetik kein Gebiet zu sein scheint, bei dem wir selbst aktiv werden können. Oder doch?
Menschliche Zellen erneuern sich nicht unbegrenzt
Bis vor 50 Jahren herrschte die Lehrmeinung, dass sich Zellen immer wieder teilen und damit erneuern und verjüngen können. Altern und Zelltod galten als eine Folge äußerer Einflüsse.
Entsprechend groß war der Schock, als in den 60er-Jahren ein damals unbekannter Forscher mit Namen Leonard Hayflick aufgrund von Tests behauptete, menschliche Zellen könnten sich nicht unendlich oft teilen, sondern nur in genau begrenzter Häufigkeit. Das Altern wäre somit nicht von äußeren Einflüssen oder einer übergeordneten Macht verursacht, sondern hätte seine festgelegten Ursachen im Erbmaterial der Zellen. Gibt es vielleicht sogar eine zentrale Altersuhr in unseren Genen, die das Leben irgendwann abschaltet? Wir wären jedenfalls nicht die einzigen Lebewesen, die so eine Steuerung besäßen.
Genetische Todesprogramme
Bei vielen Pflanzen und Tieren werden Altern und Tod sehr exakt von genetischen Programmen gesteuert – manchmal auf wirklich eindrucksvolle Art und Weise: Pazifische Lachse etwa sterben kurz nach ihrer ersten und einzigen Eiablage und nachdem riesige Mengen ausgeschütteter Stresshormone eine rasend schnelle Alterung bewirkt haben. Innerhalb weniger Tage entstehen bei den Fischen atherosklerotische Veränderungen und ein altersschwaches Immunsystem. Tintenfischweibchen sind gesund und leistungsfähig, bis sie ihre Brutpflege für die Eier geleistet haben. Unmittelbar nach dem Schlüpfen ihrer Jungen beginnen sie plötzlich im Zeitraffer zu altern und sterben.