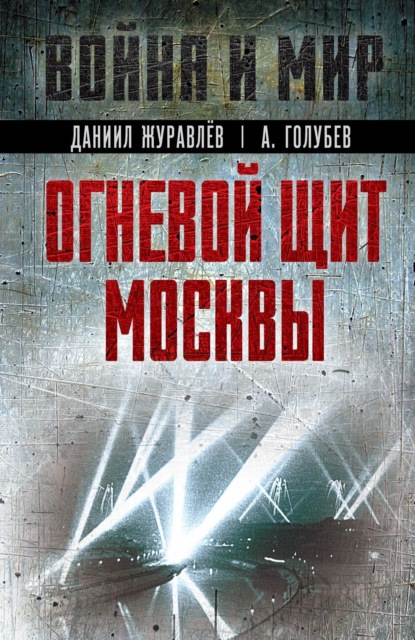- -
- 100%
- +
Nach dem Tod von Ernst Troeltsch veröffentlichte sie 1925 dessen „Glaubenslehre“. Durch die Arbeit an ihrer Mitschrift seiner Vorlesung erkannte Gertrud von le Fort das volle Ausmaß ihrer Beeinflussung durch diesen protestantischen Theologen, Religions- und Kulturphilosophen. In einem Brief an Karel Groensmit schrieb sie später über ihren „Meister“: „Troeltsch hat mich sehr tief beeinflusst, ohne dass ich mir seine liberale Theorie ganz zu eigen machte, denn ich stamme aus einem positiv-gläubigen protestantischen Elternhause. Aber der Reichtum und der Ernst seines Geistes erschlossen mir die Welt des theologischen Denkens überhaupt, die Welt der christlichen Mystik und der christlichen Philosophie und Ethik – allerdings auch die Welt der religiösen Problematik.“4
Es war durchaus kein einmaliger Einfluss, sondern mag als eine stete Herausforderung bezeichnet werden. Im Programm seiner Kulturtheorie definierte Ernst Troeltsch den Theologiebegriff auf drei Ebenen, und zwar als Verhältnis von überkommenem Christentum und moderner Kultur, Verbindung von Wissenschaft und Religion und als Zusammenhang von christlicher Religion und bürgerlicher Gesellschaft. Im Mittelpunkt der Erwägungen stand die Frage nach der Überwindung des Konflikts zwischen dem modernen Bewusstsein zu Beginn des 20. Jahrhunderts und dem christlichen Erbe. Angestrebt wurde dabei die Herausarbeitung eines Begriffs der objektiven Realität der Religion durch ihre erneuerte Integration mit Geschichte und Vernunft.5 Diese Überzeugung übernahm Gertrud von le Fort und schilderte in ihrer Dichtung geschichtliche Vorgänge im Sinne eines metaphysischen Werdeprozesses, den das dialektische Prinzip absoluter Wandlungsfähigkeit in allen Lebensbereichen bei gleichzeitiger Wahrung der eigenen Identität auszeichnet. Die produktive Aufnahme der Einsichten von Troeltsch kann bei ihr unter anderem noch durch die Übernahme der historischen, antidogmatischen Methode festgestellt werden.
Die mit 35 nicht mehr ganz junge Studentin lernte kritisch die Bedingungsfaktoren einer Weltordnung und einer zeitgenössischen Konstellation des Christentums zu reflektieren. Ihrem „Meister“ Troeltsch ist es zu verdanken, dass sie sich von der Fiktion einer geschlossenen christlichen Gesellschaft trennte und die Hinwendung zu einer aufgeschlossenen Glaubensgemeinschaft vollzog. Voraussetzung und gleichzeitig Folge der Verbundenheit mit den Gläubigen war ein ausgesprochener Bekenntnisdrang der Dichterin. Sie erhob einen Anspruch auf geistige Erneuerung ihrer selbst und der Menschheit, wobei ihr in dieser Zeit die im mittelalterlichen römisch-katholischen Grundmodell des Christentums verwurzelte Religiosität zu Hilfe kam. Sie fasste diese Überzeugung folgendermaßen zusammen:
„Die große abendländische Kunst wird nie zu lösen sein von der großen christlich-katholischen Dogmatik, ja sie ist in ihren überzeitlichen Erscheinungen geradezu deren stellvertretende Priesterin. (...) Diese Kunst nicht nur ästhetisch, sondern auch religiös befragen, heißt also mit vollem Bewußtsein den Boden der großen katholischen Dogmatik betreten, das überzeitliche, überpersönliche Fundament, auf dem die gesamte Kultur des Abendlandes ruht und dem sie also auch in der Verneinung noch unentrinnbar verhaftet bleibt.“6
Grundzüge der mittleren Schaffensperiode
Ihre mittlere Schaffensperiode begann 1924 mit der Veröffentlichung der „Hymnen an die Kirche“, mit denen Gertrud von le Fort den Anschluss an die vielfältige geistige Regsamkeit des katholischen Deutschland der 1920er-Jahre herstellt. Seit dieser Zeit kann ihre Dichtung im Vollsinne als „geistlich“ bezeichnet werden. Die Stoffe greifen auf „kirchliches Überlieferungs- und Lehrgut“ zurück7 und ihre Wirkung bewegt sich vornehmlich innerhalb des katholischen Binnenraums. Die „Hymnen an die Kirche“ kennzeichnen eindeutig den intellektuellen und dichterischen Weg Gertrud von le Forts. Einerseits stand sie unter dem Einfluss des französischen „renouveau catholique“ und des literarischen Erneuerungsprogramms von Karl Muth, andererseits war sie berührt vom Kunststreben des christlich orientierten Expressionismus. Sie stand jedoch jenseits der prinzipiellen Auseinandersetzung, welche zu Beginn des 20. Jahrhunderts die katholische Literatur beherrschte. Das Postulat der Schaffung einer katholischen Literatur wird bei ihr zunehmend zu der Frage nach der Möglichkeit einer christlichen Literatur überhaupt. Ein charakteristisches Merkmal der Hymnen ist deren Bildlichkeit, welche die Dichterin größtenteils aus der Poesie ihrer romantischen Vorgänger Joseph von Eichendorff und Clemens Brentano übernahm. Durch die „Romantisierung“ der kirchlichen Wirklichkeit, die Poetisierung des liturgischen Kirchenjahres und die Metaphorisierung des Wahrnehmbaren an der kirchlichen Institution erzielte sie eine bedeutsame Wirkung.
Wenn Gertrud von le Fort, die im Jahre 1926 zum Katholizismus konvertierte, an eine moralische Erneuerung der Gesellschaft dachte, beinhaltete dies für sie ein religiöses Moment, orientiert vor allem an der Lehre der katholischen Kirche. Das kirchliche Selbstverständnis ist in ihren Werken aus der mittleren Schaffensperiode mit theologischer Reflexion verbunden. Der Pluralisierung von Formen christlicher Religiosität entspricht hier die Ausdifferenzierung der le Fortschen Figuren und die Nachgestaltung herkömmlicher christlicher Literaturformen wie Predigt, Katechismus und Kirchenlied. Dass sowohl das lyrische Ich in den „Hymnen an die Kirche“ als auch die Hauptfigur des Romans „Das Schweißtuch der Veronika“ (1928) ein so ausgeprägtes katholisches Sendungsbewusstsein entwickeln, scheint für die geistige Position der Dichterin in den 1920er-Jahren bezeichnend zu sein. Obwohl sich die Autorin von Weihrauch und vom Klang der Kirchenglocken gefangen nehmen ließ, handelt es sich bei ihrer Dichtung jedoch nicht um kirchliche Propaganda. Kennzeichnend für ihre mittlere Schaffensperiode bleibt aber, dass immer dort, wo christliche Ideen und Tendenzen in die le Fortsche Dichtung einflossen, sowohl die Kirche als Trägerin des Glaubens wie auch deren geistliche Repräsentanten hervorgehoben wurden. In der Dichtung aus Gertrud von le Forts mittlerer Schaffensperiode erfuhr ihre „Katholisierung“ der Sprache einen Höhepunkt. In den „Hymnen an die Kirche“ erfolgte diese durch das Hereinnehmen geschlossener Wortfolgen aus der Liturgie und durch die metaphorische Symbolik. Das le Fortsche Verständnis der Apostolizität der katholischen Kirche begrenzte sich dabei nicht ausschließlich auf die Treue gegenüber der Lehre der Apostel und der Tradition, sondern umfasste auch solche Aspekte wie den Blick auf die Eschatologie, wie die kirchliche Identität, die sich an der Teilnahme am sakramentalen Leben manifestiert, und wie das Hineinwachsen in die Gemeinschaft der Gläubigen.
Gertrud von le Fort fühlte sich in ihrem Katholizismus durch die religiöse Situation ihrer Zeit bestärkt und hat sowohl mit ihrer Prosa als auch mit ihrem essayistischen Werk an den Bemühungen um ein neues Verständnis der christlichen Dichtung großen Anteil. Nicht zuletzt wird dies auch in ihren Rezensionen und ihrer Korrespondenz sichtbar. Die Frage nach dem genauen Standort der Autorin innerhalb der katholischen Erneuerungsbewegung der Zwischenkriegsjahre beantwortet zu einem gewissen Teil eine Betrachtung der Periodika, in denen ihre Arbeiten veröffentlicht wurden. Während dieser Zeit veröffentlichte sie ihre Arbeiten unter anderem in den Zeitschriften „Christliche Welt“, „Brenner“ und „Heiliges Feuer“. Insbesondere jedoch war sie in den 1920er- und 30er-Jahren mit der Zeitschrift „Hochland“ durch die Unbedingtheit des Glaubensmomentes und durch die existentielle Grundausrichtung geistig verbunden. Das von Karl Muth dort entworfene Programm der Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiösen Erlebnis machte Gertrud von le Fort zu ihrer dichterischen Motivation.
Ein Grund dafür liegt wohl in der von ihr als vorbildlich empfundenen religiösen Dichtung Eichendorffs, welche der Dichterin selbst zufolge den Ausgangspunkt ihres eigenen Schaffens bildete. Gemeint ist hiermit das Bild eines Dichters, der größte poetische Kraft mit tiefster Religiosität in sich vereinigt. Die Sprache steht im Dienste der Begegnung von Literatur und Religion: Weniger als künstlerischer Selbstzweck wird sie verstanden, vielmehr eher als ein Mittel, das zur möglichst breiten Erreichung des von der Autorin für die Dichtung postulierten Ziels beitragen soll. Gertrud von le Fort wollte zeigen, dass die eigentliche Aufgabe der Dichtung darin besteht, das menschliche Leben transparent werden zu lassen. Die Überlebensmöglichkeit christlicher Literatur aus katholischem Geist liegt nach ihrer Überzeugung darin, „christlich“ und „katholisch“ nicht ausschließlich als „kirchlich“ zu begreifen, sowie in einem universalen Verständnis von Katholizität.
Aus dem moralischen Sendungsbewusstsein der Dichterin ergeben sich ihre ethischen Vorstellungen von Wesen und Aufgabe der christlich-katholischen Literatur. Mit Karl Muth betonte sie die Notwendigkeit der dichterischen Reflexion auf die Hauptaussagen des Christentums als Voraussetzung aller Kunst, mit ihm bleibt sie in ihren ästhetischen Vorstellungen letztlich auch der Klassik und Romantik verbunden. Ihr eigenes Werk seit den „Hymnen an die Kirche“ ist eine gelungene Verbindung von Glaube und Dichtung. In jeder Novelle und in jedem Roman sind Inszenierungen der unterschiedlichsten Formen individueller Religiosität in ihrem Verhältnis zur Institution der Kirche und ihren Vertretern zu finden. Wie bei den französischen Autoren des „renouveau catholique“ nicht primär das literarische Problem einer konfessionellen Dichtung, sondern vor allem die generelle Bemühung um ein modernes, christliches Selbstverständnis eine Gemeinsamkeit begründet, so ist der Zusammenhang zwischen der Dichtung le Forts und der französischen katholischen Dichtung in erster Linie in der Revision aller Grundbegriffe des Lebens gegenüber einem neuen Existenzbewusstsein zu sehen. Ihre bekannteste Novelle, „Die Letzte am Schafott“ (1931) – die nach dem Zweiten Weltkrieg Georges Bernanos zur Vorlage eines Film- und Bühnenszenariums sowie Francis Poulenc zu der eines Opernlibrettos diente –, eine frühe Gestaltung existenzieller Weltangst und ihrer christlichen Überwindung, verweist zugleich auf die Modernität dieser um die Transparenz „ewiger Ordnungen“ bemühten Kunst.
Mit ihrer nach 1924 geschaffenen Prosa erweist sich Gertrud von le Fort als Repräsentantin eines deutschen Katholizismus, die selbstbewusst die kulturelle Anerkennung ihrer neuen Konfession verlangte, ohne diese jedoch über andere Bekenntnisse zu erhöhen. Dies wird insbesondere aus dem Roman „Die Magdeburgische Hochzeit“ (1938) ersichtlich, in dem die Dichterin unter anderem die Auseinandersetzung von Katholiken und Protestanten im 17. Jahrhundert thematisierte, oder aus dem Roman „Der Papst aus dem Ghetto“ (1930), in dem es um das Verhältnis von Judentum und Christentum geht. Zwar war die Dichterin in dieser Zeit noch unerbittlich in der Behauptung, dass nur die katholische Kirche die unverfälschte christliche Wahrheit besitze, trotzdem erkannte sie die Bemühungen anderer Konfessionen an, Leben und Moral der Gläubigen zu stärken.
Von besonderem Einfluss auf ihren Schaffensweg sollte sich für Gertrud von le Fort die Bekanntschaft mit dem Jesuiten Erich Przywara (1889 – 1972) erweisen, den sie 1923 – nach anderer Quelle 19258 – kennenlernte. Przywara, der in seinen Schriften das Erbgut der Kirchenväter und der Mystiker neu durchdachte und in einer neuen Form darbot, verband spekulative Kraft, innig-mystische Frömmigkeit und romantische Lebendigkeit zu einer originalen Synthese. Unter anderem ihm verdankte die Dichterin, dass ihre Dichtung einen „betenden“ und „meditativen“ Charakter hat. Zudem trug er wesentlich zur Würdigung und Verbreitung ihrer Werke bei und unterstützte ihre thematische Auseinandersetzung mit dem Heiligen Römischen Reich. Dem Jesuiten verdankt Gertrud von le Fort auch die sich zu einer Freundschaft entwickelnde Bekanntschaft mit der Philosophin und späteren Karmelitin Edith Stein (1891 – 1942), welche für beide Frauen prägend gewesen zu sein scheint. Gertrud von le Fort erinnerte sich an ihre erste Begegnung mit ihr 1932 in München mit den folgenden Worten:
„Ich lernte Edith Stein durch die Vermittlung des hochwürdigen Paters Erich Przywara kennen. (...) Wir trafen uns in München und diese Begegnung hinterließ bei mir den tiefsten Eindruck, der sowohl die Frömmigkeit, die bezaubernde Schlichtheit und Bescheidenheit als die hohe geistige Begabung der damaligen Dozentin von Münster betraf. Diese Eindrücke waren so tief, daß sie mein Buch ,Die Ewige Frau‘ wesentlich beeinflußt hat, d. h. nicht durch Mitarbeit vonseiten Edith Steins, sondern durch innerliche auf jene Begegnung zurückgehend. (...) Ich rief mir bei der Arbeit oftmals Edith Steins geistiges Bild zurück als solches, wie es nur bei meiner Darstellung einer wahrhaft christlichen Frau vorgeschwebt hatte.“9
Die Bekanntschaft mit Gertrud von le Fort hat auch bei Edith Stein tiefe Spuren hinterlassen. Ein Jahr vor ihrem Eintritt ins Kloster schlug sie Sr. Callista Kopf vor, im Deutschunterricht unter anderem Werke von le Fort durchzunehmen: den historisch-legendenhaften Roman „Der Papst aus dem Ghetto“ und den in der Gegenwart spielenden Erziehungsroman „Das Schweißtuch der Veronika“.10 Die wohl größte geistige Gemeinsamkeit zwischen beiden Frauen bestand in der Tatsache, dass sie Richtschnur und Auftrag für ihre Arbeit aus der Bibel empfangen haben. Wilhelm Grenzmann hebt bei Gertrud von le Fort die drei Motivkreise Kirche, Reich (das sacrum imperium des Mittelalters) und Frau hervor.11 Diese sind auch Edith Stein sehr wichtig gewesen. Die Motivkreise sind bei Gertrud von le Fort nicht als chronologische Abfolge zu sehen, sondern bilden eine ineinander verschlungene Thematik, welche die Dichterin ihr Leben lang begleitete.
Ihre Werke artikulieren einige wesentliche Aspekte des weiblichen Erfahrungsbereiches und geben eine klare Vorstellung dessen, was sie damit anstrebte. Das von ihr gezeichnete „neue“ Frauenbild war tatsächlich nicht radikal neu. Es ist eher als eine Neuakzentuierung zu interpretieren gegenüber dem Frauenbild der Moderne im Allgemeinen und dem Bild der „Neuen Frau“ der Weimarer Republik im Besonderen. Das Leben in den 1920er-Jahren wurde von dem Modell der Frau beherrscht, die ihre Selbstständigkeit anstrebte, das Recht auf freie Sexualität proklamierte und sich durch wissenschaftlichen Ehrgeiz auszeichnete.12 Auch wenn Gertrud von le Fort gewisse Veränderungen befürwortete, blieben ihre Auffassungen zum Wesen und zur Rolle der Frau dennoch traditionell geprägt. Die Situation zwischen Mann und Frau war bei ihr eine grundlegend andere als bei den modernen und gern gelesenen Autorinnen der Weimarer Republik. Nicht die einseitige Sehnsucht nach Emanzipation, sondern nach der Anerkennung der Gleichwertigkeit bestimmt hier das Verhältnis der Geschlechter. Sie beabsichtigte mit ihren Werken keine moralische Revolution. Sie betonte andere Kräfte, wie etwa die Liebesfähigkeit, und stellte diese in ihrem Frauenbild heraus. Diese im Vergleich zu dem Frauenbild der 1920er-Jahre auf den ersten Blick „regressive“ Festlegung der Frau auf ihre gefühlsmäßige und „liebende“ Natur schließt Fragen nach dem Wesen und Wert der Frau nicht aus. Ganz im Gegenteil: Die le Fortsche Suche nach einer wahren Menschlichkeit der Frau brachte im Endeffekt deren Darstellung als vollwertiges Wesen, dem mit seiner Kraft zur Verzeihung und zur Gewaltlosigkeit gleichsam eine Erlöserrolle zugeschrieben wird. Ihre Protagonistinnen sind meist starke Gestalten, die mit viel Energie ihre Selbstverwirklichung anstreben. Sie können jedoch trotz ihrer Fähigkeit, progressive und traditionelle Aspekte im Leben zu integrieren, nicht als „Superfrauen“ bezeichnet werden. Ganz gewiss jedoch kritisieren sie das Konzept einer aggressiven, „einseitigen und übersteigerten Männlichkeit“.
Respektierung unterschiedlicher Glaubensformen
Durch ein intensives Leben in und mit der Kirche sowie eindringliche Beschäftigung mit der christlichen Thematik gelangte Gertrud von le Fort in ihrem zwischen 1945 und 1968 entstandenen Spätwerk zu einer neuen Tiefenschau. Sie fasste Dichtung nun nicht nur als eine Art moralischen Engagements auf, wie dies insbesondere in der mittleren Schaffensperiode der Fall war, sondern grundlegend als metaphysische Betrachtung der Seins- und Gottesfrage bezüglich der Aktualität von Glaube und Religion. Dem veränderten Selbstverständnis der Nachkriegsgeneration entsprechend, entwickelte sie jenen theologisch-religiösen Personalismus weiter, der sich von Anfang an wie ein roter Faden durch ihr Gesamtwerk zieht. Ihre literarischen Arbeiten bejahen das Lebens in all seinen irdischen und geistigen Formen.
Mit ihnen trat sie hervor als eine traditionsgebundene Repräsentantin der Moderne des 20. Jahrhunderts und dessen existenzieller und transzendentaler Sinnsuche im Zeitalter einer sich rasant entwickelnden Technologie. Die konfessionellen Aspekte verloren mit der Zeit an Bedeutung. Viel deutlicher ist in dieser Phase die Betonung der Liebe Christi und seiner Gnade für alle, welche in ihrem Leben nach Wahrheit suchen. Mit anderen Worten: Von Christus aus fällt Licht in Fülle auf alle Lebensbereiche und alle Menschen, wobei die Wirksamkeit dieser Ausstrahlung von deren Aufnahmebereitschaft abhängig ist. Dies ist unter anderem wiederum auch aus der le Fortschen Korrespondenz ersichtlich, die freilich mit sehr unterschiedlicher Intensität und Thematik geführt wurde. Im Vordergrund stand meist das Literarische in seinen praktischen Aspekten (Verlage, Übersetzungen). Bemerkbar ist hier jedoch auch die ständige Suche nach einer richtigen Aussage und dem Gehalt der Dichtung, wobei dieses „Tasten“ nun weniger auf die Sicherheit des Dogmas gerichtet war. In ihrer Dichtung suchte sie meist einen passenden Mittelweg zwischen einem allzu engen Konfessionalismus und völliger Offenheit.
Nach Gertrud von le Fort vermeidet das Zentrum die gegensätzlichen Extreme bei der Entwicklung der eigenen Identität. Diese Identität wird von der Autorin in vertrauten Mustern und Formen des Christentums gesucht. Die Begriffe Umkehr und Identität verwendet sie sowohl in ekklesialer Hinsicht, das kirchliche Leben betreffend, als auch in ekklesiologischer Hinsicht, das heißt die Reflexion über das kirchliche Leben betreffend. Stets hebt sie die Notwendigkeit der ständigen Bekehrung der christlichen Gemeinschaft hervor. Mit ihren Spätwerken tritt sie für eine „evangelische Katholizität“ ein, welche die historisch und dem Wesen nach unterschiedlichen Lebens- und Glaubensformen respektiert. „Evangelische Katholizität“ drückte nach Gertrud von le Fort aus, dass den verschiedenen kirchlichen Gestalten eine christliche Einheit zugrunde liegt, wie sie dies insbesondere in den Novellen „Am Tor des Himmels“ (1954) – deren zentrales Thema die zerstörerische Kraft des Atomzeitalters ist – und „Der Dom“ (1968), ihrer letzten, veranschaulichte. Sie sah dabei mit Scharfblick die Gefahren voraus, welche eine bloß formale religiöse „Orthodoxie“ und moralische Gesetzlichkeit mit sich bringen können. Diese schaden der geistigen Entwicklung des Menschen und verhindern somit eine überzeugte Annahme des Heils, das sie mit dem „Kommen des Reiches Gottes“ identifizierte.
Während dieser Zeit kam das „protestantische Erbe“ der Dichterin in ihren Werken stärker zum Vorschein. Wichtiger als dogmatische Konfessionalität schien ihr die Suche nach Wahrheit und Sinn in der säkularisierten Welt zu sein. Es lässt sich demnach eine Entwicklung in Gertrud von le Forts Denken verfolgen: Nach der Akzentuierung des Katholischen in ihrer Dichtung trat dieses zugunsten einer „Erkenntnis der universellen Wahrheit“ zurück. Festzustellen ist dabei, dass Christentum und Kirchlichkeit bei le Fort nicht mehr deckungsgleiche Größen sind, sondern die Letztere macht für sie nur einen Teil des Ersten aus in der Überzeugung, dass sich das Christentum nicht in der Kirchlichkeit erschöpft. Le Fort als Dichterin wurde zunehmend offener und befreite sich von Berührungsängsten und „Ghettomentalität“. Beispielhaft zeigt dies bereits die durchaus kontroverse Aufnahme ihres Nachkriegsromans „Der Kranz der Engel“ in der katholischen Leserschaft.13
Die unkonventionelle Haltung der Dichterin bewährte sich in ihrem Christentum stets aufs Neue und knüpfte an die Idee der ökumenischen Versöhnung der Christen an. Keineswegs bedeutet dies jedoch, dass die Grenzen der Katholizität bei Gertrud von le Fort während dieser Zeit verschwanden oder dass sie sich von der kirchenchristlichen Tradition abwandte. Es kann auch nicht vom Weg zu einer neuen Form der Religion im Leben und Spätwerk der Dichterin die Rede sein, wie dies etwa bei Luise Rinser, mit welcher le Fort in den Nachkriegsjahren korrespondierte, der Fall war. Zwischen der Neubelebung des christlichen Glaubens infolge des Zweiten Vatikanischen Konzils und der entsprechenden weltanschaulichen Entwicklung Gertrud von le Forts besteht ein enger Zusammenhang. Wohl kaum ein anderer deutscher Autor setzte sich so intensiv wie sie mit dem durch das Konzil ausgelösten Wandel in Theologie, Exegese, Verkündigung und Gemeindeleben auseinander. Was noch viel wichtiger ist: Noch vor der Wende des Vaticanum Secundum legte sie die Scheuklappen einer veralteten, rechthaberischen Orthodoxie ab. Davon berührt ist auch ein neues Verständnis der katholischen Liturgie, wie sie, getragen von der Frage nach dem Verhältnis zwischen objektiver Heilsgeschichte und individuellem Heilsgeschehen, zunächst innerhalb der Liturgischen Bewegung neu definiert wurde. Mit gemischten Gefühlen begrüßte Gertrud von le Fort jedoch das Verschwinden des Lateins in der katholischen Liturgie, weil „das Credo in ihr [= der lateinischen Sprache] eine in keiner [anderen] Sprache wiederzugebende Macht hat“ und dadurch „sogar in der Fremde ein Heimatgefühl“ geweckt wird.14 Mit ähnlicher Besorgnis begegnete sie dem Beschluss eines Münchener Kardinals, auf die Barockmusik im Gottesdienst zu verzichten.15
Dichtung als Antwort
Der dichterische Weg Gertrud von le Forts in die „religiös-metaphysische“ Existenz mit stark ausgeprägtem Geschichtsbewusstsein muss vor allem vor dem Hintergrund der christlichen Tradition gesehen werden. Die Katholische Bewegung des 19. Jahrhunderts zeigte ihr die Möglichkeit einer allegorisch-politischen Deutung und eine enge Verbindung zwischen tiefster Innerlichkeit und engagiertem Handeln in der Welt. Die christliche Autorin betrachtete die dichterische Tätigkeit als eine Art der Neubegründung der Humanität und die Dichtung selbst als eine „vermittelnde Aufgabe“. Sie betonte immer wieder die mannigfache Wechselbeziehung zwischen der deutschen Dichtung und der christlichen Religion in Form eines gegenseitigen Einflusses, der kontinuierlich vom Mittelalter bis zu der der Romantik gereicht habe. Auf diese Weise knüpfte sie auch an die Geschichtsauffassung Ernst Troeltschs an, der in seinen Schriften das Christentum mit allen Errungenschaften der Philosophie und Kultur zu vereinigen suchte, um dadurch unter anderem das neue Antlitz des Christentums mitzuformen. Bei der Dichterin war jedoch weder eine heimliche „Rückkehr zum Mittelalter“ beabsichtigt, noch eine geschichtsphilosophische Romantik, die darauf abzielte, die religiöse und kulturelle Entwicklung des Abendlandes einer bestimmten Epoche als absoluten Höhepunkt künstlich festzulegen. Im Geleitwort zum Essay „Vom Paradox des Christentums“ (1952) von Graham Greene legte Gertrud von le Fort ihr Verständnis von der wahren christlichen Dichtung dar. Diese ist von den Schablonen bürgerlicher Moral ebenso wie denen einer engherzigen Moraltheologie befreit, ist dem Staat und der Gesellschaft gegenüber nicht folgsam und sympathisiert mit menschlicher Schwäche, ja Fragwürdigkeit.16 In der Erfüllung dieser Aufgabe veröffentlichte Gertrud von le Fort u. a. auch ihre „Aufzeichnungen und Erinnerungen“ (1951) oder Essays wie „Die Frau und die Technik“ (1959) und „Woran ich glaube“ (1968). Darüber hinaus schuf sie in dieser Zeit eine Reihe von Werken, in denen sie tradierte religiöse Inhalte im Sinne einer schöpferischen Restauration bearbeitete. Zu ihnen gehören unter anderem die Novellen „Die Consolata“ (1947), „Der Turm der Beständigkeit“ (1957) und „Das fremde Kind“ (1961).
Gertrud von le Fort trat in ihrer Dichtung den säkularisierenden Tendenzen in der Lebenswelt und Kultur der Nachkriegszeit mit Bedenken entgegen. Die Säkularisierungswelle führte ihrer Meinung nach zum Verlust wesentlicher Inhalte, unter anderem zur Verweltlichung der christlich-kirchlichen Tradition, welche das europäische Selbstverständnis seit Jahrhunderten tief geprägt habe. Das Verständnis der Säkularisierung als problematische Transformation steht bei Gertrud von le Fort mit der Beobachtung von Verlusten im engen Zusammenhang. Vor dem Hintergrund einer kritische Einstellung gegenüber der eigenen Zeit drückte sie das Bemühen um christliche Selbstbesinnung und um eine christliche Durchdringung des Lebens aus, wobei sie sich eben hinsichtlich ihres Verhältnisses zur Kirche eigensinniger als in der Zwischenkriegszeit zeigte. Ihre Loyalität jedoch war ungebrochen. Mit der Legende „Das Schweigen“ verteidigte die bereits 91-jährige Autorin 1967 Papst Pius XII. gegen den Vorwurf des Versagens angesichts der Judenverfolgungen im Dritten Reich (wo sie übrigens selbst als Verfasserin unerwünschter Texte galt). Unmittelbarer Anlass für dieses Werk war das Drama „Der Stellvertreter“ (1963) von Rolf Hochhuth.