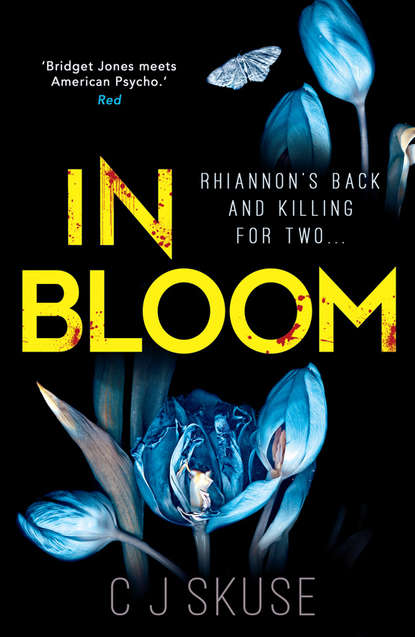- -
- 100%
- +
Ähnlich wie bei der Droste werden auch bei Konrad Weiß Naturgedicht und geistliches Gedicht eins, denn die Natur ist für ihn transparent für die geistige Wirklichkeit. Beide, Natur und Geist, haben zwar ihr Eigengewicht, aber sie stehen zueinander in einem Gleichgewicht. Ja, die inneren Kämpfe um Dasein und Leben treten in der Natur nach außen und nehmen dort eine fassbare Gestalt an. Dies erkennt, wer seinen Blick auf das Einzelne lenkt. Nicht das Gesamtgefüge, sondern die einzelnen Dinge lassen den Menschen die in ihnen verborgene geistliche Wirklichkeit der Schöpfung erkennen.
In der äußeren Wirklichkeit lernt der Mensch, die geistigen Tiefenschichten seines Lebens zu erfassen. Im Umgang mit den Dingen des Lebens und der Natur erschließt sich ihm zunehmend seine eigene innere Wirklichkeit und Befindlichkeit; so wird er bereit, sich immer mehr in den eigenen inneren Kern führen zu lassen. Dabei brechen in ihm die Erfahrungen seiner Ohnmacht und des Leidens auf, gepeinigt von heftigem Sehnsuchtsverlangen. Konrad Weiß erfährt als christlicher Dichter die Natur aus der Seele, nicht umgekehrt die Seele aus der Natur. Diese kann nicht das Letzte sein, denn sie kann den Menschen nicht erlösen und befreien. Der Mensch ist also nicht wie bei den Romantikern ein Objekt bzw. Opfer der Natur, in Bann genommen von ihrer Macht und Mächtigkeit. Für Konrad Weiß ist die Natur ein Teil des Menschen selbst: „Diese ganze Kreatur ist im Menschen, ja vielmehr ist der Mensch.“31
Die Natur ist durch den Menschen empfangend, nicht aber wirkend, sie ist unser Widerhall. Da die Vollendung des Einzelnen sich nur in der Gemeinschaft mit dem Menschgewordenen ereignet, vollendet sich die Natur als Teil des Menschen durch diese Gemeinschaft und darin wieder durch die Kirche. Nur in Maria ist die Natur eine heile, sie ist das Urbild des „jungfräulichen Inbildes“ der Geschichte, wo die Kirche reine Braut des Wortes ist.
In der Moderne ist die Bild- und Wortform der Kreatur gebrochener, doch im Echo schwingender, wie Konrad Weiß am Werk Vincent van Goghs darzustellen weiß. Es scheint, dass, je mehr der Mensch gegenwärtig bereit ist, sich die geschichtlichen Sinnkräfte anzueignen, er auch erkennen muss, dass sein Leben nicht ohne Tragik gelingen kann.
So muss sich der Mensch von Wort zu Wort und von Bild zu Bild begeben, ohne je einen als ideal erfassten Stand der Vollkommenheit zu erreichen; alles im Dasein auf Erden scheint zwischen Sehen und Hören nicht mehr aufzugehen:
„Tue in allem das Gegenteil und das Gegenteil des Gegenteils. Dies ist das Geheimnis des Schattens und des Lichtes. Denn so groß ist kein Mangel wie Gottes Ankunft und du bist immer noch zu viel.“32
Gebunden an seine Urbeschränkungen, besonders die von Zeit und Raum, und angeschmiedet an die Erde und ihre Gezeiten, wird der Mensch lernen müssen, den Zwang des Geschicks als seine große Möglichkeit zu ergreifen. Den Mangel aushaltend, hat er die Begrenzung zu bejahen, die sein Dasein ist und die er nicht verspielen darf.
Erfüllung des Weges
Die Kreatur ist und bleibt „geteilt“ („dividuum“). Sie findet ihre Ergänzung und letzte Erfüllung nur, wenn jede eigenwillige Erkenntnis zerbricht und der Mensch bereit wird, sich in erneuerter Erkenntnis zu empfangen. Selbst die christlichen „Begriffe“ machen nicht satt, sondern hungrig, weil sie in sich selbst gespalten bleiben. So erscheint die Welt wie geteilt in ihrem letzten und tiefsten Grund; mit sich selbst uneins, bleibt sie reiner Mangel.
Nicht anders verläuft für Konrad Weiß der Weg zur Wahrheit menschlichen Lebens. Sie lässt sich nicht wie ein Begriff oder System in der Lehre der Universität, nicht idealistisch erfassen, sondern nur geschichtlich, beladen mit aller Not und Schicksalhaftigkeit der Geschichte und ihrer Stunde. Er will nicht aus den Geschehnissen zeitlose Ideen retten, sondern sich dem großen Mitleiden der Zeit hingeben, beladen mit ihrer Not. Sein Denken wendet sich bewusst von aller Idealität ab, um sich ganz der Sprache der Inkarnation zu verschwören. Im Leben des Glaubens geht es um gestalthafte Ausprägung jenes in der Geschichte offenbar gewordenen In-Bildes,33 wie es im Menschensohn sichtbar geworden ist. Den Weg dahin beschreibt Konrad Weiß in seiner „Cumäischen Sibylle“. Der Mensch kann das im Paradies verlorene göttliche Bild niemals durch eigenes Wollen wiederherstellen; steigt er aber vom Berg seiner Selbstherrlichkeit herab in die dienende Demut des kreatürlichen Geistes, wird er alles in seinem Dasein „filioque vermittelt“ erfahren und empfangen.34
Hier wird nochmals deutlich, warum Konrad Weiß das scholastische Denken und seine Vorstellung vom Leben im Glauben ablehnen muss, denn die Schultheologie stellt alles unter das Gesetz der „Analogie“, also eines Verhältnisdenkens, das den Abstand, den es unmittelbar zwischen Schöpfer und Geschöpf gesetzt sieht, nur moralisch zu überbrücken versteht. Heißt es in der Heiligen Schrift: „Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist!“, so meint die Scholastik, dies sei auf „analoge“ Weise zu verstehen, da der Mensch nur auf begrenzte Weise vollkommen werden könne; allein der Vater im Himmel ist vollkommen. Aber ein solches Denken, das meist in dem moralischen Appell endet: „Strengt euch an, damit ihr vollkommener werdet!“, nimmt die irdische Kreatur nicht derart ernst, wie der Schöpfer aller Dinge sie offensichtlich ernst genommen hat, da er ein solches Wort sagt. Seine Weisung: „Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist!“ will zum Stachel der leidenschaftlichsten, „neidvollen“ Form irdischer Existenz werden. Nun sieht sich der Mensch unmittelbar in Vergleich, in „Komparation“ gesetzt zu jenem, der ihn an seiner Vollkommenheit teilhaben lässt. Im Prosatext „Dunkel des Blutes“ führt Konrad Weiß zu diesem „Gesetz der Komparation“ aus:
„,Lebe aus deiner geringsten Kraft.‘ Erkenne das Tun des Blutes; es hat keine Wahl im Geiste, sondern nur in der Erfüllung des Weges. Das Wort und das Blut bilden eine nahtlose Fügung. Empfangen durch das Auge im stummen Vorübergang des Wesens wird das Menschliche abgetrennt, um seine Ausgeburt im Dunkel zu vollbringen. Durch Schwere steigt das Dunkel im Lichte. Rettung liegt in allen Dingen und in der Kraft ihrer Namen. Aber nichts wird erkannt, bevor ihm nicht die Tat des Blutes gedient hat. Es ist Abtrennung. Erkenne diese Macht, der Reinheit zuvorzukommen. Aber die Treue bricht den Weg in meine Maße.“35
Ein Geschichtsverständnis, wie es sich in der Kunst und erst recht im Leben des Glaubens darstellt, hat seine eigene „Logik“. Selbst die Geschicke der Völker, die scheinbar fern jeder göttlichen Weisung verlaufen, dienen in allen ihren Phasen der Geschichte der Offenbarung und entfalten auf „logische“ Weise das menschgewordene Wort. Denn die Geschichte geschieht nicht wie in einem abstrakten Begriff oder einer absoluten Idee, sondern in jenem „Gethsemane“, das einen Tod zum Inhalt hat.
Schöpfung und Geschichte im Symbol
In einer letzten Überlegung soll es um den Ertrag des Werkes von Konrad Weiß gehen. Vielfach hat man gegen Konrad Weiß und seinen Sprachstil den Vorwurf der Dunkelheit erhoben, ohne zu bemerken, dass seine Dunkelheit weder einem künstlerischen Unvermögen noch – wie etwa bei Mallarmé oder George – einem bewussten Willen zum streng Hermetischen und Esoterischen entspringt. Gewiss, der Dichter hat sich bewusst vom theologischen „Geschäft“ abgewandt, doch Zeit seines Lebens beschäftigt ihn der Glaube und seine Verheutigung. Es finden sich bei Konrad Weiß zahlreiche Parallelen zu dem englischen Jesuiten und Dichter Gerard Manley Hopkins wie auch zu Johannes Duns Scotus. Konrad Weiß schlägt nämlich einen ähnlichen Weg ein, wie ihn Duns Scotus und Hopkins vorzeichnen. Letzterer bedenkt im Individuellen und Einzelnen das Einzigartige. So gibt er in seinen Tagebucheintragungen und Zeichnungen mit feinsten Federstrichen zuweilen nur eine einzelne Blüte wieder oder ein Architekturelement eines gotischen Fensterbogens mit allen noch so kleinen Details.36 Denn der kreatürliche Rest, der nicht zu verrechnen und zu begreifen ist, ist das unveräußerliche Bild Gottes, das jedem Ding innewohnt. Es kommt dem Menschen nicht zu, aus eigener Idee etwas machen und sein Leben meistern zu wollen, es wäre unecht und bliebe letztlich unwirklich. In aller Unvollkommenheit menschlichen Lebens gilt es vielmehr, Gottes verborgenen Plan in der Geschichte und im eigenen Leben zu erfragen und in Übereinstimmung mit ihm das eigene Dasein anzunehmen und zu gestalten.
Die Schwierigkeit bei der Entschlüsselung der Geschichte ergibt sich aus der Tatsache, dass die Ereignisse und Erfahrungen des Lebens, auf ihre tiefere Bedeutung befragt, sich nicht wiederum in einer metaphysischen oder rein scholastischen Theorie „auf den Begriff“ bringen lassen. Die einzig mögliche Antwort findet sich im Leben und Leiden des neuen Menschen, der die ganze Menschheit in seinem Dasein angenommen hat und mit ihr vom Vater verherrlicht wurde.
Die Schönheit, wie sie in den Dingen des Lebens sichtbar wird, ist nicht ästhetischer, sondern geschichtlicher, ja existenzieller Natur. Der Mensch hat den Auftrag, in seinem Leben das Übermaß göttlicher Liebe und Schönheit leibhaft auszubuchstabieren.
Dieses Verständnis von Schönheit, das Konrad Weiß in seinen zahlreichen Studien zur abendländischen Kunst ausbuchstabiert, bringt ihn – teils unmittelbar angezielt – in die Auseinandersetzung mit der philosophischen Ästhetik und ihre Frage nach der „Wahrheit“ der Kunst.37 „Schönheit ist eine Weise, wie Wahrheit west“, heißt es bei Martin Heidegger. Er wie auch sein Kritiker Theodor W. Adorno interpretieren die Kunst als einen ausgezeichneten oder sogar den ausschließlichen Ort der „Offenbarung“ von Wahrheit (Heidegger) und „Versöhnung“ (Adorno). Während Ernst Bloch die Kunst als „Vor-Schein“ des Kommenden auslegt, versteht sie Adorno als „das Versprechen des Glücks, das gebrochen wird“; er siedelt die Kunst „im Garten Gethsemane“ an, weil die „Passion“ ein zentrales Thema jeder Ästhetik darstellt. Der im Garten Gethsemane leidende Jesus von Nazareth ist kein „Kunstwerk“ – weder eine klassische Statue des leidenden Menschen noch ein Werk atonaler Musik –, sondern ein konkreter Mensch aus Fleisch und Blut, der von den anderen verlassen wird und in die äußerste Zerreißprobe des Vertrauens und der Todesangst gerät. Der „Schönste unter den Menschenkindern“ (vgl. Ps 45,3) hat eben „keine schöne und edle Gestalt“ (vgl. Jes 53,2). So gehört die christliche Ästhetik, wie Erich Przywara betont, zwischen „Viehtrog“ und „Kreuz-Galgen“.38 Alle Schönheit buchstabiert sich nach Konrad Weiß in geschichtlicher Gebrochenheit aus, und darin liegt ihr wahrer „Glanz“. Konrad Weiß sieht in der Geschichte – trotz und mit ihrer Tragik – einen tieferen Sinn, nämlich im Symbol. Um Konrad Weiß mit dem ihm Eigenen in seiner theologischen Ausdeutung von Zeit und Geschichte zu erfassen, seien nur zwei kurze Gegenbeispiele angeführt. Für Kant ist das Historische „etwas ganz Gleichgültiges, mit dem man es halten kann, wie man will“;39 nicht anders heißt es bei Fichte: „Nur das Metaphysische, keineswegs aber das Historische macht selig, das letzte macht nur verständig“.40 Für Konrad Weiß hingegen erhält die Geschichte ihren letzten und tiefsten Sinn durch den Eintritt des Menschensohnes in die Zeit. In ihm zeigt sich, dass die Geschichte mehr ist als ein äußerer Ablauf einzelner Fakten, Geschehnisse und Daten; sie enthält einen Anteil Gottes. Dieser aber bewirkt eine Art Folgerichtigkeit von Schuld und Gnade, von Sünde und Erbarmen, und jede verleugnete und verschleierte Schuld ist ein Wegsehen vom Angebot göttlichen Erbarmens. Aus aller Schuld kann Gnade werden; vielleicht kann und darf darum überhaupt so viel Schuld in der Welt sein.
Mit dieser theologischen Ausdeutung von Zeit und Geschichte trifft sich Konrad Weiß in vielem mit dem Werk und Anliegen Reinhold Schneiders. Beide entfalten eine Geschichtstheologie, die sich als „Geschichte im Symbol“ bestimmen lässt. Das überzeugendste Ordnungsprinzip menschlichen Daseins erkennen Konrad Weiß wie Reinhold Schneider im Glauben: „Geschichte ist eine Frage; die Antwort kann der nur geben, der ihr zum Herrn gesetzt ist.“41 Die Botschaft Jesu richtet sich nicht bloß auf das Heil der Seele. Sein Leben vollzieht sich mitten in der Welt, auf dass künftig alles Leben aus dem Geschenk des Heiles sich bewahrheitet im Mitvollzug der Geschichte. Um die geschichtliche Wirkmächtigkeit Christi und des Glaubens recht zu erfassen und zu deuten, wendet sich Konrad Weiß – wie Reinhold Schneider – immer wieder bewusst der konkreten Geschichte mit ihren teils tragischen Abläufen zu.
Die Geschichte ist Urform menschlicher Existenz. Nur in der Geschichte kann der Mensch sich und die Welt erfahren und sein Leben meistern. Das ganze Wesen des Menschen ist unmittelbar mit der Geschichte verbunden, ja, sie ereignet sich in ihm selbst: „Es gibt keine Grenze zwischen Geschichtlichem und Subjektivem (...) Die Zeit ereignet sich in uns. Darum müssen wir sie als unsere eigenste Sache verantworten.“42 In Verantwortung und Entscheidung gerufen, muss sich der Mensch mit seinem Leben in der Geschichte bewähren; nur so kann er zu sich und seinem eigenen, tiefsten Wesen vordringen: Er selbst muss die Zusammenhänge verantwortlich wählen und sie als Auftrag vollziehen. Dieses Muss ist der Kern der Person.
Sinn und Bedeutung der Geschichte erkennen Konrad Weiß und Reinhold Schneider darin, dass sich in ihr das Drama des menschgewordenen Gottes in der Welt vollzieht. Der Lebensweg Jesu verläuft nicht einfach in Übereinstimmung mit den Plausibilitäten der Gesellschaft und der Welt, doch steigt der Menschensohn aus der Welt und ihrer Geschichte nicht aus: Christus hat den Leib des Menschen angenommen, das heißt, er hat sich zur Geschichte entschlossen, selbst wenn er am Kreuz scheitern wird. Die Botschaft von jener Erlösung, die nicht von der Welt ausgegangen ist, scheitert in der Welt, aber die Welt scheitert auch an ihr. Dass die Geschichte nicht im Fragmentarischen tragisch scheitert, wird nur nachvollziehbar im Glauben an die Auferstehung:
„Denn so groß ist kein Mangel wie Gottes Ankunft ...“43
Schriften von Konrad Weiß: Gedichte 1914 – 1939. Hg. v. Friedhelm Kemp. München 1961 – Prosadichtungen. München 1948 – Tantum dic verbo. Gedichte. Leipzig 1919 – Zum geschichtlichen Gethsemane. Gesammelte Versuche. Mainz 1919 – Die cumäische Sybille. München 1921 – Die kleine Schöpfung. München 1926 – Das gegenwärtige Problem der Gotik. Mit Nachgedanken über das bürgerliche Kunstproblem. Augsburg 1927 – Die Löwin. Vier Begegnungen. Augsburg 1928 – Das Herz des Wortes. Gedichte. Augsburg 1929 – Tantalus. Augsburg 1929 – Der christliche Epimetheus. Berlin 1933 – Konradin von Hohenstaufen. Ein Trauerspiel. Leizig 1938 – Das Sinnreich der Erde. Gedichte. Leipzig 1939 – Deutschlands Morgenspiegel. Ein Reisebuch in zwei Teilen. 2 Bde. München 1950 – Das kaiserliche Liebesgespräch. München 1951 – Die eherne Schlange und andere kleine Prosa. Hg. v. Friedhelm Kemp. Marbach a. N. 1990.
Sekundärliteratur: Hanns-Peter Holl: Bild und Wort. Studien zu Konrad Weiß. Berlin 1979 – Friedhelm Kemp/Karl Neuwirth (Bearb.): Der Dichter Konrad Weiß, 1880 – 1940. Marbach a. N. 32001 – Carl Franz Müller: Konrad Weiß. Dichter und Denker des „Geschichtlichen Gethsemane“. Freiburg/Schweiz 1965 – Wilhelm Nyssen (Hg.): „... und ganz aus Echo lebend ist mein Leben“. Akademie zum 100. Geburtstag des Dichters Konrad Weiß (1880 – 1940). Köln 1983 – Michael Schneider: Konrad Weiß (1880 – 1940). Zum schöpfungs- und geschichtstheologischen Ansatz im Werk des schwäbischen Dichters. Köln 2007 – Ludo Verbeeck: Konrad Weiss. Weltbild und Dichtung. Tübingen 1970.
Joseph Bernhart (1881 – 1969)
Joseph Bernhart
Die Krisis menschlichen Handelns und der Geschichte
Rainer Bendel
„Man sagt, die wichtigsten Fragen seien die vergeblichsten, und meint, man sollte sie deshalb aufgeben. Sagen wir lieber umgekehrt, daß die vergeblichsten Fragen, wie die nach dem Menschen und nach Gott, die wichtigsten sind, was alsdann so zu verstehen wäre, daß es von unendlicher Wichtigkeit ist, nicht aufzuhören zu fragen, so wichtig wie die Unendlichkeit selbst, mit der wir uns der wahren Lebensluft beraubten, wenn sie unser Fragen, gerade unser vergebliches Fragen nicht mehr beschäftigte. Ist dieses Fragenmüssen ins Vergebliche nicht die großartigste, über alles menschenwürdige Antwort auf unser Fragen? Die docta ignorantia ist gelehrte, aber auch belehrte Unwissenheit.“1
Diese Notwendigkeit, Fragen zu stellen, macht den katholischen Intellektuellen Joseph Bernhart zum Wegweiser in eine neue Zeit, deren Signum das Finden neuer Paradigmen ist, die das Profil schärfen, die aber auch das Wissen um und die Intention zur Integration haben: Der Intellektuelle will sich einbringen in die wissenschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Debatten, in die religiösen Suchbewegungen der Zeitgenossen. Er versucht Antworten aus dem reichen Fundus christlicher Traditionen und erschüttert mit seinen Fragen manche gesellschaftlichen und religiösen Fassaden und Zwänge. Er will damit die Menschen hinweisen auf den tieferen, den inneren, den größeren Zusammenhang: das Humanum, die Catholica. Der Intellektuelle erscheint hier als Prophet, als Kritiker, als Mahner, Deuter und Wegweiser in den Suchbewegungen, in den Umbrüchen und Aufbrüchen, in den Katastrophen des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts.
Die ersten Suchbewegungen des jungen Seelsorgers zielten auf Wege aus der ,kulturellen Inferiorität‘ der Katholiken im Bismarckreich; die partielle Ausgrenzung empfand Bernhart schmerzlich. Rückzug in das eigene Milieu, Ghettoisierung waren für ihn keine akzeptable Antwort. Aufbruch und Ausbruch, Anregung und Austausch suchte er in diesem Klima in erster Linie im Umfeld der Zeitschrift „Hochland“. Während seines Studiums der katholischen Theologie von 1900 bis 1904 in München hatte er diese Öffnung und Offenheit weitgehend vermisst. Allein der Rückgriff auf die pluriforme theologische Tradition in seinen dogmenhistorischen Studien und seiner eigenen Dissertation zu unterschiedlichen mystischen Ansätzen in der mittelalterlichen Theologie zeigten ihm dort einen Ausweg aus der neuscholastischen Ghettotheologie. Bedrückende Enge und Bespitzelung im eher intellektuellenfeindlichen Klima empfand er schmerzlich. Eine Antwort sah er allein im Ausbruch aus der kirchenamtlich verordneten Unzeitgemäßheit und damit verbundenen Inferiorität.
Als Bernhart 1910 auf dem Augsburger Katholikentag, aufgrund seiner Mitarbeit am „Hochland“ von einigen Bischöfen kritisch beäugt, über die „Bildungsaufgaben der Katholiken“ sprach, wollte er Letztere zu einem verstärkten Engagement auf allen Sektoren der Kulturarbeit anstacheln und so aus ihrer damaligen, zumindest von ihnen so wahrgenommenen Ghettosituation herausführen; gleichzeitig warnte er vor polemischer Haltung gegenüber modernen außerkirchlichen Richtungen in Wissenschaft und Kunst. „Das ganze Tagwerk unserer Zeit, stolz in seiner Mühsal, mag nur immer tiefer graben draußen in der Welt und drinnen in der Menschenbrust; wir vertrauen, das Ende kann nur dieses sein: Entdeckung Gottes in der Außenwelt, Allelujasang der Schöpfung, Kreuzauffindung in der Menschenseele.“2 Gegen Verdächtigungen und Verurteilungen des Modernismus und Reformkatholizismus durch die Kirchenleitung vertrat der junge Theologe eine optimistische Position im Hinblick auf einen Dialog der Theologie mit den modernen Wissenschaften und der Kultur; er zeigte keine Berührungsängste, keinen Ghettogeist.
Mit allen Fasern seines Intellektes und Gemütes mühte Bernhart sich um das Gespräch von Theologie und modernen Wissenschaften, um die Zeitgenossenschaft von Kirche und moderner Kultur, um den Einsatz der Kirche in den drängenden sozialen Fragen und schließlich darum, die Erkenntnisse seiner Forschungen und Reflexionen zur Mystik auch für die Seelsorge fruchtbar zu machen. Der Theologe, „der mit so feiner Witterung auf den Fährten des modernen Denkens geht“, der um die Fähigkeit seiner Kirche zur Zeitgenossenschaft, damit zu einer Frucht bringenden Seelsorge rang, litt an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert daran, „daß wir im kirchlichen Leben am Ausgang des Mittelalters stehen“.3 Kein Wunder, dass er als Reformkatholik kritisch beäugt, zuweilen gar in die Nähe der so genannten Modernisten gerückt wurde.
Wo viele nach 1918 der Sehnsucht nach dem „Sacrum Imperium“ verfielen, dem katholisch geprägten mittelalterlichen Kaiserreich, stand Bernhart im Aufschwung des katholischen Geisteslebens der 20er-Jahre: Münchener „Hochland“-Kreis, Kreis um Ildefons Herwegen und Maria Laach, um Max Scheler in Köln, um Guardini und Burg Rothenfels, Schell-Kreis um Hermann Platz in Bonn.
Trotzdem erahnt man auch bei Bernhart das Störpotenzial, das mit dem Zusammenbruch der Monarchie kam – noch in den Erinnerungen spürt man sehr deutlich die tiefe Verstörung durch den Umsturz der alten Ordnung.
Der Intellektuelle zwischen Poesie und Gelehrsamkeit
„Halb Poet und halb Gelehrter“ lautet Bernharts Fazit einer Szene, die er selbst erzählt, um sich zu charakterisieren: Er erlebt, wie ein Kunde in einer Buchhandlung nach Werken Bernharts sucht, worauf der Buchhändler nachfragt, welchen Bernhart er meine: Es gebe da den Poeten und den Gelehrten. Diese Selbsteinschätzung Bernharts trifft den Kern seines Schaffens und die Problematik seiner Biographie. Sie sagt mehr aus und lässt mehr aufscheinen als Begriffe, vor allem wenn man mitschwingen hört, dass sowohl der Poet wie der Gelehrte sich in ihrer Erkundung und Aussage um die Schöpfung mühen, im Innersten also immer der Theologe spricht, der in aller Wirklichkeit Bewegung und damit Veränderung entdeckt. Wenn nun die Alteration im Betrachter eine einfühlsame Teilnahme erweckt, wie Bernhart unterstreicht, „eine unausweichliche, im ursprünglichen Sinne poetische Affektion“, dann ist jede Wahrnehmung – in unterschiedlicher Intensität und auf verschiedenen Ebenen – eine poetische Empfängnis, dann ist auch der Gelehrte, der erkennt, dass er um so stärkere Bilder und Begriffe braucht, je mehr er sich abgrenzt, im Innersten ein Poet. So sieht sich denn Bernhart auch zeit seines Lebens durch „die Qual einer doppelten Anlage“ vor die Berufswahl gestellt.
Bernharts Werk ist engstens verwoben mit dem zeitgenössischen Kontext in Theologie, Kirche und Gesellschaft. Nicht nur die sich überschlagenden politischen und geschichtlichen Ereignisse des 20. Jahrhunderts bestimmten seinen Denkweg, es ist auch – vielleicht zuerst – seine eigene Biographie. Das zeigt sich bereits an dem Bändchen „Tragik im Weltlauf“, veranlasst durch das Grauen des Ersten Weltkrieges, aber auch durch eine tiefe persönliche Konfliktsituation: Bernhart, am 8. August 1881 im schwäbischen Ursberg geboren, stammt aus einer gläubigen Familie mit einem sehr traditionellen Verständnis von christlicher Frömmigkeit und auf Seiten des Vaters einer Aufgeschlossenheit für geistige Fragen. Das patriarchalische, autoritäre Umfeld im München des ausgehenden 19. Jahrhunderts hat ihn beeindruckt und nicht wenig zu seiner Berufsentscheidung beigetragen; es lässt sich eine stark ausgeprägte Pietät Bernharts gegenüber der unterschiedlich strukturierten Religiosität seiner Eltern erkennen. 1904 zum Priester geweiht, verbrachte er seine Kaplansjahre zum großen Teil in bayerisch-schwäbischen Dorfpfarreien, damals bereits mit seinem Dissertationsthema „Bernhardische und Eckhartische Mystik in ihren Beziehungen und Gegensätzen“ beschäftigt. Er suchte den anspruchsvollen, anregenden Ausgleich zum eher körperlich denn geistig anstrengenden Seelsorgsdienst auf dem Lande, dessen Eintönigkeit und Einsamkeit er in „Der Kaplan“ später so trefflich skizziert hat. Aus der Begegnung mit der Provinzialität, mit der bedrängenden Enge der ländlichen Seelsorgearbeit wuchs ein Roman zum Meisterwerk.
Seit 1904 arbeitete er im „Hochland“ mit; nach seiner Eheschließung stellte er die Mitarbeit ein, weil er das „Hochland“ nicht mit den Schwierigkeiten des verheirateten Priesters belasten wollte. Erst seit 1934 erschienen dann im „Hochland“ wieder Beiträge aus Bernharts Feder. 1907 wurde er Sekretär der Gesellschaft für christliche Kunst in München. In dieser Funktion hielt er an Pfingsten 1908 einen Vortrag vor dem Verein katholischer deutscher Lehrerinnen; bei dieser Gelegenheit lernte er Elisabeth Nieland (1882 – 1943), die Sekretärin des Vereins, kennen, die er 1913 in London heiratete. Davor liegt die Zeit des Murnauer Benefiziaten, ein Abschnitt tiefsten Ringens um den eigenen rechten Weg und mit der Situation in seiner Kirche, das sich nicht zuletzt am erzwungenen Antimodernisteneid entzündete. Mit der Verheiratung zog sich der Benefiziat die excommunicatio latae sententiae zu. So sehr Bernhart zwischen der äußeren Gestalt, der rechtlichen Struktur und der geistlichen Dimension der Kirche zu unterscheiden wusste und damit auch spürte, welchem Gesetz er zu folgen hatte, so sehr litten er und seine Frau unter dem Ausschluss aus der vollen Gemeinschaft mit der römisch-katholischen Kirche, deren Geistigkeit und Geistlichkeit er mit allen Fasern seines Innersten anhing. Mit zahlreichen Vorstößen und auf vielfältigen Wegen bemühte sich der Schriftsteller, der immer im Dienst der Kirche schreiben wollte, um die Sanierung dieser Angelegenheit. Erst nach über 25 Jahren glücklicher Ehe und nur wenige Jahre vor dem Tod Elisabeth Bernharts erhielten sie den Bescheid der Aufhebung der Exkommunikation – und auch den zunächst nur foro interno.