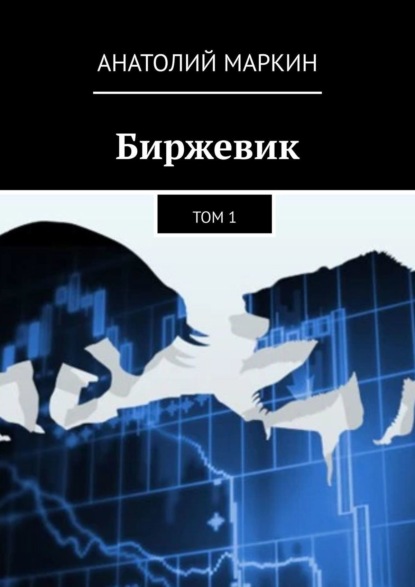- -
- 100%
- +
Die einleitenden umfänglichen Reflexionen weisen zudem darauf hin, dass er, dessen Sprache von der Kondensierung der Gedanken in zahlreiche Substantivierungen geprägt war, stärker auf die prädikative Ebene wechselt. Die neue Priorität zeigt sich schon in der Übersetzung der „Theologischen Summe“ des Thomas von Aquin (1934 ff.). Auch hier wurde die einengende und festgefahrene Terminologie der Substantive semantisch aufgesprengt und damit letztlich ein Beitrag zur Öffnung scholastischer Selbstverständlichkeiten geleistet.
Der Blick auf die Geschichte des Christentums, insbesondere auf die Erfahrungen der Schrecken des 20. Jahrhunderts bewegt ihn zu einer sehr kritischen Position: Aus tiefer Betroffenheit stellt Bernhart das Unvergleichliche der Schrecken des Dritten Reiches heraus. Sein Denkansatz lässt ihn aber mit einer nur moralischen Kritik von Kirche und Christen, dem bei vielen zeitgenössischen Theologen so geläufigen Argument eines Abfalls vom Christentum oder einer praktischen Lauheit nicht zufrieden sein. Dass es zu diesem Versagen kommen konnte, hängt – und darin wird die Traditionslinie seines Denkens deutlich – mit der Grundstruktur der Schöpfung zusammen, die eine antagonistische, eine dämonische ist – im ständigen Kampf zwischen der Tendenz zum Nichts und derjenigen zum Vollkommensein. Nach Christus hat dieser Antagonismus nicht an Spannung verloren, sondern neue Extrema gewonnen – insofern steht Bernhart hier durchaus in einer Nähe zu apokalyptischem Denken. Die dadurch verschärfte Theodizee-Frage verweist den Menschen auf die Ambivalenz seiner Freiheit, die in einem geheimnisvollen Zusammenwirken mit Gottes Willen steht. Der Mensch ist nicht nur eine Episode in der Geschichte, sondern der Tragende und Getragene einer höheren Geschichte. Nicht die Erkenntnisebene abstrahiert und überhebt den Menschen über den Fluss der Dinge und Geschehnisse, sondern das Gewissen, das nur theologisch begründbar ist. Dieser Mensch mit seinem Gewissen aber ist wie die Natur ein dämonischer, mit „Zwiemöglichkeit“ geladen, wobei „dämonisch“ nicht per se etwas Böses meint, sondern gemäß dem griechischen Ursprung etwas Ungeschiedenes und Unentschiedenes, das also jenseits von Gut und Böse liegt. Es ist potenziell fähig zu beidem. Damit stehen menschliches Handeln und Geschichte immer in der Krisis.
Bernhart erkennt – sensibel und weitblickend im Vergleich zu theologischen Zeitgenossen – die Erfahrungen des Dritten Reiches als Zäsur, bei der das Sosein des Menschen auf dem Spiel steht. Seine Antwort geht in eine Richtung, die gegenwärtige Alteritätsphilosophien einzubringen suchen.
Der Intellektuelle wird zum Seismographen
Lange bevor die ökologischen Probleme breiter in der Gesellschaft und Politik diskutiert wurden, hatte Bernhart gegen die Naturfremde seiner theologischen Zeitgenossen sein Gegensatzdenken auch auf die Tierwelt und das Leiden der Tiere angewandt. Der Theologe, der die Ordnung der Schöpfung gefährdet und gestört sah, der bedrängt wurde durch das Wissen, dass in dieser Schöpfung Gottes von Anfang an nicht alles in der Harmonie ablief, wie die Menschen sich dies wünschen, vollzog hier nicht nur eine anthropologische Wende, sondern eine Hinwendung seiner Theologie zur gesamten Schöpfung. 1961 erschienen seine Reflexionen über die „unbeweinte Kreatur“, theologische Essays als Antwortversuche auf die Fragen eines Pfarrers, den das Leiden der Tiere im alpenländischen Winter bedrückte. Zugleich öffnen sie die Perspektive hin auf eine mögliche Sinnhaftigkeit dieses Leidens, nach der Erlösung der Tierwelt. In einer Zeit, da die Fortschrittsgläubigkeit noch nicht erschüttert war, verweist Bernhart auf die Gefahren, die die wachsende Beherrschung der Natur durch den Menschen bringt, und auf die Ambivalenz des technischen Fortschritts. „Indem er [= der Mensch] die Dinge sich erobert, wächst ihm auch die Gefahr, daß er unter die Dinge gerät, weil er die Macht, die ihm zuwächst, als Versuchung, die Schlüsselgewalt über das Dasein in die Hand zu bekommen, nur dann bestehen könnte, wenn er, je mächtiger er wird, um so mehr auch besser würde, reiner, großgemuter, wachsamer über sein Herz, aus dem von je auch alles Arge kommt.“15
Das Deuten der Geschichte versteht Bernhart als seelsorgerische Aufgabe. Christsein und Kirche-Sein bedeuten ihm zutiefst ein Verwobensein in Göttliches und Weltliches. So verweist er die Kirche, die er in ihren Schönheiten wie in ihren Falten und Runzeln wahrnimmt und darstellt, immer wieder auf ihre eigentliche Aufgabe, nämlich den Menschen zu seiner ewigkeitlichen Dimension hinzuführen. Dies geschieht nicht zuletzt in seinem Erfolgswerk „Der Vatikan als Weltmacht“ (1930). Der Titel darf freilich nicht den Eindruck erwecken, als habe sich Bernhart in erster Linie dem Institutionellen in der Kirche zugewandt. Kirche ist für ihn – in enger Anlehnung an Platons Vorstellung vom Staat – zuvorderst eine Gemeinschaft, die den Charakter der Seligpreisungen trägt, die nach dem Reich Gottes in der Geschichte verlangt. Nicht dürfe sie sich als Fremdkörper in dieser Schöpfung und der Geschichte betrachten, noch sich resigniert oder vorwurfsvoll aus dem Weltgeschehen zurückziehen. Die Christen seien vielmehr dafür zu öffnen, dass sie die enge Verquickung von Schöpfung und Kirche anerkennen und damit das Geschöpfliche und das Ereignishafte aufwerten.
Das ist der Stachel, der dem Intellektuellen, der Gott nicht nur mit dem Intellekt, sondern mit allen Fasern seines Gemütes, mit all seinen Kräften lieben will, nicht erlaubt, in irgendeinem Elfenbeinturm zu verbleiben; der ihn antreibt, immer wieder Einsprüche zu formulieren; der um den Stellenwert der Wandlung in der Schöpfung weiß und daher ständig Umlernen einfordert; der die Menschen vom Wissen zur Bildung führen will. Bildung, „verstanden als Habe und Bereitschaft des Intellekts wie als Reife des sittlichen Bewußtseins“,16 ein Bewusstsein dafür, dass nicht nur wir Menschen Fragen stellen, sondern uns als Gefragte erkennen. Verstanden als Schöpfung, die die Geschöpfe zurückbezieht auf den Bildner; die die Transzendenz auch in einer Zeit offenhält, da viele glaubten, sich bequem auf die innerweltlichen Erklärungen und Machbarkeiten beschränken zu können. Bernhart wusste auch in der Fortschrittseuphorie der 50er-Jahre um die Tragweite des intuitiven Wissens und plädierte in Vorträgen und Kleinschriften wiederholt dafür, das spirituelle Verhältnis des Menschen zur Allwirklichkeit als Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. „Das Unsägliche ist offenbar die echte Heimat des Menschen. Das weiß der Liebende, der verstummt in seinem Glück; das weiß der Erkennende, dem im Verstehen die Sprache versagt.“17 Damit war Bernhart einmal mehr seiner Zeit weit voraus – 1910, nach seiner Rede auf dem Augsburger Katholikentag, hatte Carl Sonnenschein ihm bereits zugerufen: „Herrlich, mein Lieber, herrlich – nur 20 Jahre zu früh!“
Was blieb und bleibt von Bernharts Impulsen? Die Joseph-Bernhart-Gesellschaft hat unter ihrem langjährigen Ersten Vorsitzenden Manfred Weitlauff in den letzten zwanzig Jahren einen Großteil auch der unveröffentlichten Werke in hervorragenden Editionen vorgelegt. Die Rezeption in der zünftigen Theologie darf jedoch eher spärlich genannt werden.
Bernhart ist in mehrfacher Hinsicht eine atypische Gestalt der Theologenzunft seiner Zeit. Er ist durch die neuscholastische Schule gegangen, deren Antworten auf die Grundprobleme des Lebens und Seins ihn aber nicht befriedigen konnten. Durch eigene historische Forschungen in der Theologie und Philosophie des Mittelalters wollte er die neuscholastische Theologie in ihrem Problembewusstsein und ihren Lösungsansätzen weiten, aktualisieren, und musste sie so letztlich aufsprengen. Mehrfach wurde ihm eine mystische „Erlebnistheologie“ bescheinigt.18 Er hat damit zu einem subtilen Aufbruch beigetragen, der zwar nie die Breite und zunächst weite und begeisterte Resonanz eines Romano Guardini gefunden hat, wegen seines Ringens um den Menschen in Gott und Gott im Menschen und wegen seines Dialoges mit den Erkenntnissen der Naturwissenschaften jedoch auch heute noch aktuell ist.
Am Beispiel Bernharts zeigt sich: Historisches Forschen kann zu kritischer Distanz befähigen, ein Sensorium für das jeweils Erforderliche, für die Würde und Aufgabe des „Augenblicks“ schaffen. Das Marginale schärft den Blick. Die Spannung von „einzeln“ und „allgemein“, induktiv und deduktiv gilt es auszuhalten. Man möchte wünschen, dass vor allem sein Schöpfungsdenken, die creatio continua und sein Gegensatzdenken bis in den Schöpfer hinein, weitergeführt und in den unterschiedlichsten Bereichen der theologischen Disziplinen die entsprechenden Konsequenzen durchdacht werden, etwa seine Aussage, dass das malum bereits in Gottes Schöpfergedanken ist, in Hinsicht auf die Rede von der Notwendigkeit der satisfactio.
Schriften von Joseph Bernhart: Bernhardische und Eckhartische Mystik in ihren Beziehungen und Gegensätzen. Eine dogmengeschichtliche Untersuchung. Kempten/München 1912 – (Hg.:) Gebete großer Seelen (1915). Neu hg. v. Manfred Weitlauff. Weißenhorn 1999 – Tragik im Weltlauf (1917). Hg. v. Manfred Weitlauff. Weißenhorn 1990 – Der Kaplan. Aufzeichnungen aus einem Leben (1919). Mit Schriften u. Beiträgen zum Thema aus den Jahren 1912 – 1969 neu hg. v. Manfred Weitlauff. Weißenhorn 1986 – (Hg.:) Der Frankfurter. Eine deutsche Theologie. Leipzig 1920 – Die philosophische Mystik des Mittelalters von ihren antiken Ursprüngen bis zur Renaissance (1922). Mit Schriften und Beiträgen zum Thema aus den Jahren 1912 – 1969 neu hg. v. Manfred Weitlauff. Weißenhorn 2000 – Der Vatikan als Thron der Welt. (Ab 1930 u. d. T.: Der Vatikan als Weltmacht. Geschichte und Gestalt des Papsttums.) Leipzig 1929 – Sinn der Geschichte (1931). Mit Vorträgen u. Aufsätzen zum Thema aus den Jahren 1918 bis 1961. Hg. v. Manfred Weitlauff. Weißenhorn 1994 – Meister Eckhart und Nietzsche. Ein Vergleich für die Gegenwart. Berlin 1934 – (Hg.:) Thomas von Aquino. Summe der Theologie. 3 Bde. Stuttgart 1934/38 – De profundis (1935). Weißenhorn 51985 – (Hg.:) Der stumme Jubel. Ein mystischer Chor. Salzburg/Leipzig 1936 – (Hg.:) Heilige und Tiere (1937). Hg. v. Manfred Weitlauff. Weißenhorn 1997 – Totengedächtnis. München 1940 – Vom Mysterium der Geschichte. Kolmar i. E. 1944 – Chaos und Dämonie. Von den göttlichen Schatten der Schöpfung (1950). Neu hg. v. Georg Schwaiger. Weißenhorn 1988 – Bonifatius, 672/75 – 754. Apostel der Deutschen (1950). Hg. v. Manfred Weitlauff. Weißenhorn 2004 – Gestalten christlicher Mystik und Spiritualität. Mit einem Anhang: Schriften und Beiträge zur christlichen Spiritualität aus den Jahren 1908 – 1954. Hg. von Manfred Weitlauff. Weißenhorn 2004 – Wissen und Bildung. Zwei Vorträge. München 1955 – Die unbeweinte Kreatur. Reflexionen über das Tier (1961). Neu hg. v. Georg Schwaiger. Weißenhorn 1987 – Zeit-Deutungen. Schriften, Beiträge und bislang unveröffentlichte Vorträge zu Problemen der Politik und Kultur aus den Jahren 1918 – 1962. Hg. v. Manfred Weitlauff u. Thomas Groll. Weißenhorn 2007 – Thomas Morus. Roman. Weißenhorn 1979 – Erinnerungen. 1881 – 1930. 2 Bde. Hg. v. Manfred Weitlauff. Weißenhorn 1992 – Tagebücher und Notizen 1935 – 1947. Hg. v. Manfred Weitlauff. Weißenhorn 1997.
Sekundärliteratur: Rainer Bendel: Das Kirchenbild Joseph Bernharts. St. Ottilien 1993 – Ders.: Joseph Bernhart (1881 – 1969). In: Manfred Weitlauff (Hg.): Lebensbilder aus dem Bistum Augsburg. Vom Mittelalter bis in die neueste Zeit. Augsburg 2005, 507 – 525 – Ders./Lydia Bendel-Maidl: Mystik oder Scholastik als Wege zu Nietzsche. Joseph Bernhart und Theodor Steinbüchel im Vergleich. In: Gotthard Fuchs/Ulrich Willers (Hg.): Theodizee im Zeichen von Dionysos. Friedrich Nietzsches Fragen jenseits von Moral und Religion. Münster 2002 – Diess./Andreas Goldschmidt: Dämonisierung des Nationalsozialismus. Vergangenheitsbewältigung in theologischen Schriften Joseph Bernharts, Romano Guardinis und Alois Winklhofers. In: Kirchliche Zeitgeschichte 13 (2000) 138 – 177 – Lorenz Wachinger (Hg.): Joseph Bernhart. Leben und Werk in Selbstzeugnissen. Weißenhorn 1981 – Manfred Weitlauff (Hg.): Joseph Bernhart (1881 – 1969), ein bedeutender Repräsentant katholischen Geisteslebens im 20. Jahrhundert. Augsburg 2000.
Peter Wust (1884 – 1940)
„Insecuritas humana“ und religiöser Glaube
Der christliche Existenzphilosoph Peter Wust
Werner Schüßler
Philosophie und Biographie
In einem Brief an den priesterlichen Freund Karl Pfleger vom 20. Dezember 1935 schreibt Peter Wust: „Ab und zu überkommt mich ein entsetzlicher Kathederekel. Und dann verbrauche ich entsetzlich viel Kraft. Diese Woche war’s besonders schlimm damit. Dann ist mir, als sei alles dummes Zeug, was ich sage, ja als hätte ich meinen Beruf vollkommen verfehlt. Es überkommt mich dann allemal mein armseliges Autodidaktenbewußtsein der Philosophie, d. h. der Gedanke, daß ich doch nur so nebenher in die Philosophie hineingewachsen bin.“1
Das sagt ein Mann, der, auf dem Höhepunkt seiner akademischen Karriere, sich jahrelang nichts anderes gewünscht hatte, als auf dem Katheder zu stehen, zu Menschen sprechen und sich nur noch mit der Philosophie beschäftigen zu können. Aber bis dahin sollte es ein langer und steiniger Weg werden, der durch viele Höhen und Tiefen geführt hat, ähnlich dem Leben des jüngeren der beiden Brüder in der Parabel vom verlorenen Sohn in Lukas 15,11 – 32. Mit dieser Parabel lässt Wust auch sein Hauptwerk „Ungewißheit und Wagnis“ beginnen, wird hier doch in wenigen Sätzen die „conditio humana“, so wie sie Wust versteht, deutlich: nämlich „die ganze Dialektik des Lebens nach seinem Wechselverhältnis von Gesichertheit und von Ungesichertheit“ (UW 38).2 Wusts Leben offenbart diese Dialektik, die im Zentrum seines Hauptwerkes steht, in einer ganz eigenen und tiefen Weise.3
Am 28. August 1884 in Rissenthal bei Losheim im Saarland geboren und in recht ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, erwacht in dem Jungen schon recht früh ein reges Interesse an Büchern. Der Pfarrer wird auf seine Begabung aufmerksam und bereitet ihn nach Abschluss der Volksschule auf das Gymnasium vor. Im Jahre 1900 besteht Wust die Aufnahmeprüfung für die Quarta des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Trier, und er zieht nun in das Bischöfliche Konvikt. Nach dem Wunsch der Eltern soll er später Theologie studieren und katholischer Priester werden. Aber dieses Vorhaben gibt er schon bald auf, nachdem er – nicht zuletzt durch die Lektüre von Dante, Manzoni und Goethe beeinflusst – in eine schwere Glaubenskrise gerät. Zu Hause gilt er nun bei seiner Familie als ein „Abtrünniger“, als ein „Verlorener Sohn“ (GW V, 242).4
Nach bestandener Reifeprüfung immatrikuliert sich Wust an der Berliner Universität für die Fächer Germanistik und Anglistik mit dem Ziel des Gymnasiallehrers. Aber schon bald ist er von der Philosophie begeistert; es ist der Philosoph Friedrich Paulsen, der „den Blitz des ,thaumazein‘, der großen Verwunderung“ (GW V, 243), in Wusts Seele hat fallen lassen, von der er nicht mehr loskommen sollte. Nach zwei Semestern wechselt er an die seiner Heimat näher gelegene Universität Straßburg. Hier ist er stark beeindruckt von dem katholischen Philosophiehistoriker Clemens Baeumker, der sich um die Erforschung der mittelalterlichen Philosophie besonders verdient gemacht hat.
1910 macht Wust sein Staatsexamen; im selben Jahr heiratet er Käthe Müller, um dann für ein Jahr als „Seminarkandidat“ an die Friedrich-Werdersche Oberrealschule in Berlin zu gehen, bevor er 1911 für vier Jahre als „Probekandidat“ an die Oberrealschule nach Neuß am Rhein versetzt wird. In diesen Jahren wird ihm bewusst, dass er im Lehrerberuf nicht recht aufgeht. Der „Konflikt zwischen Brotwissenschaft und Lieblingswissenschaft“ (ebd.) führt schließlich dazu, dass er sich – neben seinem Lehrerberuf – für eine Promotion in Philosophie entscheidet. 1914 promoviert er an der Universität Bonn unter der Leitung von Oswald Külpe mit einer Arbeit über „John Stuart Mills Grundlegung der Geisteswissenschaften“ zum Doktor der Philosophie. Zu Anfang noch im neukantianischen Denken verhaftet, drängt es ihn schon bald zu einer „neuen Unmittelbarkeit“, zu einer „originalen Aufrollung der ewigen Probleme selbst“ (GW VIII, 23). Den entscheidenden Anstoß in diese Richtung sollten ihm später Georg Simmel, Ernst Troeltsch und in ganz besonderem Maße Max Scheler geben.
1915 wechselt Wust als Oberlehrer an das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium nach Trier, um nur sechs Jahre später an das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium nach Köln und zwei Jahre später an das dortige Dreikönigs-Gymnasium zu wechseln. In Köln macht er schon bald die Bekanntschaft mit Max Scheler. Wust selbst spricht in diesem Zusammenhang von „einer völligen inneren Umwandlung“, „einer ,Metanoia‘ größten Stiles“ (GW V, 264). In Scheler glaubt Wust „die große philosophische Achsendrehung“ zu sehen, „die dem ganzen Zeitalter die Wendung zum Objektiven geben sollte“ (GW V, 250 f.). Scheler ermutigt Wust in seinen akademischen Zukunftsplänen, doch scheitert das Vorhaben einer Habilitation daran, dass er seine inzwischen auf drei Kinder angewachsene Familie ernähren muss, was ihn dazu zwingt, den Lehrerberuf beizubehalten.
1930 wird Wust dann, für ihn selbst unerwartet und gegen den Willen der Fakultät, durch den Preußischen Kultusminister Adolf Grimme zum ordentlichen Professor für Philosophie an die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster berufen. Hier wächst sein Bekanntheitsgrad stetig; so sitzen dem Professor im Auditorium Maximum bald über 400 Studierende zu Füßen, und in den Jahren nach 1933 werden es noch mehr.
Kurz vor Weihnachten 1937 bemerkt Wust an seinem Gaumen eine Wunde, die genau dort entstanden war, wo der Tabakdampf seiner langen Pfeife unmittelbar anschlug. Im Oktober 1938 erfolgt dann eine erste Operation, nachdem eine Röntgenbestrahlung keine dauerhafte Besserung ergeben hat und eine Krebserkrankung diagnostiziert wurde. Doch schon bald darauf verschlechtert sich sein Gesundheitszustand derart, dass Wust die Lehre an der Universität einstellen muss; am 16. Februar 1939 hält er seine letzte Vorlesung (vgl. GW VIII, 115 f.).
Es erfolgen zwar noch zwei weitere Operationen, doch alles hilft nichts mehr. Auf eine Genesung scheint keine Aussicht mehr zu sein. Am 3. April 1940 stirbt Wust qualvoll an seiner Krankheit. – So weit die äußeren Daten seines Lebensweges.
Die innere Lebensgeschichte liest sich anders und ist für uns auch aufschlussreicher. Von etwa 1905 ab – es wurde schon angedeutet – hat Wust dem christlichen Glauben ziemlich passiv gegenübergestanden: „Ich zerriß zwar nicht die Fäden, die mich äußerlich noch an die Kirche knüpften“, schreibt er, „aber ich hatte im Grunde den Glauben verloren.“ (GW V, 252) Das ändert sich, als er 1918 die Bekanntschaft mit Ernst Troeltsch macht. Wust berichtet darüber: „Bei Gelegenheit einer Tagung in Unterrichtsfragen war ich am 4. Oktober 1918 zu dem berühmten Religionsphilosophen Ernst Troeltsch, mit dem ich damals im Briefwechsel stand, zu einer kurzen Aussprache unter vier Augen eingeladen worden. Tief erschüttert von der Situation der Zeit, versuchte Troeltsch damals neue Kräfte des Glaubens in mir aufsteigen zu lassen. ,Diese äußere Niederlage, die wir jetzt erleben‘, so sagte er mir, ,braucht Sie nicht zur Verzweiflung zu führen. Denn diese äußere Niederlage ist nur die konsequente Folge jener inneren Niederlage, die wir bereits seit dem Tode Hegels dauernd erleiden, insofern wir den großen alten Väterglauben an die souveräne Macht des Geistes aufgegeben haben.‘ Wie ein Blitzschlag durchzuckten diese Worte in jenem Augenblick meine Seele, und nun fügte Troeltsch, anspielend auf meine Glaubensnöte, die ich ihm brieflich geschildert hatte, noch die Mahnung hinzu: ,Sie sind noch jung. Wenn Sie noch etwas für die Kräfteerneuerung unseres Volkes tun wollen, dann kehren Sie zurück zum uralten Glauben der Väter und setzen Sie sich in der Philosophie ein für die Wiederkehr der Metaphysik gegen alle müde Skepsis einer in sich unfruchtbaren Erkenntnistheorie.‘“ (GW V, 252 f.)
In einem Brief an Karl Pfleger bekennt Wust Jahre später: „Dieser 4. Oktober 1918 war das Damaskus meines bisherigen Liberalismus und meiner kantianischen Metaphysikscheu. Ernst Troeltsch hat damals in mir die Bresche in meine Skepsis geschlagen und mich wenigstens wieder zum Glauben an so etwas wie einen persönlichen Gott zurückgeführt.“5
Wust greift dieses Anliegen Troeltschs in seinem ersten größeren Werk, „Die Auferstehung der Metaphysik“, von 1920 auf (vgl. GW I). Die Begegnung mit Troeltsch versteht Wust als einen „ersten schweren Stoß der Gnade“, der schließlich dazu führt, dass er in den Ostertagen 1923 wieder „in die Arme der ,Una Sancta Ecclesia‘“ zurückkehrt. „Seit jenem Heimkehrtag aber war alle müde Skepsis mit einem Male hinweggefegt worden“, schreibt Wust. „Seit jenem Tage war ich wieder naiv gläubig wie ein Kind. Seitdem beschäftigte mich auch die Erscheinung der Naivität, der ich 1925 in dem Buche ,Naivität und Pietät‘ [vgl. GW II] meine besondere Aufmerksamkeit zugewendet habe. In dieser Schrift konzentrierte sich mir das ganze tiefgreifende Kontrasterlebnis, das ich seit etwa dreißig Jahren in dem Übergang von der Ruhe der Dorfidylle zur unseligen Unruhe des städtischen Lebens immer tiefer erfahren hatte. Und dahinter steckte ja auch das ganze quälende Menschenrätsel, das in den späteren Jahren die Philosophie immer mehr in ihren Bann lockte.“ (GW V, 253 f.)
In der Polarität von Naivität und Pietät sieht Wust „ein Tor, das zu den wunderbarsten Geheimnissen der Menschennatur und der Geistesbewegung in der Menschheitsgeschichte führen konnte, wenn nur jemand den rechten Schlüssel fand, um dieses Tor zu öffnen“ (GW V, 255). Das in „Naivität und Pietät“ angesprochene Thema führt Wust weiter „zu der Frage nach der ewigen Unruhe des Menschengeistes“ (ebd.), die er in dem 1928 veröffentlichten Werk „Die Dialektik des Geistes“ (vgl. GW III/1 u. 2) aufarbeitet. – Es waren wohl diese drei Werke, die ihn auch ohne Habilitation berufungsfähig machten.
Im Jahre 1937 erscheint dann sein bedeutendstes Werk, geradezu eine Zusammenfassung seiner Grundgedanken, unter dem Titel „Ungewißheit und Wagnis“.6 „,Ungewißheit und Wagnis‘ schrieb ich 1936 in zwölf Wochen – es war eine Entladung“, heißt es in einem Brief an Karl Pfleger. „Das sind rasch vorübergleitende Optima der Gnade – hinterher bin ich ein Häuflein abgebrannter Asche.“7
In der Zeit der Krankheit überarbeitet und vollendet Wust noch seine Lebenserinnerungen „Gestalten und Gedanken“ (vgl. GW V 41 – 257), und am 18. Dezember 1939 schreibt er sein bekanntes „Abschiedswort“ an seine Studentinnen und Studenten, in dem er das Gebet und nicht die Reflexion als den „Zauberschlüssel“ bezeichnet, „der einem das letzte Tor zur Weisheit des Lebens erschließen könne“.8
Philosophie ist notwendig existenziell
Im philosophisch-theologischen Bereich ist Peter Wust heute – allerdings zu Unrecht, wie ich meine – weitgehend in Vergessenheit geraten. Das war zu seinen Lebzeiten und in den Nachkriegsjahren anders. So schreibt Papst Benedikt XVI. in seiner Autobiographie „Aus meinem Leben“ über seine Zeit im Seminar in Freising: „Im theologischen und philosophischen Bereich waren Romano Guardini, Josef Pieper, Theodor Haecker und Peter Wust die Autoren, deren Stimme uns am unmittelbarsten berührte.“9 Das hat ohne Zweifel mit der Art von Wusts Philosophieren zu tun. Wust ist ein „existenzieller“ Denker. Aber existenzphilosophisches Denken steht heute insgesamt nicht mehr im Zentrum des philosophischen Interesses. Dabei, so meine ich, hat Wust uns auch heute noch sehr wohl Wesentliches zu sagen10 – und das in Bezug auf vier Themenfelder: die Frage nach dem Menschen, die Frage nach dem Selbstverständnis der Philosophie,11 hinsichtlich seiner Kultur- und Zivilisationskritik12 sowie seiner Verhältnisbestimmung von Glaube und Vernunft.13
Hinter alledem steht letztlich Wusts Überzeugung, dass Philosophie notwendig „existenziell“ ist, und auf eine christliche Philosophie trifft das in ganz besonderem Maße zu. Diese Überzeugung verbindet Wust mit Denkern wie Augustinus, Pascal oder Kierkegaard.
„Christliche Philosophie“, so schreibt Wust in diesem Sinne, „will nicht bloß vorgedacht, sie will vorgelebt sein. Und sie will mit Stolz vorgelebt sein, wenn sie zum Heile werden soll für Ertrinkende. Was aber macht sie zur christlichen Philosophie? Es ist im Grunde wenig und doch wieder sehr viel. Der moderne Philosoph lebt in dem verhängnisvollen Irrtum, daß die Probleme des Daseins nur durch reines Denken durchdrungen und bezwungen werden könnten. Er vergißt dabei, daß der philosophische Reflexionsakt im Grunde immer anhebt und endigt in einem religiösen Akt der Hingabe, d. h. soweit er wenigstens ein echt philosophischer Reflexionsakt sein soll. Meditation und Gebet konvergieren aufeinander hin, soweit in ihnen der ganze lebendige Mensch sich in Tätigkeit versetzt. Diese einfache Tatsache vergißt der moderne Philosoph. Christliche Philosophie aber ist allemal schon im Ansatz gegeben, wo diese innere Einheit von Meditation und Gebet von vornherein hingenommen und mutig der Zeit vorgelebt wird. Man sieht, der Begriff der christlichen Philosophie braucht keineswegs überspannt zu werden. Dem Ansatz nach ist schon Platon ein christlicher Denker, eben weil er ein betender Denker war.“ (GW VI, 104 f.)14