- -
- 100%
- +

WOLFGANG SCHNEIDER
Räume machen Leute
Über Haltung im Architektenleben
Erbauliche Kolumnen
Mit Illustrationen von Erik Liebermann
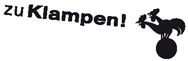
Diese Kolumnenreihe erschien zuerst im Zeitraum November 2018 bis Oktober 2020 im »Deutschen Architektenblatt«, Regionalausgabe Niedersachsen.
© 2020 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe · zuklampen.de
Layout: Agentur Wolski Alfeld · agentur-wolski.de
Umschlaggestaltung: Melanie Beckmann · Bad Münder · design-beckmann.de
Coverzeichnung: Wolfgang Schneider · Hannover Illustrationen: Erik Liebermann · Steingaden · liebermann-cartoons.de
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2020
ISBN 978-3-86674-787-6
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Für Christiane
Cover
Titel
Impressum
Über Haltung im Architektenleben
Bärlauchs Lehrreise in die Provinz
Architekt Baumann und der Steuerer
Schlachtfelder des Kammergründers
Aufbruch mit Rückzug
Runder Geburtstag und ein Spiel
Rainer A. auf der Überholspur
Hoher Besuch mit Überraschung
Tom B. Sulzer und der Retrowahn
Periphere Baukunst
Flaneur auf leisen Sohlen
Notbremsung im Kloster
Alles und Nichts
Räume machen Leute
Zeitreise des Hofbaumeisters
Fortgeschrittene Vergangenheit
Flottbeck und die Avantgarde
Entwürfe vor Gericht
Die Kammer geht baden
Wege zum Olymp
Tag der Architektur
Dialogische Preziosen
Hausers Inseldomizil
Aufstieg mit Wasserschaden
Steinbachs Debüt als Architekt
Nachwort zum Frühstück
Über den Autor
Über Haltung im Architektenleben

»Die Architektur wackelt.« So lautet die Überschrift zu einem Kommentar in einer großen Tageszeitung über den Bericht des Wehrbeauftragten. Bis dahin ist mir verborgen geblieben, dass eine militärische Struktur Baukunst ist, die auch Haltungsschäden erzeugen kann. Wenn Architektur wackelt, ist sie nicht stabil gebaut. Wenn sie Bestand haben soll, muss sie über ein solides Fundament verfügen, muss Spannungen aushalten, gepflegt und wertgeschätzt werden.
Die allgegenwärtige inflationäre Verwendung des erweiterten und populären Architekturbegriffs lässt auf höhere Weihen schließen. Die Rede ist heute von Friedensarchitektur, Sicherheitsarchitektur, Rechnerarchitektur, von der Architektur der europäischen Außenpolitik, der neuen Finanzarchitektur, von der Architektur philosophischer Gedankengebäude oder gar von der Schönheit molekularer Architektur von Viren. Das alles kann Architektur sein. Wie auch Diskurse zwischen Architektur und Politik. Sie bereichern zuweilen ebenfalls gesellschaftliche Debatten, wenn es beispielsweise um die Förderung der Baukultur geht – und sie anzuregen ist die ureigene Aufgabe der Architektenkammer, deren Präsident ich in Niedersachsen viele Jahre war. Politischen Einfluss nehmen konnte ich mit dem Erfahrungsschatz als freischaffender Architekt, als Kenner der Baukultur und eben als Akteur des Berufsstandes. Aus den vielen Begegnungen und Gesprächen auf der beruflichen, gesellschaftlichen und politischen Ebene speisen sich Erlebnisse und Erkenntnisse, die ich in Form von Kolumnen verarbeitet habe.
So wie die Architektur hat auch der Beruf des Architekten viele Facetten. Diese Vielschichtigkeit macht das Wirkungsfeld mit seinen Gestaltungsmöglichkeiten so spannend und abwechslungsreich. Ich kenne die Untiefen der Baukultur ebenso wie die Widrigkeiten des Architekten- und Kammerlebens, das zuweilen kompliziert und herausfordernd ist – hin und wieder aber auch unterhaltsam. Nun ist Humor eine Alternative, den Unzulänglichkeiten des Geschehens mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Und darum geht es in diesem Band: einen Blick hinter die Fassade eines verantwortungsvollen Berufs zu werfen, der auch – in meinem speziellen Fall – Berufspolitik umfasste und dessen Alltag so ganz anders aussieht, als man ihn sich gemeinhin denkt. Die Kolumnen sind mal ernsthaft, mal abgründig, mal voll leiser Ironie. Sie bewegen sich zwischen Dichtung und Wahrheit, sind launig überzeichnet, garniert mit Subtilitäten und Absurditäten. Mit Haltung und einem Augenzwinkern wird in das Engagement und das Seelenleben der Architekten und zugleich Kammermitglieder geschaut, über das vielfältige Potenzial des Berufsstandes reflektiert.
An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Erik Liebermann danken, der mich mit seinen wunderbaren Illustrationen zwei Jahre lang auf meinen Kurzreisen durch das Architekten- und Kammerleben begleitet hat. Entspannt habe ich geschrieben, entspannend soll die Lektüre sein.
Wolfgang Schneider
Bärlauchs Lehrreise in die Provinz

Überlandreisen sind bei Herrn Bärlauch mit positiven Kindheitserinnerungen verbunden. Mutter packt alles Notwendige für den Ferienaufenthalt. Ausreichend Verpflegung für die lange Fahrt, Spielzeug, Bücher, sommerliche Kleidung, Sonnenschutzmittel, Schwimmflügel. Die Bahnfahrt per Holzklasse in den ländlichen Nordwesten dauert Stunden. Links und rechts der Schienenwege blühende Weidelandschaften, gemächlich grasende Kühe, sich im Wind wiegende Birken, weite Moorgegenden. Idylle pur.
Viele Jahre später, diesmal schneller und komfortabler im ICE, reist Herr Bärlauch – inzwischen Kammerpraktikant, Spezialgebiet Landschaftspflege und für besondere Aufgaben als tauglich befunden – im Tross der Kammeroberen erneut in die Region im Nordwesten, in eine ehemalige Residenzstadt zu einer generalstabsmäßig vorbereiteten »Kammer vor Ort«-Veranstaltung. Gelegenheit für Mitglieder, über Berufspolitik zu sprechen, Anregungen für die Kammerarbeit zu geben oder Kritik loszuwerden.
Bärlauchs komplexer Fortbildungskurs besteht darin, als teilnehmender Beobachter die bevorstehenden Interaktionen zu dokumentieren. Intensiv vorbereitet ist er eingetaucht in die Geheimnisse der methodischen Feldforschung, um Erkenntnisse über das Handeln, das Verhalten und die Auswirkungen des Verhaltens einzelner Personen oder Gruppen zu gewinnen. Die Kammer, so viel steht fest, präsentiert sich auf der Höhe der Zeit.
Am Zielort angekommen, düst die Gruppe im Großraumtaxi direkt zur Tagungsstätte. Solides Werk der Baukunst, errichtet im Ziegelkreuzverband, der umliegenden Bebauung angepasst, den genius loci genuin getroffen. Ergebnis eines vorausgegangenen Architektenwettbewerbs. Hohe, schmale Fenster, eleganter Unterschnitt im Eingangsbereich, großzügigzeitgemäßes Ambiente im Innern des Hauses. Vollbesetzter Saal, freundliches Kopfnicken, gespannte Erwartung, Auftritt der Kammerleitung.
Die Veranstaltung wird eröffnet vom ortsansässigen Kammervorstandsmitglied, das im Vorfeld seine Schäflein namentlich und wahlweise mit Handschlag oder Umarmung begrüßt. »Herzliches Willkommen« auch der Pressevertreter mit Bitte um sachgerechte und faire Berichterstattung. In der folgenden kurzen Ansprache wird das besondere Engagement der Mitglieder aus der Region hervorgehoben. Er erwarte von den Kollegen heute »Impulse« für die Kammerarbeit. Sie mögen aber auch von ihren Sorgen berichten, denn »die Kammer ist für uns alle da«. Ein freundlicher Willkommensgruß »an den lieben Kammerpräsidenten« leitet über zu dessen Grundsatzrede. Etwas langatmig streift dieser viele Themen und gelangt schließlich zu der seit Jahren alles überlagernden Debatte der Anpassung der Honorare. Diese wolle er »in aller Ruhe« diskutieren. Er freue sich, nach dem Sachstandsbericht des Geschäftsführers in einen »fruchtbaren Dialog« einzutreten.
Mit der einsetzenden Diskussion kommt die stille Stunde des Herrn Bärlauch, dessen Aufgabe ein stetes Hin und Her zwischen Nähe (Teilnahme) und Distanz (Beobachtung) bedeutet und ein Notieren der Beiträge verlangt. Die höflichen und konstruktiven Fragen und Statements des Berufsstandes und die erschöpfenden Antworten der Verantwortungsträger ziehen sich über einen längeren Zeitraum hin, bis kurz vor dem Ende der Veranstaltung aus einer hinteren Ecke eine erneute Wortmeldung erfolgt: »Ich bin absolut gegen eine neue Honorarordnung. Die schadet mir nur als Einmannbüro auf dem Lande. Ich versuche, Bauherren über die direkte Ansprache zu gewinnen. Habe ich sie erst einmal im Büro, ist die Sache geritzt.« Donnerwetter. Das hat gerade noch gefehlt.
Später am Abend an der Hotelbar sind sich die frustrierten Kammervertreter einig über die nicht nur kontraproduktive, sondern subversive Einlassung des Kollegen. Herr Bärlauch ergänzt, dass sich besagter Herr anschließend im vertraulichen Gespräch dafür ausgesprochen habe, die Kammer »in Gänze abzuschaffen«. Sie schade nur dem Geschäft. Der Bericht am nächsten Tag in der Zeitung mit der Überschrift »Kammerpräsident wird überrascht von klarer Haltung eines Berufskollegen« ist zwar verkürzte, aber sachgerechte Realsatire.
Es bleibt die Erkenntnis des Praktikanten Bärlauch, dass Reisen bildet und Resilienz die Fähigkeit ist, Niederlagen und Härten wegzustecken und weiterzumachen.
Architekt Baumann und der Steuerer

Frühmorgens um acht. Eilens einberufene Bauherrenbesprechung im kleinen Kreis. Anwesend: Bauherr, Haifischlächeln, distinguierte Erscheinung; Rechtsanwalt, stur gegen die Wand schauend; Projektsteuerer, hektisch Papiere ordnend, roter Kopf, zerknirschte Miene; Architekt Baumann (was sollte er mit diesem Namen auch anderes werden), ergeben freundlicher Blick.
Kurze Begrüßung durch den Bauherrn. Bittet den Projektsteuerer um Erklärung, warum »gewisse Dinge nicht laufen«.
Bericht folgt in knarzendem Tonfall. Der Steuerer fordert Baumann lautstark auf, seine Leute »auf Vordermann« zu bringen. Ob vielleicht nicht doch fehlende oder unvollständige Architektenpläne die Ursache für das »unsägliche Versagen« seien. Es gehe nicht an, immer wieder Handskizzen nachzuschieben. Der »Ablauf« würde behindert. Die Fachplaner kämen nicht weiter, der ganze Ausbau komme zum Erliegen. Und wie »die Baukünstler« den Terminverzug aufzuholen gedächten? Er müsse jetzt für Ordnung sorgen und diesem »Schreckensszenario« unverzüglich ein Ende bereiten. »Geht alles zu Ihren Lasten. Sie hören von uns.« Wumm.
Krisengespräch. Architekt Baumann ist sauer. Vermutet Schutzbehauptungen des Steuerers, um von eigenen Versäumnissen abzulenken. Versammelt leicht erzürnt seine »Vordermänner«: Projektleiterin nebst Planerin und einen Bauzeichner. Ziel: Widerlegung der »unflätigen Attacke«. Kann doch alles nicht wahr sein! Wurde das Büro nicht vor geraumer Zeit softwaretechnisch aufgerüstet, um Schnittstellen besser und effektiver in den Griff zu bekommen? Auch um terminliche Engpässe zu vermeiden? Sind Handskizzen jetzt ein Teufelszeug im System?
Die beiden hochgeschulten Mitarbeiterinnen meinen unisono und etwas kleinlaut-steif, Chef solle ein beschwichtigendes Telefonat mit dem Steuerer führen, sie würden derweil die Pläne »wenn nötig« vervollständigen und »zeitnah« an die Fachplaner verteilen. Klingt sehr fremdgesteuert. Der Bauzeichner gibt derweil den Obercoolen und rät, mit Haltung Widerstand zu leisten, die Sache auszusitzen. Chef solle es drauf ankommen lassen. Das mit dem Verzug könne doch mal passieren. Kein Grund, sich aufzuregen. »Möchte ich überhört haben«, brummt augenrollend der Architekt. Und eilt von dannen.
Verabredet »Bei Lucy« mit Toni, befreundeter Kollege, legere Kleidung, gut gelaunt. Baumann erzählt ihm, noch etwas aufgebracht, vom morgendlichen Erlebnis. Toni winkt ab, sei immer das Gleiche, dieser »Eiertanz zwischen Entwurfsoptimierung beim Bauen und künstlerischer Freiheit. Schön gegenhalten«. Baumann seufzt, dass dem Berufsstand »immer weniger Respekt« entgegengebracht werde, wenn die Dreieinigkeit Bauherr, Anwalt und Steuerer am Tisch sitze. Überhaupt, mit Palladio wäre man seinerzeit nicht so umgesprungen. Toni nickt zustimmend und merkt an, dass die Baukunst immer mehr zur Hochrechnung verkomme und die Baukultur dabei baden gehe.
Die Freunde verabschieden sich. Toni geht ins Schwimmbad. Baumann zurück ins Büro. Im Laufe des Nachmittags stellen sich bei näherer Betrachtung gewisse Inkompatibilitäten zwischen den Computerzeichnungen seiner Mitarbeiter und Handskizzen von ihm selbst heraus. Letztere sind vielleicht etwas fehlinterpretiert worden. Er hat versäumt, die Umsetzung zu kontrollieren. Die Sache ist ambivalent, eigentlich viel Lärm um nichts. Trotzdem ärgerlich. Baumann sinniert, dass es, wie so oft, ums Menschliche und Ängstliche gehe und überall Schutzzäune aufgebaut würden. Zeit, endlich Feierabend zu machen, um auf andere Gedanken zu kommen.
Frühabends im Biergarten. Architekt Baumann will den Tag ausklingen lassen. Allein sein. Stattdessen winkt ein gut gelaunter Projektsteuerer am Nachbartisch. Zufällig. Sei ja eine Schlacht gewesen heute Morgen. Habe sich aber nicht vermeiden lassen. Schließlich sei er als Steuerer schon vor der Sitzung unter Druck geraten. Er würde zu nachsichtig mit den Baukünstlern umgehen und musste daher dem Bauherrn beweisen, dass ein Steuerer sein Geld wert sei. Mit Vorwärtsstrategie und klarer Kante. Sein »Rhetorikgedöns« müsse er von Zeit zu Zeit wiederholen, »bitte nicht übel nehmen«. Ein Schreiben sei auch schon unterwegs. Rechtlich abgesichert. »Lassen Sie es einfach dabei bewenden und antworten Sie nicht«, insistiert er. »Zeigen Sie einfach Haltung.«
Architekt Baumann kommt ins Grübeln, denkt bei der Bestellung nicht an Hopfen und Malz, sondern: In vino veritas.
Schlachtfelder des Kammergründers

Das nebelumwobene Zauberwort Narrativ ist der Anker für eine retrospektive Betrachtung: die Erzählung der Entstehungsgeschichte der Architektenkammer Niedersachsen. Sie ist eng verknüpft mit dem Protagonisten und Gründungspräsidenten Friedrich Lindau, einer beharrlichen, willensstarken und nicht gerade zimperlichen Persönlichkeit. Lindau, renommierter freischaffender Architekt in Hannover, Jahrgang 1915, engagiert im BDA als Vorsitzender – und in Dauerfehde verbunden mit dem nicht minder machtvollen hannoverschen Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht, Jahrgang 1910. Zwei Egos, grundverschieden, aber mit ähnlichen Charakterzügen.
Beginnen wir bei Wein-Wolf in Hannover. Später regnerischer Nachmittag im Februar 1968. Traditionelle Montagsrunde der Architekten-Granden. Lindau, stattliche Erscheinung, aufrechte Körperhaltung, stechender Blick, referiert in gehobener Tonlage über seine langjährigen Bemühungen, dem Landtag den Entwurf eines »Gesetzes über den Schutz der Berufsbezeichnung Architekt und die Errichtung einer Architektenkammer für Niedersachsen« vorzulegen. Berichtet vom Wildwuchs beim Thema Bauvorlageberechtigung, weil »jeder Bauunternehmer und Handwerksmeister sich Architekt nennen darf«, von Ränkespielen innerhalb der Verbände, ständigem »Antichambrieren« bei Politikern, Rückschlägen beim Gesetzgebungsverfahren.
Aber jetzt sei er fast am Ziel mit der von ihm gegründeten »Landesgemeinschaft Niedersächsischer Architektenverbände«, einer Art »Vor-Kammer« mit ihm als gewähltem Repräsentanten. Darauf wolle er zunächst anstoßen. Schließlich sei er schon seit vielen Jahren im BDA »mit entsprechenden Gesetzgebungsentwürfen befasst« und habe Rat gesucht und gefunden bei einigen Länderkammern, die schon über Architektengesetze verfügen.
Und sein zweites Schlachtfeld wolle er den »verehrten Kollegen« auch nicht verhehlen. Der ewige Zwist um Beteiligungsfragen der Architektenschaft bei stadtplanerischen Entscheidungen in Hannover, bei Wettbewerben und Preisgerichten koste ihn zusätzlich viel Kraft. Mit Hillebrecht komme er überhaupt nicht klar. »Sitzt leider am längeren Hebel.« Lindau kritisiert wiederholt Hillebrechts »ahistorischen Neuaufbau« der gegliederten und aufgelockerten Stadtlandschaft mitsamt dem Ausbau zur autogerechten Stadt. Lässt nicht unerwähnt, dass sogar schon der »Spiegel« im Juni 1959 vom »Wunder von Hannover« berichtet hat. Der vielbeachtete Artikel mit Hillebrecht auf der Titelseite habe ihn zwar zur Weißglut gebracht, aber auch eine gewisse Bewunderung hervorgerufen.
Und das eigene Architekturbüro – drittes Schlachtfeld – müsse auch noch »unter Dampf« gehalten werden. Das alles erschöpfe ihn sehr, als ehemaliger Offizier komme ein Aufgeben jedoch nicht in Betracht. Aber er lege – um sich ganz auf die neue Aufgabe konzentrieren zu können – sämtliche Ämter im BDA nieder. Punkt. Verständnisvolles Schweigen in der Runde, die alsbald das Lokal etwas ratlos verlässt.
Einige Monate später erhält Lindau einen Anruf aus dem federführenden Wirtschaftsministerium: Die Überarbeitung des Gesetzestextes sei abgeschlossen und an die betroffenen Ressortminister zwecks Abstimmung übersandt. Alle Änderungswünsche der Architektenverbände seien berücksichtigt.
Ende September 1968, nach entsprechendem Kabinettsbeschluss, wird das Gesetz im Landtag als Regierungsvorlage eingebracht. Lindau, hocherfreut, lädt die führenden Verbandsvertreter zur Unterrichtung ins Operncafé ein. Dort erwartet sie eine handfeste Überraschung. Bei aller Beschäftigung mit sich selbst hatte die Architektenschaft vergessen, dass Studenten auch in Hannover gegen das Establishment rebellieren. Mit anarchischem Humor stürmt eine SDS-Truppe das gediegene Café. Die Revoluzzer kredenzen den Gästen Kaffee und Kuchen, den sie zuvor auf anderen Tischen abgeräumt hatten. Einige ältere Herrschaften echauffierten sich über »die Gammler, sollen sich gefälligst die Haare schneiden lassen und benehmen«. Lindau behält in dem Chaos die Nerven, versucht, die Gemüter zu beruhigen. Steht auf, schaut zufällig aus dem Fenster, sieht Hillebrecht kommen. Jetzt heißt es, ja Haltung bewahren.
Anmerkung des Autors: Diese Kolumne beruht in Teilen auf der Wiedergabe von »Erinnerungen eines neunzigjährigen hannoverschen Architekten« aus dem Buch von Friedrich Lindau »Architektur und Stadt«.
Aufbruch mit Rückzug

1968. Vor Friedrich Lindaus Augen erscheint Rudolf Hillebrecht wie eine Fata Morgana. Die Szene im hannoverschen Operncafé ist irreal. Während der Stadtbaurat munter die Eingangstür durchschreitet, und sich wundert, wie Ordnungshüter die »revoltierende« Studenten-Spaßtruppe – »diese Anarchisten«, wie ihnen von empörten Gästen nachgerufen wird – aus der Ausgangstür hinausdrängt, kommt ihm ein irritierter Friedrich Lindau entgegen. Gut gelaunt begibt sich Hillebrecht – schütteres Haar, schwere Hornbrille, knotenlos gebundene Krawatte – an den Tisch der Verbandsvertreter. Wolle mal einen »Vorschlag zur Güte« machen: Ob sich die Architektenschaft, wenn sie denn eine Architektenkammer zustande brächte, dazu durchringen könne, fortan kooperativ im Sinne der Stadtbaukultur mit ihm zusammenzuarbeiten? Das heiße aber auch, seine Entscheidungen zu akzeptieren und nicht immerzu »zu nörgeln«. Er wünsche noch gute Gespräche. Verabschiedet sich freundlich und schreitet von dannen. Die Runde ist sprachlos, Lindau konsterniert.
In den folgenden Monaten verdichten sich die Bemühungen der Architektenschaft zu einem berufsständischen Durchbruch auf der politischen Ebene. Am 28. Januar 1970 ist es so weit. Nasskaltes Wetter, zeitweise Schneeregen. Landtagssitzung. Beschlussfassung des Architektengesetzes. Ein großer, strahlender Sonnentag für den Berufsstand. Nach vorausgegangenen Lesungen und Änderungsanträgen wird das Gesetz verabschiedet, es tritt am 1. April 1970 in Kraft.
Aber Friedrich Lindau hadert mit sich und der Situation. Will nicht mehr antreten. Denn nun muss die neue Kammer organisiert und strukturiert werden. Verschlingt alles viel Kraft. Er findet kaum noch die nötige Zeit, sich um sein Architekturbüro zu kümmern. Hinzu treten innerhalb der Verbände oppositionelle Haltungen zutage, denen er sich entgegenstemmen muss. Er lässt sich aber umstimmen, als er erfährt, dass das Wirtschaftsministerium ihn nicht nur in die vorläufige Vertreterversammlung berufen will, sondern ihn auch als ersten Präsidenten der Architektenkammer Niedersachsen sieht.
Als Lindau dann am 5. Mai den großen Sitzungssaal des Ministeriums im ehemaligen Wangenheim Palais an Hannovers Friedrichswall erwartungsvoll betritt und die Kollegen sowie das große Presseaufgebot mit Rundfunk und Fernsehen wahrnimmt, »ergebe ich mich in mein Schicksaal«. In der ersten Sitzung der 25-köpfigen Vertreterversammlung wird Friedrich Lindau dann ohne Gegenkandidaten vorgeschlagen und einstimmig zum ersten Präsidenten der neugegründeten Architektenkammer Niedersachsen gewählt. Die Tätigkeit beginnt und macht ihm Freude trotz mancher »Nackenschläge«.
Die vorläufige, vom Ministerium berufene Vertreterversammlung muss per Gesetz innerhalb Jahresfrist durch eine gewählte ersetzt werden. Aufgrund der hohen Anzahl der zwischenzeitlich in die Mitgliederliste eingetragenen Architekten besteht nunmehr die Vertreterversammlung aus 69 statt bisher 25 Mitgliedern. Lindau wird »mit Mehrheit« in seinem Amt bestätigt, scheidet dann aber nach der Neuwahl 1975 aus dem Vorstand aus und widmet sich wieder ganz dem Architekturbüro.
Die Zeit vor und nach Gründung der Kammer muss äußerst arbeitsintensiv, aufreibend und voller Unwägbarkeiten gewesen sein. Mit etwas Weltuntergangsstimmung wie beispielsweise 1973, als Lindau seinen Tätigkeitsbericht mit »Schwanengesang« überschreibt: »Für viele Architekten ist das Ende des Berufsstandes gekommen«, lautet sein erster Satz. Die Gründe für die existenzielle Bedrohung sieht Lindau zum einen in der ständig steigenden Zahl von »Bauträgergesellschaften« und »Totalunternehmern«, die die Architekten in eine Randrolle drängen. Hinzu kommen eine Phase der Rezession in der Wirtschaft allgemein und restriktive Maßnahmen auf dem Bausektor. Viele Architekten seien daher gezwungen, ihre Selbstständigkeit aufzugeben oder Mitarbeiter zu entlassen. Das alles belastet Lindau sehr, zumal auch sein Büro von der misslichen Lage betroffen ist.
Die Dauerfehde mit Rudolf Hillebrecht ist zunächst beendet, denn dieser wird 1975 pensioniert, zeitgleich mit Lindaus Rückzug aus dem Amt des Präsidenten. Hillebrecht erhält 1980 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Hannover, Lindau fast zeitgleich vom Bundespräsidenten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in Würdigung seiner Verdienste um den Berufsstand der Architekten. Die Prozedur nimmt der niedersächsische Sozialminister Hermann Schnipkoweit in den Räumen der Kammer in der Bödekerstraße vor und lobt Lindau als »einen Architekten mit Leib und Seele«, dessen zahlreiche Bauten »beredtes Zeugnis ablegen«, auch für seine Bemühungen um den Wiederaufbau des kriegszerstörten Hannover.


