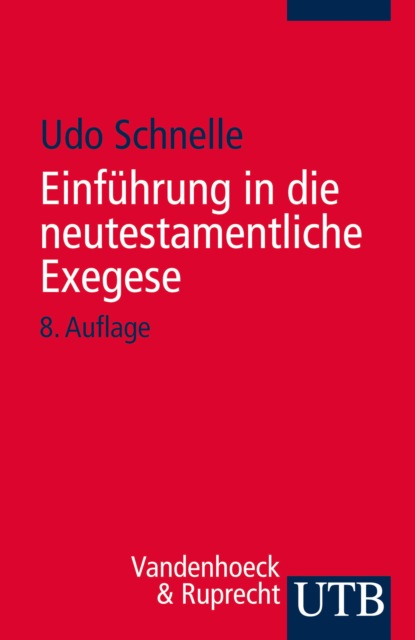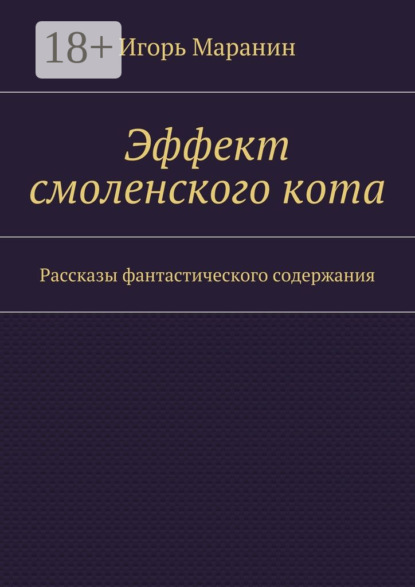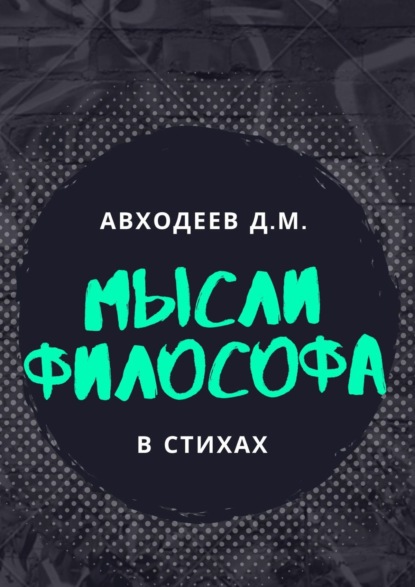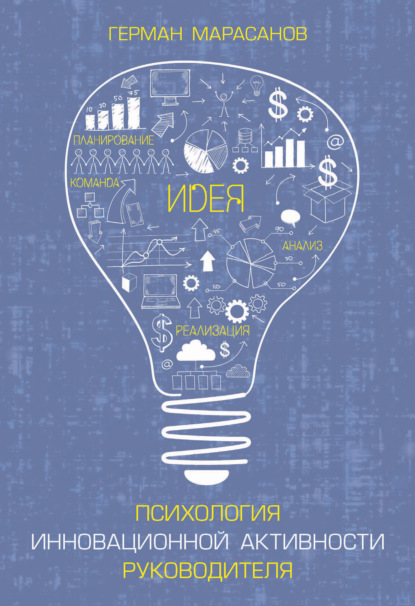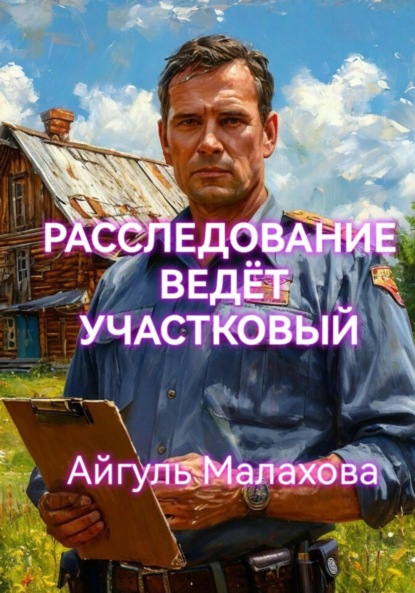- -
- 100%
- +
Theologische Revue. Zweimonatsschrift für den gesamten Bereich der Theologie und Religionswissenschaft, hg. v. d. katholisch-theologischen Fakultät Münster; Rezensionen zu ausgewählten Neuerscheinungen mit Schwerpunkt auf Katholischer Theologie.
Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie. Indices theologici, hg. von der Universitätsbibliothek Tübingen, Theologische Abteilung (mehrmals jährlich; Inhaltsverzeichnisse theol. Zeit- und Festschriften sowie Autorenregister).
2.3.13 Internet
Zu einem wichtigen Hilfsmittel wissenschaftlicher Arbeit hat sich das Internet entwickelt; es stellt aktuelle Informationen über weltweite Forschungsprojekte, Tagungen, Forschungstrends und inzwischen auch in großem Maße Publikationen bereit. Es zeichnet sich ab, dass neben dem klassischen Buchdruck und E-Books auch das Internet als Publikationsort an Bedeutung gewinnen wird. In so genannten »Blogs« werden populäre wie wissenschaftliche Publikationen vorgestellt und diskutiert; es wird über wichtige Vorträge und Tagungen informiert (z.B. http://ntweblog.blogspot.de/ von Marc Goodacre oder http://biblicalresources.wordpress.com/ von Torrey Seland). Neben dem Vorlesungsangebot und Studieninformationen der Fakultäten werden inzwischen oft »Reader« für Übungen, Vorlesungen etc. in das Netz eingestellt und können bei Bedarf abgerufen werden. Allerdings ist zu beachten, dass diese Informationen zumeist in direktem Zusammenhang mit der jeweiligen Lehrveranstaltung gelesen werden wollen, für die die Texte konzipiert wurden. Wissenschaftliche Hilfsmittel und Online-Angebote der jeweiligen Bibliotheken werden auf den universitären Computer-Arbeitsplätzen angeboten. Wer den Anschluss an diese Entwicklung nicht verlieren will, tut gut daran, sich frühzeitig über die Möglichkeiten zu informieren, die das Internet bietet.
Besonderes Gewicht kommt Internetseiten zu, die aktuelle Bücher und Aufsätze sowie Quellentexte, im Original und in Übersetzung, zugänglich machen. Zu den im Internet bereitgestellten Hilfsmitteln gehören kostenlose fremdsprachige Fonts, wie es beispielsweise bei http://www.ntgateway.com/greek-ntgateway/fonts/ geschieht. Zudem findet sich inzwischen eine Reihe von hilfreichen thematischen Bibliographien, die für ihre Benutzer eine erste Orientierung sein können. Vielfach sind diese Dienste kostenlos, aber vermehrt werden auch Gebühren erhoben oder wird eine Mitgliedschaft zur Nutzung notwendig, so dass auch beachtet werden muss, ob und welche Kosten bei der Nutzung entstehen.
Die Probleme, die mit einer unreflektierten Benutzung des World Wide Webs, verbunden sind, gilt es ebenfalls zu beachten. Jede Seite verfügt meistens über Verweise auf andere Internetseiten, sogenannte Links; so lassen sich einerseits wichtige Informationen erhalten und bisweilen neue Entdeckungen machen, andererseits können der Fokus auf die eigene Fragestellung und wertvolle Zeit durch zielloses Surfen im Internet verlorengehen. Jeder Benutzer von Internetseiten sollte sich Gedanken über die Seriosität und die wissenschaftliche Fundierung der besuchten Angebote machen. Nicht alles, was im Internet publiziert ist, genügt den strengen Maßstäben wissenschaftlicher Nachprüfbarkeit. Dies gilt auch für die populären Internetlexika wie »Wikipedia« (mit unterschiedlichen Artikeln von bisweilen abweichendem Informationsgehalt in Deutsch, Englisch und weiteren Fremdsprachen), die zum Teil Auskunft auf hohem und aktuellem Niveau, aber bisweilen auch subjektive und nicht hinreichend recherchierte Auskünfte enthalten. In diesen Lexika finden sich zudem Informationen zu den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die dabei helfen können, deren Werk in einen geistesgeschichtlichen und kulturellen Zusammenhang einzuordnen (s.a. das Biographisch-bibliographische Kirchenlexikon: http://www.bautz.de/bbkl/, das seit 2011 nicht mehr kostenfrei genutzt werden kann).
Der freie Zugang zu den Texten im Internet darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Materialien dem Urheberschutz unterliegen. Daher sind das Copyright und die Nutzungsbedingungen zu beachten. Zudem muss jeder aus dem Internet verwendete Text bzw. Textausschnitt in gleicher Weise sorgsam zitiert werden wie Abschnitte aus den Printmedien. Oftmals halten entsprechende Seiten ein Muster, wie der Text zitiert werden soll, vor. Die gelegentlich im Internet präsentierten vorläufigen Ergebnisse eines Forschungsprojekts besonders im Bereich der Archäologie sind zwar willkommene Hilfsmittel, es sollte aber nicht übersehen werden, dass die endgültigen Darstellungen häufig noch stark verändert werden und dass solche Versionen nicht in jedem Fall für die Veröffentlichung und damit auch nicht für die Verwendung in einer wissenschaftlichen Arbeit gedacht sind.
Auch wenn es inzwischen eine Reihe guter deutschsprachiger Internetseiten gibt, so ist Englisch als internationale Kommunikationssprache vorrangig. Auf den einzelnen Seiten sind meist auch Ansprechpartner zu den jeweiligen Themen genannt, mit denen bei Bedarf Fragen und Probleme via E-Mail besprochen werden können.
Auswahl aus Adressen, die für die ntl. Exegese von Interesse sind:
Im Folgenden werden vor allem Seiten benannt, die eine seriöse Auswahl an Links zu den wesentlichen Themen neutestamentlicher Exegese bereitstellen. Eine Fundgrube mit vielfältigen Verweisen zu anderen Internetadressen sind die Resource Pages for Biblical Studies (Links zu Bibeltexten und -übersetzungen, zur Mittelmeerwelt mit antiken Parallelen zum NT, Philo von Alexandrien), die von Prof. T. Seland gepflegt wird:
Resource Page for Biblical Studies
http://www.torreys.org/bible/
Zahlreiche Links zu Textausgaben, Bibliographien und technischen Hilfsmitteln enthält auch die von Dr. M. Goodacre betreute Seite The New Testament Gateway. Die Links finden sich unter thematischen Stichworten, aber auch unter den neutestamentlichen Schriften selbst.
The New Testament Gateway
http://www.ntgateway.com/
Neben kommerziellen Hinweisen auf das eigene Verlagsprogramm finden sich im Bibelportal der Deutschen Bibelgesellschaft wertvolle Arbeitsmaterialien: die Texte der aktuellen kritischen Bibelausgaben (BHS, LXX, NA28, Greek New Testament, Vulgata), eine elektronische Bibelkunde (basierend auf den Ausgaben von Rösel [AT] und Bull [NT]) und Unterrichtshilfen.
Bibelportal Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart
http://www.bibelwissenschaft.de/
Als neues Projekt ist der »Online-Bibelkommentar« (OBK) initiiert, der für die lehrplanrelevanten Texte des AT und des NT einen zugleich verständlichen wie fundierten Kommentar mit Praxisanregungen und Rezeptionsverweisen zur Verfügung stellen will:
http://www.bibelwissenschaft.de/bibelkommentar/ueber-das-projekt/
Ebenfalls ambitioniert ist »Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet« (WiBiLex), das mit bereits 1200 Artikeln ein Drittel der geplanten Einträge zu zentralen atl. und ntl. Stichworten von Aaron bis zum Zwölfprophetenbuch umfasst. Die Benutzung ist kostenfrei:
http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/
Für die neutestamentliche Textkritik, zu der ein Blick in die teilweise schwer zugänglichen Handschriften selbst gehört, bietet das Internet hervorragende Hilfsmittel. Eine wichtige Einstiegsseite stellt die Homepage des Instituts für Neutestamentliche Textforschung (INTF) dar, die auf die eigene Arbeiten wie auf zentrale Links verweist:
http://egora.uni-muenster.de/intf/
Neben dem New Testament Virtual Manuscript Room ist das als Prototyp bereit gestellte Hilfsmittel New Testament Transcripts, in das Transkriptionen von bedeutenden ntl. Manuskripten (vor allem die Papyri und die großen Bibelhandschriften) eingelesen wurden, zu nennen. Zur jeweiligen NT-Stelle werden die Lesarten der eingearbeiteten Manuskripte angezeigt und kenntlich gemacht:
http://nttranscripts.uni-muenster.de/
Auch einzelne Handschriften sind inzwischen digital erfasst und können somit über das Internet auf dem jeweiligen Computer gelesen werden. Ein herausragendes Beispiel, was durch eine internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet gegenwärtig geleistet wird, ist die sukzessive digitale Erfassung des Codex Sinaticus unter Beteiligung der Universitätsbibliothek Leipzig. Neben der Handschrift wird ihr Text durch Transkription und Übersetzung zugänglich gemacht:
http://www.codexsinaiticus.com/de/
Unersetzlich für die Arbeit an den antiken Parallelen ist The Perseus Digital Library. Hier findet sich eine Anzahl von antiken Texten und (vornehmlich englischsprachigen Übersetzungen) von klassischen Autoren bis hin zu Papyri. Das Angebot umfasst auch Sekundärliteratur und Lexika:
The Perseus Digital Library
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
Für die Literatursuche ist die bibelwissenschaftliche Datenbank der Universität von Innsbruck äußerst hilfreich:
Bibelwissenschaftliche Literaturdokumentation Innsbruck (BILDI)
http://www.uibk.ac.at/bildi/
Einige für die Exegese interessante wissenschaftliche Zeitschriften stellen ihre Artikel im Internet ein9; vgl. als Beispiele:
Biblica
http://www.bsw.org/project/biblica/
Review of Biblical Literature
http://www.bookreviews.org/
Zudem informiert der Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie der Universität Tübingen, deren Hefte im Internet eingesehen werden können, über theologische Beiträge in Fachzeitschriften, Festschriften und Kongressschriften (einsehbar für die letzten drei Monate):
http://www.ixtheo.de/zid-curr/index.html
Eine zentrale Funktion des Zeitschrifteninhaltsdienstes stellt die recherchierbare Aufsatzdatenbank dar:
http://www.ixtheo.de/
Das Internet als Informationsquelle ist nach wie vor im Wachsen begriffen. Ständig kommen neue Angebote hinzu. Um sich das Material zu erschließen, sind Suchmaschinen notwendig10. Einige Seiten werden jedoch nicht weiter aktualisiert, aus dem Netz genommen oder wechseln kurzfristig ihre Adresse. Auch bei solcher Suche steht der Erfolg nicht immer in Relation zum Aufwand. Daher ergeben sich einige Fragen und Grundregeln, die für ein erfolgreiches Arbeiten mit dem Internet zu empfehlen sind:
Klärung vor der Recherche:
1. Warum wird das Internet benötigt?
2. Präzise Festlegung, welche Information/Hilfe die Internetrecherche erbringen soll.
3. Daraus sollten sich klare Suchbegriffe ergeben.
4. Festlegung eines Zeitlimits.
Prüfung einer zu verwendenden Internetseite:
1. Wer ist für die Seite verantwortlich und was qualifiziert diese Seite. Welchem Interesse dient die Darstellung?
2. Wann wurde die Seite zuletzt aktualisiert?
3. Entstehen bei ihrer Nutzung Kosten und in welcher Höhe?
Rezeption:
Genauer Verweis auf die Seite, Aufnahme in das Literaturverzeichnis, nachprüfbare Zitation des Inhalts und Angabe des Zugriffdatums.
Bei der Beachtung dieser einfachen Grundüberlegungen ist die Beschäftigung mit dem Internet kein Freizeitvergnügen, sondern wird zu einem vollwertigen Hilfsmittel der exegetischen Arbeit.
8 Vgl. zur Einführung in die Septuaginta-Forschung R. Hanhart, Septuaginta, in: W. H. Schmidt u.a., Altes Testament, GT 1, 1989, 176–196.
9 Zum aktuellen Publikations- und Leistungsstand vgl. folgende Linkliste: http://www.ntgateway.com/tools-and-resources/journals/.
10 Für die Suche können die bekannten Internetsuchdienste verwendet werden. Hilfreiche Ratschläge für die Literaturrecherche generell aber auch zu wissenchaftlichen Suchmaschinen hält der »LOTSE Theologie« (http://lotse.unimuenster.de/theologie/index-de.php) bereit.
3. Textkritik
Literatur
ALAND, K. u. B., Der Text des Neuen Testaments, 21989. – ALAND, K. u.a., Bibelhandschriften II, TRE 6 (1980), 114–131; Bibelübersetzungen, TRE 6, 161–215. – ELLIOTT, J. K. – MOIR, I., Manuscripts and the Text of the New Testament, 1995. – GREEVEN, H., Text und Textkritik der Bibel II. Neues Testament, RGG3 VI (1962), 716–725. – HUNGER, H. u.a. (Hg.), Die Textüberlieferung der antiken Literatur und der Bibel, 21988. – KÜMMEL, W. G., Einleitung, 452–491. – MAAS, P., Textkritik, 31956. – METZGER, B. M., Der Text des Neuen Testaments, 1966. – DERS., A Textual Commentary on the Greek New Testament, 21994. – PARKER, D. C., An Introduction to the New Testament Manuscripts and their Texts, Cambridge 2008. – POKORNÝ, P. – HECKEL, U., Einleitung, 88–114. – TROBISCH, D., Die 28. Auflage des Nestle-Aland. Eine Einführung, 2013 – WIKENHAUSER, A. – SCHMID, J., Einleitung, 65–202.
3.1 Definition
Textkritik ist die Feststellung von Wortlaut und Schreibweise eines Textes, wie diese für den ursprünglichen Autor anzunehmen sind. Die Textkritik hat somit die Aufgabe, auf der Grundlage der Textzeugen den ältesten erreichbaren Text des Neuen Testaments zu rekonstruieren.
Unerlässlich ist die Textkritik aus historischen und theologischen Gründen:
a) Da die Originale (αὐτόγραφα) der neutestamentlichen Schriften nicht mehr vorhanden sind, muss der Originaltext aus der späteren Überlieferung der Texte in Handschriften, Lektionarien, Zitaten bei frühen christlichen Autoren und Übersetzungen erschlossen werden. Allein über 5.500 Abschriften auf Papyrus, Pergament und Papier liegen in griechischer Sprache vor. Dabei kann die ursprüngliche Textgestalt mit einer der überlieferten Textfassungen identisch sein. Zwar gibt es zwischen den einzelnen Textzeugen eine durchschnittliche Übereinstimmungsquote von ca. 85 Prozent, aber sie kann bei den einzelnen ntl. Schriften variieren (z. B. Apostelgeschichte, Johannesapokalypse) und es bleibt immer die Aufgabe der Textkritik, die als ursprünglich anzusehende Lesart zu finden. Selten enthält keine der überlieferten Textfassungen den ursprünglichen Text, so dass dieser hypothetisch erschlossen werden muss (Konjektur)11. Somit ist der rekonstruierte ‚Urtext‘ neutestamentlicher Schriften eine hypothetische Größe, da er immer auf Wahrscheinlichkeiten und Vermutungen beruht.
b) Geht es in der neutestamentlichen Exegese um die Auslegung und das Verstehen der neutestamentlichen Texte, so muss erarbeitet werden, was die neutestamentlichen Schriftsteller selbst uns überliefert haben, nicht aber, was in der Textüberlieferung sekundär hinzukam.
Dahinter steht auch ein hermeneutisches Interesse: Man muss zum ursprünglichen Text zurückgehen, weil nur er Auskunft über die Theologie der neutestamentlichen Schriftsteller geben kann.
3.1.1 Gegenstand der Textkritik ist also die Überlieferung von Texten, die im Original nicht mehr vorhanden sind.
3.1.2 Ziel der Textkritik ist die hypothetische Feststellung derjenigen Fassung des Textes, die der Autor einst angefertigt hat.
3.1.3 Arbeitsgrundlage sind Textausgaben mit Angaben über die divergierende Textüberlieferung und deren Bezeugung, insbesondere Nestle-Aland27.28.
3.2 Lernziele
Die Studierenden sollen über Grundkenntnisse der Geschichte des neutestamentlichen Textes und des Wertes seiner Hauptzeugen verfügen.
Sie sollen die Fähigkeit zur technischen Benutzung des kritischen Apparates des NT Graece von Nestle-Aland27.28 besitzen und in der Lage sein, die Grundregeln textkritischer Entscheidungen anzuwenden.
Die Studierenden sollen schließlich aufgrund kritischer Sichtung der Textzeugen und alten Übersetzungen den ursprünglichen Wortlaut (,Urtext‘) eines vorgegebenen Textes rekonstruieren und die Textvarianten erklären können.
3.3 Geschichte der Textkritik
1514 wurde die erste griechische Ausgabe des Neuen Testaments gedruckt. Sie erschien im Auftrag des Kardinals Ximenez (gest. 1517) in der spanischen Universitätsstadt Alcala (lat. ‚Complutum‘) und wurde seit 1502 durch spanische Gelehrte vorbereitet. Das vom Kardinal in Auftrag gegebene Gesamtwerk umfasste das Alte und Neue Testament, wobei für das Alte Testament der hebräische Text, die Vulgata und die Septuaginta in drei Kolumnen nebeneinander, für das Neue Testament der griechische und lateinische Text abgedruckt wurden. Diese mehrsprachige Bibelausgabe (= Polyglotte) erhielt erst 1520 die kirchliche Druckerlaubnis, so dass die ‚complutensische Polyglotte‘ wohl die erste gedruckte griechische Ausgabe des Neuen Testaments (1514), nicht aber die erste veröffentlichte Ausgabe enthält.
Dieser Ruhm fällt der griechischen NT-Ausgabe des holländischen Humanisten ERASMUS VON ROTTERDAM (1469–1536) zu. Er fertigte auf Drängen eines Baseler Verlegers, der von dem spanischen Unternehmen gehört hatte, 1515 in großer Eile eine Ausgabe an, die 1516 auf dem Markt erschien und verlegerisch ein Erfolg wurde. Zweifelhaft hingegen war der wissenschaftliche Wert dieser Ausgabe; denn Erasmus musste sich hauptsächlich auf minderwertige Minuskeln aus dem 12. Jahrhundert stützen und hatte für die letzten Verse der Apokalypse überhaupt keine griechische Handschrift zur Verfügung, so dass er sie nach dem Vulgatatext ins Griechische zurückübersetzen musste. Dennoch war die NT-Ausgabe des Erasmus von sehr großer Bedeutung, denn nicht nur Luther benutzte die zweite Auflage von 1519 als Grundlage für seine Bibelübersetzung, sondern zahlreiche Nachdrucke des in späterer Zeit nur teilweise verbesserten Erasmustextes sicherten ihm den Vorrang.
Auch die griechischen NT-Ausgaben des Pariser Druckers und Verlegers ROBERT ESTIENNE (lat. Stephanus) basierten zum großen Teil auf der Erasmusedition. Stephanus führte als erster einen kritischen Apparat und die bis heute gültige Verseinteilung ein, und seine Ausgaben begründeten den textus receptus (= allgemein anerkannter Text)12. Dieser galt nicht nur bis zum 19. Jahrhundert im Wesentlichen als unantastbar, er hat vor allem aus liturgischen Gründen bis in die Gegenwart hinein Bedeutung (vgl. den Lobpreis am Ende des Vaterunsers in Mt 6,13).
Durch JOHANN ALBRECHT BENGEL (1687–1752) trat die neutestamentliche Textkritik in ein neues Stadium ein. Der württembergische Ausleger tastete zwar den ‚textus receptus‘ kaum an, nannte aber jeweils die Lesarten, die seiner Meinung nach ihm gegenüber den Vorzug verdienten. Zudem war Bengel der erste, der die Textzeugen in zwei große Gruppen unterteilte und bis heute bewährte Regeln der Textkritik einführte. – Die Einteilung der Handschriften in Gruppen führte JOHANN JAKOB GRIESBACH (1745–1812) weiter, der eine alexandrinische, westliche und byzantinische Textrezension unterschied. Griesbach stellte ferner zahlreiche vorbildliche Regeln für die Textkritik auf, und er wagte es als erster, den ‚textus receptus‘ an vielen Stellen aufzugeben. – Der klassische Philologe KARL LACHMANN (1793–1851) brach gänzlich mit dem ‚textus receptus‘. Er erstellte eine NT-Ausgabe, die nur auf der kritischen Bewertung der einzelnen Textzeugen beruhte.
Große Bedeutung für die Erforschung des neutestamentlichen Textes hat der Leipziger Neutestamentler CONSTANTIN VON TISCHENDORF (1815–1874). Er entdeckte im Katharinenkloster am Sinai den ‚Codex Sinaiticus‘ (1844/1859)13 und legte diese im 4. Jahrhundert entstandene Majuskel seiner großen und bis heute wertvollen Edition zugrunde (,Editio octava critica maior‘, 1869–1872). Internationale Anerkennung errang die von den Engländern B. F. WESTCOTT (1825–1901) und F. J. HORT (1828–1892) veröffentlichte NT-Ausgabe (1881/1882), die sich durch eine zuverlässige Textrekonstruktion und einsichtige methodische Kriterien auszeichnet. Wichtig sind für die neutestamentliche Textkritik die Unterscheidungen, die Westcott-Hort bei ihrer Erforschung der Verwandtschaft zwischen den einzelnen Textzeugen trafen. Danach gibt es vier Haupttypen neutestamentlicher Texte: 1. den westlichen Text (Hauptvertreter ist der ‚Codex Bezae‘ D 05); 2. den alexandrinischen Text (Hauptvertreter ‚Codex Ephraemi‘ C 04 und ‚Codex Regius‘ L 019); 3. den neutralen Text (Hauptvertreter ‚Codex Sinaiticus‘

Den modernen ‚textus receptus‘ schuf EBERHARD NESTLE (1851–1913) mit seinem im Auftrag der Württembergischen Bibelanstalt 1898 veröffentlichten ‚Novum Testamentum Graece‘. Nestle verzichtete bewusst auf eine eigene Textfassung und legte seiner Ausgabe die drei großen wissenschaftlichen Editionen des 19. Jahrhunderts zugrunde, nämlich Tischendorf (T), Westcott-Hort (H) und zunächst R. F. Weymouth, an dessen Stelle seit der 3. Auflage (1901) die Ausgabe von B. Weiß (W) trat. In seinem ‚apparatus criticus‘ berücksichtigte Nestle nicht nur die abweichenden Lesarten von HTW, sondern in einem zweiten Apparat auch Lesarten von neutestamentlichen Handschriften. Die Berücksichtigung der Originalzeugen wurde durch den Sohn ERWIN NESTLE (1883–1972) und durch KURT ALAND (1915–1994), seit der 21. Aufl. von 1952 Mitherausgeber) ständig ausgebaut, wobei insbesondere neugefundene Papyri von großer Bedeutung waren.
Bis zur 25. Aufl. von 1963 setzte auch Nestle-Aland durch Handschriftenfamilien repräsentierte Texttypen voraus, wobei bis in die Gegenwart hinein vier Haupttextformen des neutestamentlichen Textes unterschieden werden15:
1. Der neutrale (oder ‚alexandrinische’ bzw. ‚hesychianische’) Text (Nestle25:

Dieser vor allem durch die Majuskeln

2. Der westliche Text
Wie schon der Name andeutet, ist dieser Texttyp vor allem im westlichen Mittelmeerraum bezeugt. Er liegt vor in den griechisch-lateinischen Handschriften D 05, D 06, F 010, G 012 sowie in der altlateinischen Übersetzung und in lateinischen Kirchenschriftstellern. Relativ früh ist er aber auch in Ägypten und dem Osten nachweisbar (syc.s.). Charakteristisch für den westlichen Text ist seine Vorliebe für die Paraphrase (vor allem in der Apg). Bei Übereinstimmung mit dem alexandrinischen Text ist der westliche Text von hohem Wert, sonst aber eher von geringerer Bedeutung.
3. Der Koinetext (Nestle25:

Der wegen seiner allgemeinen (= κοινή) Verbreitung so genannte Text (auch byzantinischer oder Reichstext genannt) wird vor allem durch die Majuskeln A 02 (nur für die Evangelien), E 07, F 09, G 011, H 013 und die überwiegende Mehrzahl der Minuskeln bezeugt. Hatte Hort diesen Texttypus, der seit dem 4. Jh. vorherrscht und sehr wahrscheinlich auf eine frühere Rezension zurückgeht, für völlig wertlos erklärt, so setzte sich in neuerer Zeit vor allem durch die Übereinstimmung einzelner Lesarten des Koinetextes mit neu entdeckten Papyri die Erkenntnis durch, dass auch dieser Text alte Lesarten bewahrt hat. Charakteristisch ist für den Koinetext die Glättung sprachlicher Härten, die inhaltliche Harmonisierung und das angestrebte gute Griechisch.
4. Der Cäsareatext
Die Bezeichnung ‚Cäsareatext‘ erklärt sich aus der Vermutung von B. H. Streeter, dass Origenes diesen Text nach seiner Übersiedlung von Alexandria nach Cäsarea verwendet habe und diese Textform dort auch entstanden sei. Nach neueren Untersuchungen16, vor allem zu P37 und P45, soll Origenes diesen Texttyp neben dem alexandrinischen Text schon in Alexandria und dann in Cäsarea benutzt haben. Von besonderer Bedeutung ist der Cäsareatext für Mk durch die Majuskeln Θ 038, W 032, die Minuskeln 28.565.700 und die Minuskelfamilien f1 und f13.