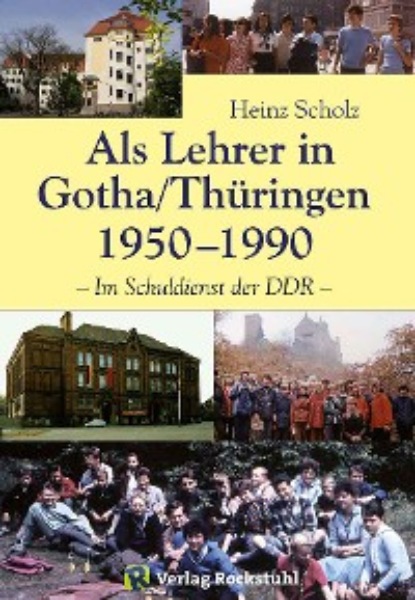- -
- 100%
- +
Trotzdem war ich weiterhin gut zur Hälfte meiner Pflichtstunden im Fach Geschichte eingesetzt. Der Anfang der 50er Jahre gültige Lehrplan für die Klassen 5 – 8 ließ nach meiner Meinung noch einen „vernünftigen“ Geschichtsunterricht zu. Es war möglich, den Lehrstoff so zu interpretieren, dass ich Gesagtes mit gutem Gewissen verantworten konnte. Natürlich war anstelle ausführlicher Kriegsbeschreibungen (wie in meiner Schulzeit) jetzt mehr Raum für die Entwicklung der Arbeiterbewegung im 19. und 20. Jahrhundert eingeräumt worden, auch für die revolutionären Ereignisse in Frankreich, Deutschland und Russland. Dagegen hatte ich nichts einzuwenden, wusste ich doch, dass ich von diesen bedeutenden geschichtlichen Entwicklungen und Ereignissen früher, in meiner Volksschule, so gut wie nichts erfahren hatte.
Jetzt als Geschichtslehrer war ich bestrebt, überzogene Glorifizierungen und einseitige oder überhöhte Deutungen zu vermeiden und die Schüler an kritische und nachdenkliche Betrachtung, besonders der jüngsten Geschichte, zu gewöhnen. Wenn möglich, ließ ich mich in den Klassen 7 und 8 einsetzen, da in diesen Klassen laut Lehrplan der Geschichtsablauf von der Französischen Revolution bis 1945 behandelt wurde. Natürlich in einem Überblick. Besonderen Wert legte ich darauf, die geschichtliche Entwicklung vom Wilhelminischen Deutschland mit I. Weltkrieg über die Weimarer Republik bis hinein in die Hitlerdiktatur möglichst durchdringend verständlich zu machen. Es war mir (auf Grund meiner eigenen Erfahrungen) wichtig, die frühen und komplexen Wurzeln des Nazismus bloßzulegen und zu erarbeiten und mahnend zu zeigen, wie fast ein ganzes Volk (teils „ahnungslos“) in den faschistischen Irrweg hineingezogen oder hinein- „erzogen“ worden ist … und einen verbrecherischen Krieg mit Völkermord bis zum bitteren Ende durchstehen musste.
Im Laufe der 50er und 60er Jahre wurde der Geschichtslehrplan aus der Nachkriegzeit überarbeitet und schließlich durch einen neuen ersetzt. Die nun geforderten Erziehungsziele und Bildungsinhalte mussten der „Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft“ angepasst werden und der Erziehung und „Herausbildung eines neuen sozialistischen Menschen“ dienen. Die Ideologisierung nahm im Geschichtsunterricht zu. Vor allem musste künftig die Nachkriegsgeschichte mit Teilung Deutschlands und Staatenbildung auf beiden Seiten und der „verschärfte Klassenkampf“ der „fortschrittlichen Arbeiterklasse“ in der DDR und „ihrer führenden Partei“, der SED, gegen die „reaktionäre Bourgeoisie“ und gegen den „krieglüsternen Imperialismus in der BRD“ breiten Raum einnehmen. Ebenso … jetzt „verstärkt“ der „konsequente Friedenskampf der sozialistischen Bruderstaaten“, die „wissenschaftlich-technische Überlegenheit der Sowjetunion“, der „großartige Aufbau des Kommunismus“ in der Sowjetunion und schließlich auch die „führende Rolle der SU bei der Eroberung des Weltraumes“. Unüberhörbar auch die penetranten propagandistischen Lobeshymnen auf „unsere Deutsche Demokratische Republik“ mit ihren „hervorragenden Genossen an der Spitze“ und auf die „überragenden Führer der KPdSU und des sozialistischen Weltfriedenslagers“.
So wurde anstatt objektiver Sachlichkeit die politische Agitation in den Vordergrund gestellt. Dadurch hatte es der Lehrer immer schwerer, ein objektives bzw. persönliches Geschichtsverständnis im Unterricht frei und offen vertreten zu können und ein „vernünftiges“ Geschichtsbewusstsein zu vermitteln. – Obwohl ich Geschichte gern und mit Passion unterrichtet habe und als Geschichtslehrer immer noch gebraucht wurde, zielte ich in den folgenden Jahren darauf hin, mich allmählich von „Geschichte“ zurückziehen!
Staatsbürgerkunde hatte ich auch zu unterrichten, weil man meinte: Wer in Geschichte unterrichten kann, der kann das auch in Staatsbürgerkunde. Geschichts- und Staatsbürgerkundelehrer wurden zuweilen als die „Chefideologen“ einer Schule betrachtet.
Anfang der 50er Jahre fand ich den Unterricht in Staatsbürgerkunde nicht so problematisch. Nach der Gründung der DDR, in den Jahren 1950/51, nahm die Erörterung und Erläuterung der neuen „demokratischen“ Staatsverfassung breiten Raum ein. Der Aufbau des Staates, die Funktionen von parlamentarischen und exekutiven Instanzen wurden theoretisch besprochen. Auch die Rechte und Pflichten der Bürger … Das sah ja, theoretisch gesehen, damals einigermaßen demokratisch aus. Man konnte es auch so deklarieren und dazu auffordern, für eine demokratische Verwirklichung einzustehen.
In den Jahren danach nahmen die politischen Zwänge zu. Im Fach Staatsbürgerkunde (eine Zeit lang auch Gegenwartskunde genannt) mussten vorwiegend aktuelle politische Themen, oft auch kurzfristig eingeschoben, behandelt werden. Immer öfter bezogen auf Partei- bzw. Parteitagsbeschlüsse der SED oder der KPdSU, auf die „Remilitarisierung“ in der BRD, vor allem aber den „Aufbau des Sozialismus“ betreffend oder ein von der SED befohlenes Wahlprogramm der „Nationalen Front des Demokratischen Deutschland“. Alle diese „Aufklärungs“-Themen hatten stets einer aktuellen politisch-propagandistischen Kampagne zu dienen.
Irgendwann in jenen Jahren wurde verordnet, dass jeder Klassenlehrer einmal in der Woche eine „Zeitungsschau durchführen“ musste. Aktuelle Berichte von politischen Geschehnissen oder Reden von Walter Ulbricht oder von sonst wem mussten auszugsweise gelesen und erläutert werden. Die meisten Kollegen/innen absolvierten diesen Auftrag formal. Schüler brachten das „Neue Deutschland“ mit, und da wurde einfach ein Textausschnitt vorgelesen. Somit konnte, ins Klassenbuch eingetragen, die Erfüllung dieser Pflichtaufgabe nachgewiesen werden.
Der Deutschunterricht blieb damals vor überzogener Politisierung verschont. – Für relativ hohe Anforderungen in Orthographie und Grammatik war ein hoher Anteil der Deutsch-Unterrichtsstunden vorgesehen. Wir hatten damals mehr Zeit zum Üben als in späteren Jahren. Es wurden zahlreiche Übungsdiktate und Kontrollarbeiten geschrieben, was zu guten Ergebnissen beitrug. Dagegen waren speziell für den Sprachlichen Ausdruck wenig Unterrichtsstunden eingeräumt. Den Literaturlehrplan in den Klassen 5 – 8 hielt ich für angemessen. Er bot geeignete Beispiele aus schöner Lyrik und guter Prosa, vorwiegend aus der deutschen Literatur des 18./19. Jahrhunderts, folgte auch der Vermittlung eines klassischen humanistischen Menschenbildes und flankierte so indirekt die harte Klassenkampf-Ideologie. Zwar gab es neben vertretbaren antifaschistischen Gedichten oder Texten von Gorki, Weinert und Becher … auch einige schwache Lesebuchtexte aus der „neuen sozialistischen Literatur“, mit denen der „neue, sozialistisch Mensch“ der Gegenwart zum Vorbild erhoben werden sollte. Doch diese Absicht führte bei Schülern wie bei Lehrern nicht zum gewünschten Erfolg.
Wie im Laufe der 50er Jahre auch der Deutsch-Lehrplan infolge der „politischen und gesellschaftlichen Entwicklung“ verändert wurde, das kann man an Hand folgender Beispiele sehen:
Bis in die Mitte der 50er Jahre war nach dem Deutschlehrplan für die 8. Klasse ein Ausschnitt aus Schillers „Wilhelm Tell“ mit der Rütliszene zu behandeln. Wir wissen: „Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr … “! Wenn ich mich recht erinnere, war der Rütli-Schwur sogar einmal zum zentralen Thema des Deutsch-Aufsatzes in einer Abschlussprüfung am Ende der 8. Klasse erhoben worden. Es ist völlig klar: Wenige Jahre später, mit der deutlichen Abgrenzung von der „feindlichen“ Bundesrepublik und erst recht nach dem „Mauerbau von 1961“, war der Rütli-Schwur im Lehrplan gestrichen.
Ein andermal, ich glaube 1951, war ich als Hospitant bei einer Modell-Unterrichtsstunde meiner Kollegin und damaligen Mentorin B. zugegen. Der Schulrat Linde (in seiner Thälmann-Mütze) war gekommen, um zu sehen und zu kontrollieren. Marlies B. hatte in dieser Unterrichtsstunde im Fach Erdkunde die Schüler in den Stoffkomplex „Der Doppelkontinent Amerika“ einzuführen. Sie eröffnete ihren Unterricht, indem sie aus einer großen Einkaufstasche ein Paket, ein ziemlich auffällig präpariertes Postpaket, herausholte und mit lebendiger Beredsamkeit den Schülern erzählte, dass sie dieses (oder so ein ähnliches) Paket jüngst von ihren Verwandten aus Amerika geschickt bekommen habe! Die Anschrift des Absenders wurde groß und breit an die Tafel geschrieben, und natürlich dann die Frage nach Ort und Land des Absenders in den Mittelpunkt gestellt. Mit dieser spannenden „Zielangabe“ ging man nun daran, mit Hilfe der aufgerollten Landkarte und der Schüleratlanten den Zielkontinent Amerika und insbesondere die Stadt des Absenders in den USA topographisch auszumachen. Auf diese Weise wurden die Schüler – nach dem didaktischen Prinzip „Vom Nahen zum Entfernten“ – hingeführt zu jenem fernen Kontinent und Land, das man in der Folge nun im Unterricht näher kennen lernen wolle. Der Schulrat lobte danach diesen lebendigen, geschickten methodischen Griff der Lehrerin! – Es liegt auch auf der Hand, was ich sagen will: Sechs Jahre später hätte ein Schulrat die Kollegin Beck für diesen „politisch verantwortungslosen Missgriff“ hart verurteilt … Nebenbei bemerkt: Heute, im Medienzeitalter, wo sich schon zehnjährige Kinder – ohne Hilfe der Schule – „in Amerika gut auskennen“(!?), erscheint diese einfache Zielorientierung fast simpel und beinahe lächerlich. Doch man sollte bedenken: Solch eine „leicht und interessant gemachte“ Unterrichtseinführung vor 50 Jahren berücksichtigte ganz gewiss das eingeengte Bildungsspektrum, das als Folge der „Gleichschaltung“ des Denkens und Wissens in der Nazi-Ära noch in den Nachkriegsjahren bei vielen Menschen nachwirkte. Ich denke, auch wir Neulehrer-Studenten waren auf dieses Wissensniveau eingestellt worden – didaktisch und methodisch.
Der frontale Unterricht hatte damals den Vorrang. Nach Einstimmung oder Hinführung folgte der Lehrervortrag, und Wiederholungen und Übungen dienten danach der Festigung des Wissens und Könnens. Die Mädchen und Jungen folgten gutwillig unserer Unterrichtsführung. Sie hatten Respekt vor den Lehrern, waren aus Gewohnheit autoritätsgläubig und fügten sich im Allgemeinen unseren Forderungen. Wenn man nicht grundsätzlich ungeschickt oder unpädagogisch vorging, entstanden kaum nennenswerte Disziplinprobleme. Natürlich gab es in jeder Klasse den einen oder anderen „schwierigen“ Schüler, auf den sich der Lehrer einzustellen hatte. Doch die damals an unserer Schule herrschende gute Lern- und Arbeitsatmosphäre begünstigte die Arbeit des Lehrers. Die öffentliche Meinung unter den Schülern einer Klasse war fast immer gegen Faulenzer und Störenfriede gerichtet. Eine solche Mehrheit war möglich, weil damals – nach dem Prinzip der Einheitsschule – bis zur 8. Klasse alle Kinder, „gute“ wie „schlechte“ Schüler, gemeinsam unterrichtet wurden und die „positiven“ in der Klassengemeinschaft „guten“ Einfluss nehmen konnten. Zum anderen waren die Nachkriegsjahre mit Not und Armut, auch mit der üblichen oder erneut erzwungenen Unterordnung nicht dazu angetan, dass man sich mutig oder absichtlich dem Lehrer widersetzt hätte. Ich denke auch, Schüler und Lehrer fühlten sich – ähnlich wie in einer Notgemeinschaft – miteinander verbunden. Und wenn der Lehrer sichtbar einen Fehler machte oder irgend etwas nicht wusste und dies offen eingestand, dann verlor er längst nicht sein Gesicht. „Das müssen wir klären!“ so könnte er gesagt und damit die Kinder einbezogen haben in das selbstverständliche gemeinsame Streben nach Wissen und Können.
Ich fühlte mich als Lehrer gut damals – im Unterricht wie im Zusammensein mit meinen Schülern. Man vertraute mir … .
Ein erschwerender Umstand für uns Lehrer/innen waren die hohen Klassenstärken. Meine erste Klasse 1950 hatte 45 Mädchen und Jungen. Da saßen sie eng gedrängt in den alten Viersitzer-Bänken; jedoch gab es dadurch noch genügend Platz im Klassenraum, und der Lehrer konnte diesen dichten Schüler-Block gut übersehen. Auch die schriftlichen Korrekturen in so hoher Zahl forderten vom Lehrer mehr Kraft und häusliche Arbeitszeit. Gemäß dieser hohen Klassenfrequenz brauchte der Klassenlehrer auch mehr Zeit für die individuelle Förderung und Betreuung der Schüler und für die Zusammenarbeit mit den Eltern. – Nur langsam konnte man in den folgenden Jahren die Klassenstärken reduzieren.
Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder
Sorge und Skrupel bereitete mir, besonders in jenen ersten harten Jahren der DDR, die gerechte Bewertung von Leistungen, Charakter und Persönlichkeit eines Schülers unter Berücksichtigung seines sozialen Milieus. Denn die Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder, ein vom Staat dem Lehrer vorgegebener politisch-ideologischer Erziehungsauftrag, hatte höchste Priorität!
Diesem Prinzip wollte ich, selbst aus dem Arbeiterstand kommend, auf vernünftige Weise gern nachkommen, wenn man bedenkt, dass bei Kindern aus unbemittelten Arbeiterfamilien Bildungsvorlauf und -unterstützung geringer war als bei Kindern in Familien des Bildungsbürgertums. Und es ist unter demokratischen Verhältnissen selbstverständlich, den Unbemittelten zu gleichen Bildungschancen zu verhelfen und sich solcher benachteiligten Schüler in der Schule entsprechend anzunehmen.
Aber die Vorschrift, Arbeiterkinder aus rein politischen Gründen zu privilegieren, sie anderen tüchtigen und ebenso charakterlich wertvollen Kindern vorzuziehen, das hat in Einzelfällen zur Gewissensbelastung des Lehrers geführt. Da wurde beispielsweise ein „bürgerlicher“ Schüler mit einem Leistungsdurchschnitt von 1,7 abgelehnt, während ein Arbeiterkind mit 2,3 zum Oberschulbesuch zugelassen wurde. Besonders, wenn es sich bei dem Kind „bürgerlicher Eltern“ um einen leistungsfähigen, sozial positiv eingestellten, charakterlich anständigen jungen Menschen handelte, war eine Zurückstellung und Ablehnung von Seiten der Schule kaum zu unterstützen. Man hätte beiden Schülern zu gern die Chance eines Oberschulbesuchs eingeräumt. Wahrscheinlich hätte der Junge mit 2,3 auch fleißig gearbeitet, hätte seine sozial begründeten Defizite ausgleichen können und wäre gut bis ins Abitur gekommen. Aber den bis dato Leistungsfähigeren einfach ausschließen, das konnte man ebenso nicht vertreten. Infolge dieser Förderungsbedingungen durfte jede „Grundschule“ bei den Abgängern nach der 8. Klasse ein vorgegebenes Limit von Oberschulzulassungen nicht überschreiten. Und der Anteil der Arbeiter- und Bauernkinder sollte, wenn ich mich recht erinnere, etwa 60 % betragen. Dafür gab es kein Gesetz, lediglich verbindliche Direktiven für Lehrer und Schulleitung. Die Anträge der Eltern mussten zunächst dem „Pädagogischen Rat“ (Lehrerkollegium) vorgelegt werden. Wir Lehrer sondierten und prüften, welche Anträge der Kategorie „Arbeiterkind“ zugeordnet werden können. Dabei bemühten wir uns, wenn angebracht, beruflich bzw. sozial nicht eindeutig zu definierende Elternhäuser unter die Rubrik „Arbeiterfamilie“ einzuordnen.
In manchen Fällen wurden Zustimmungen der Schule von der „Abteilung Volksbildung beim Rat des Kreises“ (Schulamt) zurückgewiesen. Dann erinnere ich mich eines Falles, wo wir Lehrer an der Schule einen Schüler mit „bürgerlicher Herkunft“ auf Grund seines Leistungsdurchschnitts von 2,3 und nachlässiger Lernhaltung abgelehnt hatten, der dann aber, nachdem die gewichtigen Eltern vor dem Schulrat starken Protest eingelegt hatten, gegen unsere Entscheidung doch noch zur Oberschule zugelassen worden war.
In diesen ersten Jahren meiner Löfflerschulzeit hatten wir Jahr für Jahr die gleiche schwere Aufgabe, möglichst gerecht zu entscheiden, wer es verdiente, eine weiterführende Schule besuchen zu dürfen. Erst später, im Laufe der 60er Jahre wurde das verordnete Kriterium „Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder“ einem zweiten ähnlichen politischen Kriterium etwa gleichgestellt.
Parteilichkeit und Gesellschaftliche Arbeit
Die „Parteiliche Haltung“ und die „Gesellschaftliche Arbeit“ einer Schülerin oder eines Schülers sollten zunehmend als ebenso wichtige Kriterien für die charakterliche Beurteilung „herangezogen“ werden. Mit den Jahren wurde das Maß des „parteilichen“ Auftretens bzw. der „klassenbewussten“ Einstellung und der „gesellschaftlichen Arbeit“ an erste Stelle gesetzt.
„Parteiliches, klassenbewusstes Verhalten“ war abzulesen an erkennbaren politischen Überzeugungen und offenen politischen Bekenntnissen. Es war auch beweisbar durch Mitgliedschaft und „aktive“ Mitarbeit in einer politischen Organisation (Junge Pioniere/FDJ) und Teilnahme an der Jugendweihe. Gesellschaftliche Arbeit leistete ein/e Schüler/in zum Beispiel, wenn er/sie im Verband der Jungen Pioniere oder in der FDJ eine leitende Funktion ausübte und an Arbeitseinsätzen, Altstoffsammlungen, politischen Aktionen und schulischen Veranstaltungen aktiv mitwirkte.
Etwa mit Ende der 50er Jahre wurden wir Deutschlehrer angewiesen, den Aufbau und die Gestaltung eines Deutsch-Aufsatzes in den oberen Klassen so zu lehren und zu üben, dass der Schüler in seiner schriftlichen Darlegung oder bei Abschluss seiner Erörterung seine „parteiliche Meinung“ – in Beziehung zum Thema – schriftlich zum Ausdruck bringen sollte! Man erwartete damit keine ehrliche subjektive Wertung bzw. Meinungsäußerung, sondern meinte eine im Sinne der SED-Ideologie formulierte „parteiliche“ Stellungnahme. Das verführte den Schüler oft zu verkrampfter Heuchelei, weil er wusste, seine „Parteilichkeit“ könne ihm zu einer besseren Zensur verhelfen. Zum anderen vermochte der Lehrer auch, wenn er es für angebracht hielt, einen schwachen Aufsatz, der mit so einem „parteilichen“ Anhängsel endete, aufzuwerten.
Besonders im Fach Staatsbürgerkunde, aber auch in anderen ideologierelevanten Fächern achteten hospitierende Inspektoren oder Fachberater auf mündliche „parteiliche“ Aussagen der Schüler. An solchen „parteilichen“ und „klassenbewussten“ Stellungnahmen der Schüler wurde von versessenen Schulfunktionären oftmals die pädagogische Leistung des Fachlehrers gemessen! Wo sich Lehrer und Schüler gut kannten und verstanden, lernten Schüler mit der Zeit, wenn es darauf ankam, z. B. bei mündlichen Prüfungen, auf den Putz zu hauen und ihre Parteilichkeit vorzuspielen. Ich mochte solch ein Theater nicht.
Wenn man unter „gesellschaftlicher Arbeit“ gemeinnützigen Einsatz und engagiertes Mittun in der Gemeinschaft versteht oder eine positive soziale Einstellung, so wäre dagegen nichts einzuwenden.
Aber allein durch die penetrante Forderung, „gesellschaftliche Arbeit“ unter Beweis zu stellen, erstarrte der Gesichtspunkt Gemeinnutz zu einer formalen ideologischen Floskel. So suchte und sammelte der Lehrer in bestimmten Fällen alle möglichen „gesellschaftlichen Arbeiten“ eines Schülers zusammen, um dem geforderten Kriterium nachzukommen, vor allem aber, um dem Schüler auch unter diesem Gesichtspunkt möglichst Positives ins Zeugnis schreiben zu können.
Der eigentliche moralische Wert gemeinnützigen Verhaltens trat, weil mehr oder weniger erzwungen, in den Hintergrund und hatte im Rahmen der Erziehung einen geringeren Effekt.
So waren „parteiliches Verhalten“ nicht das Recht oder die Aufforderung zu freier subjektiver Meinungsäußerung und die geforderte „gesellschaftliche Arbeit“ nicht im eigentlichen Sinne nur gemeinnützige Tätigkeit, sondern beide Kriterien waren ausgeartet zu wirksamen Mitteln des Zwanges und zur Anpassung. Und wenn beispielsweise ein Mädchen oder ein Junge „nur ein bürgerliches Kind war“, dann sah es sich leicht verführt, sich durch berechnendes „parteiliches“ Auftreten, durch eine betuliche „gesellschaftliche Arbeit“ und durch vorgezeigte Aktivitäten als „Junger Pionier“ so verdient zu machen, dass es bei Schulabschluss eine gute Beurteilung bekam und vom erstrebten Besuch der weiterführenden Oberschule nicht ausgeschlossen wurde. – Der verlangte Beweis von Parteilichkeit verführte zur Heuchelei. Und Heuchelei war und blieb ein negatives Symptom der Schule in der DDR.
Für mich war es als Lehrer unter damaligen Bedingungen wie auch zu allen Zeiten stets die schwerste Aufgabe, eine ehrliche und gerechte, die geistige und psychische Entwicklung des Jugendlichen berücksichtigende Persönlichkeitsbeurteilung schriftlich zu formulieren
Die „Pionierarbeit“
Als ich 1950 in der Schule als Lehrer begann, war vorwiegend von antifaschistischer, demokratischer, humanistischer Erziehung die Rede, gemäß dem Gesetz zur Schulreform von 1946. Als Hauptpostulat galt noch „die Erziehung“ … der Kinder und Jugendlichen „zu selbständig denkenden, verantwortungsbewusst handelnden Menschen … “
Bereits 1952 folgten auf Wendungen wie „Erziehung zum Frieden“ oder „ … im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts“ weiterführend die geforderte „Liebe zur Arbeiterklasse“ und der Auftrag „zur sozialistischen Erziehung“; und wir Lehrer mussten nun schon – im Hinblick auf Künftiges – in Konferenzen die „kommunistische Erziehung“ nach sowjetischem Vorbild diskutieren und „lernen“.
Auf dem I. Pioniertreffen 1952 in Dresden, wo dem „Verband der Jungen Pioniere“ der Name „Ernst Thälmann“ verliehen wurde, ist das allgemeine Erziehungsziel so formuliert worden: „Erziehung der Kinder im Geiste des Friedens, der Völkerfreundschaft und des Sozialismus zu bewussten Staatsbürgern der DDR“.
Wer die Schule der DDR durchlaufen hat, wird sich erinnern an politische Programme und Parolen des Verbandes der „Jungen Pioniere“, an „Stufenprogramme“, an die „Gesetze der Jungen Pioniere“, an Blaues Halstuch, Pioniergruß und entsprechende Rituale beim Appell der „Pionierfreundschaft“ in der Schule.
Was ich sagen will: Wenn anfangs dieser Pionier-Verband als Kinderorganisation noch eine nebensächliche Rolle gespielt hatte, so wurde ihm ab 1952 von Seiten der Partei und der Schulbehörden ein ganz wichtiger Platz im Schulleben eingeräumt.
Schule – Elternhaus – Pionierorganisation, diese drei wurden jetzt in dieser Reihe als die wichtigsten Erziehungsträger genannt. Der Kinder- und Jugendverband der „Jungen Pioniere“, nun dem Elternhaus und der Schule als Erziehungsträger nahezu gleichgestellt, war somit erheblich aufgewertet worden, und er sollte künftighin maßgebend die staatsbürgerliche Erziehung der 6 – 14jährigen unterstützen.
In der Folge kamen hauptamtliche Pionierleiter an die Schulen. Lehrer wurden verpflichtet und mussten es als Teil ihrer beruflichen oder „gesellschaftlichen Arbeit“ betrachten, die „Pionierarbeit tatkräftig zu unterstützen“ … Es lief darauf hinaus, dass wir Klassenlehrer sogleich als „Gruppenpionierleiter“ die „Pioniergruppe“ der Klasse zu leiten hatten und regelmäßig „Gruppennachmittage“ organisieren und ausgestalten mussten. Oder wir Lehrer sollten Mütter oder Väter aus der Elternschaft als Gruppenpionierleiter gewinnen, was erfolglos blieb.
Die „Pionierarbeit an der Schule mit Leben erfüllen“ – das war von nun an eine vordringliche Arbeit der Lehrer. Wir wurden also eingespannt und sollten „freiwillig“ den Hauptteil der so genannten „Pionierarbeit“ leisten.
Der eingesetzte Pionierleiter an der Schule war verantwortlich, das Leitungsgremium der „Pionierfreundschaft“ (der ganzen Schule) sowie die Gruppenpionierleiter anzuleiten und die gesamte „Pionierarbeit“ an der Schule programmatisch zu steuern und zu kontrollieren. Er zählte mit zum „Pädagogischen Rat“, wie man die Lehrerkonferenz bald großsprecherisch nannte. So waren wir Lehrer auch dem Pionierleiter gegenüber verpflichtet oder mussten uns mit diesem arrangieren.

Aufmarsch am 1. Mai 1952 oder 1953 in Gotha.
Mehrmals hatten wir einen jungen Mann als hauptamtlichen Pionierleiter an der Schule, zeitweise auch ein junge Frau. Sie wechselten öfter. Meistens versuchte sich der Pionierleiter an die Lehrer anzupassen, war bestrebt, sich mit uns kollegial zu verständigen und uns für die kooperative Mitarbeit zu gewinnen. Ich erinnere mich an zwei dieser Pionierleiter, mit denen wir Lehrer/innen gut zurechtkamen, weil sie nicht wie sture Politfunktionäre auftraten, sondern bemüht waren, vernünftig und nutzbringend die Freizeitgestaltung der Kinder zu fördern und mit uns zusammenzuarbeiten. Eine bei uns eingesetzte Pionierleiterin war völlig unfähig und musste bald abgelöst werden. Einen Pionierleiter wurden wir los, nachdem er mit seiner Pionierkasse nicht korrekt umgegangen war. Von einer anderen strammen Pionierleiterin hielten wir uns möglichst fern, weil sie sich überzogen politisch und autoritär ins Zeug legte.