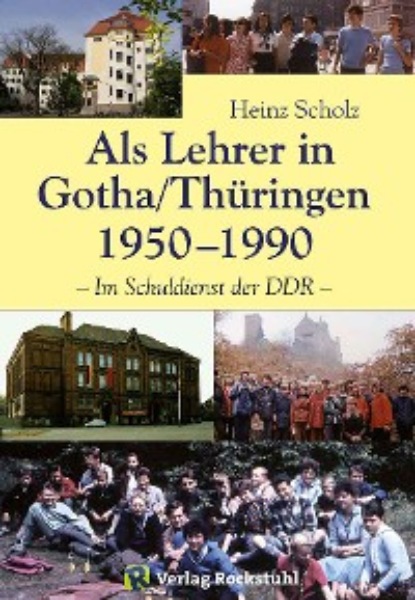- -
- 100%
- +
Laut Patenschaftsvertrag musste ein Vertreter der Betriebsleitung an wichtigen Lehrerkonferenzen (z. B. zu Beginn oder am Ende des Schuljahres) oder an Sitzungen des Elternbeirates teilnehmen. Meist diente diese Teilnahme dem Informationsaustausch. Manchmal wurde dabei eine aktuell notwendige Hilfeleistung besprochen. Auch Zusammenkünfte von Mitgliedern der SED-Partei-Gruppen von Patenbetrieb und Schule waren geplant, wurden aber nur selten verwirklicht …
Ohne jetzt näher darauf einzugehen, will ich nur kurz anmerken, dass diese Patenschaftsbeziehungen in den 60er Jahren weiter ausgebaut wurden, indem auch zwischen „Sozialistischen Arbeitsbrigaden“ aus dem Patenbetrieb und Schulklassen Patenschaftsbeziehungen aufgenommen werden mussten. Noch enger und wichtiger wurde die Zusammenarbeit Patenbetrieb – Schule, seitdem mit Einführung des Unterrichtsfaches „Unterricht in der sozialistischen Produktion“ ESP/UTP (1959) die Schüler im Betrieb praxisbezogen unterrichtetet wurden. Ich will an anderer Stelle darauf näher eingehen.
Lehrer – oder Staatsfunktionär und Propagandist?
Wie schon aus einigen meiner Ausführungen zu ersehen, sollten wir Lehrer, vor allem wir Genossen Lehrer, uns als Staatsfunktionäre verstehen. Gemäß dem „Klassenauftrag“ hätten wir im Unterricht wie im außerunterrichtlichen Bereich auf Kinder und Eltern ideologisch „aufklärend“ einzuwirken.
Das Verb „aufklären“ und der Begriff „Aufklärungseinsatz“ gehörten zur politischen Sprache der 50er Jahre. Es gab „Aufklärungslokale der Nationalen Front“, eingerichtet in irgend einem Parterre-Haus im Wohnbezirk, außen und innen mit Transparent und Plakaten gekennzeichnet. Man holte oder lud Leute herein, um sie „aufzuklären“ und sie „zu überzeugen“! Dort wie überall galt es, „klare Köpfe“ zu schaffen und das „bürgerliche Bewusstsein“ aus „den Köpfen zu treiben“.
In solchen Aufklärungs-Pamphleten oder Zeitungstexten war gewiss manche politische Einschätzung oder beschriebene Entwicklung halb wahr oder irgendwie nicht ganz falsch. Doch man bekam keine Chance, „Erklärtes“ öffentlich kritisch zu hinterfragen, ehrlich darüber zu diskutieren oder sich von absurden Behauptungen zu distanzieren. Man sollte einfach die penetrant aufgesagte „Wahrheit“ verstehen und als „gesetzmäßig“ und „wissenschaftlich“ belegt anerkennen. Diese „Aufklärung“ und „Überzeugungsarbeit“ war nichts anderes als purer Gesinnungszwang. Der „Bürger“ musste dem aufdringlichen propagandistischen Funktionärsredner gefügig zuhören, war dem politischen Gelärm des Rundfunks und den endlosen ZK-Berichten in den Zeitungen ausgesetzt, wurde zu befohlenen Demonstrationen und Versammlungen kommandiert und zu Resolutionsunterschriften und zu heuchlerischen Bekenntnissen genötigt. Das alles war so grell, so schreiend, so primitiv, dass es Augenblicke oder Tage gab, wo ich glaubte, es nicht mehr ertragen zu können.
Andererseits war ich zufrieden mit meiner Tätigkeit als Lehrer. Ich fühlte mich beruflich an richtiger Stelle, nahm meine Arbeit ernst, sah mich bestätigt durch Respekt und Sympathie bei Schülern und Eltern, fühlte mich auch wohl im Kollegium und unter gleich gesinnten Freunden und wollte – selbst wenn ich jetzt anstrengender und länger arbeiten musste als früher in meiner Mechanikerwerkstatt – wirklich gern Lehrer bleiben. Ich wollte auch bereitwillig beim Aufbau einer demokratischen sozialistischen Gesellschaft mitarbeiten und akzeptieren, dass selbstverständlich zur Sicherung von zivilem Recht, von staatlich-gesellschaftlicher Ordnung und sozialer Gerechtigkeit entsprechende Gesetze sowie notwendige ethische Normen gelten müssen. Doch die Willkür dieser absoluten politischen Diktatur, die die Gewaltanwendung gegen andersdenkende Menschen als gesetzmäßig und legitim erklärte und ungeschoren ausübte, schreckte mich zurück und ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Gerade ich als Genosse der SED, mittendrin im untersten Machtgetriebe, glaubte zu erkennen, dass dieser politische Gesinnungsterror nicht nur voreiligen Übergriffen kleiner Gernegroße entsprang. Hinter solchen Funktionären auf niederer und mittlerer Ebene stand befehlend und kalt fordernd die zentrale Macht Ulbrichts und seines Politbüros. Von oben herab, mit der Moskauer Machtzentrale im Rücken, hat man unbarmherzig die „sozialistische Revolution“ vorangetrieben – ohne Rücksicht auf das natürliche Freiheits- und Rechtsbedürfnis der Menschen.
Die nach dem Juniaufstand 1953 vorübergehend aufkommende Hoffnung auf zunehmende Liberalisierung mit mehr Achtung vor dem Menschen hielt sich unsicher für zwei drei Jahre. Innerhalb der Partei merkte ich bald, dass der von der SED-Führung ausgerufene „Neue Kurs“ lediglich zur augenblicklichen Beruhigung der aufgeregten Lage und zur strategischen Vorbereitung weiterer harter „revolutionärer“ Kampagnen dienen sollte.
… nach dem Westen abhauen?
Diese Frage stellten sich viele Menschen, die damals in der DDR, in den 50er Jahren, unter dem harten SED-Regime litten oder unzufrieden waren. Und man weiß heute, dass bis zum Mauerbau 1961 annähernd 3 Millionen Deutsche aus der Sowjetischen Besatzungszone bzw. DDR in den westlichen Teil Deutschlands übergewechselt waren. Manche waren geflohen, weil sie sich gefährdet fühlten oder wussten, andere sind weggegangen, weil sie für sich und die eigenen Kinder keine Perspektive sahen, viele sind einfach „abgehauen“, weil sie die Mangelwirtschaft satt hatten und sich „drüben“ ein besseres Leben in materiellem Wohlstand erhofften.
Jedes Jahr, am Ende der Sommerferien, wenn wir Lehrer uns zur Vorbereitungswoche auf das neue Schuljahr in der Schule versammelten, fragte man sich: Na, wer wird diesmal fehlen?
In der Zeit von 1953 bis 1956 waren es drei Kolleginnen, (Kolln. B., Kolln. K., Kolln. S.), die unsere Schule und die DDR verlassen hatten. Bis 1959 kamen noch zwei Kollegen dazu (Kolln. H. u. Koll. Sch.). Ähnliches spielte sich an anderen Schulen ab. – Problematisch war, dass der Stundenplan der Schule kurz vor Beginn des Schuljahres wieder umgebaut werden musste und für die weggegangenen Lehrer nicht gleich Ersatz geschaffen werden konnte. Manchmal musste noch in einer Lehrerkonferenz unter Anwesenheit eines Schulinspektors der jeweilige „Fall“ ausgewertet werden. Dabei wurde vom versammelten Kollegium erwartet oder gar verlangt, sich „geschlossen“ von dem zum Klassenfeind übergelaufenen „Verräter“ zu distanzieren. Durch diese Fluktuation bei uns in den Schulen wie auch in Industriebetrieben und medizinischen oder wissenschaftlichen Einrichtungen sind beste Fachkräfte verloren gegangen.
Natürlich habe ich mir – wie viele andere ebenso – die Frage gestellt: Solltest du auch nach drüben gehen? Meine Frau und ich, wir hatten darüber lange nachgedacht und uns im Jahre 1955 dazu entschlossen. Ich will erzählen, wie wir zu einer solchen Entscheidung gelangten und sie dann doch nicht umgesetzt haben:
Da muss ich wieder meinen Freund Eberhard von der Fachschule nennen. Er war, 1950 in Greiz als Lehrer eingesetzt, schon 1952 von da nach dem Westen gegangen und in Frankfurt/M wieder als Lehrer tätig geworden. Wir standen in Briefverbindung, und er redete mir zu, ihm ins Hessische zu folgen. Ins sozialdemokratische Hessen zu gehen, das gefiel mir schon. Doch ich, nicht so unabhängig wie er, zögerte, da mittlerweile familiär gebunden. Meine Frau und ich, wir hatten 1951 geheiratet, erwarteten 1954 unser erstes Kind. Im Oktober 1952 hatten wir zwar nach unentwegten Bemühungen eine Wohnung zugewiesen bekommen, doch eigentlich nur eine Behelfswohnung, als Untermieter bei drei alten Damen: zwei Zimmer, mit Küchen- und Badbenutzung, schlechtem Ofen und sehr kalt im Winter. Also kein trautes Heim, eher ein unbehagliches Provisorium! Auch in dieser Hinsicht hofften wir „drüben“ auf Besseres. Wir überlegten im Laufe eines Jahres, ob wir es wagen sollten. Ohne klare Aussichten blieb es doch ein Weg ins Ungewisse! Natürlich waren wir nach der Geburt unseres Sohnes im April 1954 wieder mehr auf unser hiesiges Familienleben konzentriert.
Schließlich erschien es mir günstig, erst einmal in den „Westen“ zu fahren, um mich dort umzusehen. Im Zuge des „Neuen Kurses von Partei und Regierung“ nach 1953 durften die Bürger der DDR in die Bundesrepublik reisen. Man bekam bei der Polizeidienststelle den Personalausweis gegen einen Reiseausweis umgetauscht. In den Sommerferien 1954 waren viele junge Leute unterwegs. Ich ließ mich mitziehen. Mit dem Fahrrad machte ich mich auf und radelte hinüber ins Hessische. Zur Erkundung sozusagen. Hinter der Grenze bei Herleshausen, bei einer Rast, schraubte ich meinen Dynamo auf und holte den darin versteckten 5-Mark-Schein heraus, den mir mein Onkel im Brief geschickt hatte. In einem Dorfgasthaus konnte ich für 3 Mark übernachten und am nächsten Tag weiterfahren. Es war eine interessante und abenteuerliche Fahrt. Am Rande einer Kleinstadt sah ich eine neu gebaute Schule. Es war ein modern anmutender Komplex mit Hauptgebäude, Nebenhaus und Turnhalle, die untereinander mit offenen überdachten oder festen Verbindungstrakts verbunden waren. Interessiert betrachtete ich mir diese für mich ungewohnte Anlage. Da kreuzte ein Hausmeister auf, mit dem ich ins Gespräch kam und der mir dann stolz seine neue Schule zeigte. Ich geriet ins Staunen. Ja, das war was ganz anderes als der schmutzigrote Kasernenbau meiner Löfflerschule mit den altersschwachen Schulbänken. In so einer Schule wie in dieser unterrichten können, das wäre was! – Über Laasphe, Siegen gelangte ich dann weiter fahrend in den Raum Gummersbach. Unterwegs, mich auf langer Strecke bergaufwärts quälend, hielt ein VW-Transporter an und lud mich ein, mein Fahrrad hinten rein zu legen und mitzufahren. So kam ich gut voran und traf am späten Nachmittag bei meinem Onkel in Marienheide ein.
Dort blieb ich vorerst, half ein bisschen beim Hausbau, sah mich um und gewann einen Einblick in die Verhältnisse. Mein Onkel, von Beruf Tischler, konnte sich als einfacher Arbeiter ein Haus bauen, weil er als vertriebener Schlesier durch „Lastenausgleich“ einen Bauzuschuss und günstigen Kredit erhalten hatte. Das fand ich schon bemerkenswert.
Aber ich wollte ja zu meinem Freund Eberhard ins Hessische. So stieg ich wieder aufs Rad und fuhr weiter nach Süden. Bei schönem Wetter zunächst in Richtung Koblenz, dann am herrlichen Rhein entlang, zur lockenden Loreley aufblickend, dahinter in den Taunus hinauf, wo ich nach anstrengender Fahrt bei meinem Freund eintraf.
„Komm rüber, ich helf’ dir! So wie ich dich kenne, wirst du das bei euch auf die Dauer nicht aushalten!“ So etwa seine Rede. Obwohl er zugestand, dass die Arbeit des Lehrers in der Großstadtschule auch kein Zuckerlecken sei, aber eben ohne politische Bevormundung, mit freier Lehre und offener Gesinnung einfach leichter. Die durch politischen Druck und Zwang erzeugte psychische Belastung fiele ganz weg. „Du brauchst Dich nur auf deinen Unterricht und auf eine vernünftige Lenkung der dir anvertrauten Kinder konzentrieren! Alles andere, das Politische, fällt hier weg!“ Ja, und das war schon das, was ich mir vorstellte.
Auf der Weiterfahrt machte ich noch Station in Hanau bei einem Schulfreund aus meinem schlesischen Heimatdorf. Auch Walter, der mich bereits in Gotha besucht hatte, riet mir zu. Er meinte auch, und das als Sozialdemokrat, ich sei dann im Hessischen besser aufgehoben als womöglich in Bayern …
Es war eine interessante, aufregende und auch anstrengende Reise. Und die Quintessenz: Ich war im Ganzen recht angetan vom „Westen“. Ich sah ihn nicht „golden“, aber im Vergleich zu uns als ein freies Land. Und darum ging es mir. Auch dass mir Freunde Orientierungshilfe angeboten hatten, sprach für das von uns erwogene Wagnis. Es gab zwar einen geringfügigen Schatten, der mich etwas nachdenklich stimmte: In einem Restaurant mit meinem Onkel zu Tisch, hatte ich zwangsläufig, da laut und bedeutend geredet wurde, ein Gespräch mit angehört: Vier vornehme Herren am Nachbartisch, zwischen 50 und 60, zwei von ihnen mit einem „Studentenschmiss“ im Gesicht, unterhielten und rühmten sich „guter alter Zeiten“. Dabei wetteiferten sie in Latein, gefielen sich in gehobener Sprache und Zitaten, demonstrierten hohe akademische Bildung und ihren über alle Zeiten unbeschädigten „hohen Stand“! – Konservativ … oder reaktionär? – wie man bei uns so was nannte? Jedenfalls verlor sich dieses Bild nicht, es blieb in mir haften.
Im Laufe des Schuljahres 1954/55 entschieden wir uns, meine Frau und ich, nach „drüben zu gehen“, und wir wollten vordem schon darauf hinarbeiten. Ich begann, Bücher, die mir wichtig waren, nach dem Westen zu schicken. Hauptsächlich nach Hanau an Walter. Meine Frau begann notwendige Wäsche oder uns wichtige Utensilien zum Wegschicken oder Mitnehmen auszuwählen. Das alles natürlich sehr geheim und unauffällig. Es war dann so gut wie ausgemacht: In den Osterferien 1955 fahre ich nach Frankfurt und Hanau, und meine Frau kommt dann mit unserem einjährigen Sohn im Sommer nach.
In der Schule plagte mich das schlechte Gewissen. Wenn ich so Tag für Tag vor meinen Schülern stand, mich ihnen wie immer zuwendete und mich für sie verantwortlich fühlte, da schien mir mein heimlicher Plan fast wie ein „Verrat“. Ist es richtig, wenn du sie im Stich lässt? Ich hörte nicht auf, mich das zu fragen.
Inzwischen hatte man mich zum stellvertretenden Schulleiter gemacht. Unser bisheriger Schulleiter, ein tüchtiger Mann, war schwer krank geworden: Lungentuberkulose. Er musste sofort auf unbestimmte Zeit in die TBC-Heilstätte. Nun wurde der bisherige Stellvertreter zum Leiter der Schule ernannt, und das Kollegium sollte dem Schulrat einen Stellvertreter vorschlagen. Ich weiß nicht mehr – wie oder wieso, man kam auf mich. Die Lehrerkonferenz schlug mich als stellvertretenden Schulleiter vor, und ich wurde vom Schulrat bestätigt. Nicht dass ich mich darüber gefreut hätte, nein, war ich doch nie auf Karriere aus und wollte wirklich nichts anderes sein als ein vollwertiger Lehrer. Doch ich hatte dann zugesagt unter der Bedingung, dass man mich sofort von dem Posten als Parteisekretär entbinde.
Nun kam das Frühjahr. Mit meinem primitiven Fotoapparat schlich ich eines Nachmittags in der Schule umher und machte noch einmal Aufnahmen von der Aula, von Klassenräumen und von unserem Schulgebäude – mit wehmütigem Gefühl. Dann, zu Beginn der Osterferien, kam der Abschied von meiner Frau und unserem Sohn. Das tat weh, obwohl wir uns unserer Vereinigung im Sommer „drüben“ sicher waren …
Bei meinem Freund in Frankfurt angekommen, begann ich sogleich alles in Angriff zu nehmen. Zuerst fuhr ich nach Wiesbaden ins Kultusministerium, legte meinen Antrag und meine vorbereiteten Unterlagen vor und bat darum, mich nach entsprechender Prüfung in den hessischen Schuldienst einzugliedern. Man besah sich die Schriftstücke und natürlich auch mich, teilte mir sogleich (wie erwartet) mit, dass ich zuerst ein Flüchtlingslager durchlaufen müsse und danach, wenn alles geprüft sei, ich noch ein Zusatzstudium von zwei Semestern an der Pädagogischen Hochschule in Weilburg absolvieren müsse, bevor ich als Lehrer eingesetzt werden könne. Man war freundlich und bestimmt.
Eberhard versprach mir als Hilfe, mich nach dem Lageraufenthalt – in der Warte- und Übergangszeit – in der Fabrik eines schlesischen Strumpffabrikanten aus Hirschberg unterzubringen. „Ich hab’ schon mit ihm geredet, er hilft gern einem Landsmann und stellt dich ein – irgendwo in der Verwaltung!“
Also jetzt ab nach Gießen, in das dortige Flüchtlingslager. Mit dem Koffer in der Hand setzte ich mich in Frankfurt in den Zug und fuhr nach Gießen. Dort auf dem Bahnhof sagte man mir: „Das ist nicht weit, wenn Sie den Güterbahnhof entlang gehen, treffen sie am Ende bald auf das Flüchtlingslager. Es ist nicht zu übersehen.“
Und ich sah es schon von weitem, ein schmutzig-grünes Barackenlager. Oh je, wieder so ein altes Arbeitsdienstlager aus der Nazizeit. Zaghaft und eigentlich schon widerwillig näherte ich mich dem Schlagbaum. Daneben ein Wachhäuschen und darin der Pförtner. Durch das offene Fenster sprach er mich an. Als Flüchtling wolle ich mich melden und fragen, wie hier so alles vonstatten ginge. – Meinen Personalausweis verlangte er zu sehen, dann wies er auf ein Büro hin, gleich in der ersten Baracke. Ich zögerte, wollte Genaueres wissen: Wie lange das alles dauere im Lager und wann ich wohl von hier wieder heraus käme. Er sagte – es klang ungehalten – ich müsse mit einem Aufenthalt von einem Vierteljahr rechnen … in etwa! Manchmal ginge es ja schneller, manchmal länger, je nach dem, ob alles glatt gehe oder ob sich Probleme ergäben. Günstig wäre, wenn man schon eine Wohnunterkunft nachweisen könne, vielleicht bei Verwandten. – Und wie man im Lager untergebracht würde? Nun ja, wenn Einzelperson, dann meistens zu etwa 4 Personen in einem Zimmer, ganze Familien allerdings hätten ihren eigenen Raum für sich. Selbstverständlich seien da auch ordentliche Waschräume vorhanden, auch für Verpflegung und Essen sei gesorgt. –
Ich muss eine ganze Weile verharrt haben, ohne was zu sagen, tat auch wohl so, als überlegte ich. Da traten noch andere Leute heran, und ich ging zur Seite, froh, Zeit zu gewinnen. Mit bangen Blicken starrte ich nun auf die vor mir liegende Barackenwelt, die sich in meinen Gedanken plötzlich bildhaft verwandelte: Das Bild meines Liegnitzer Arbeitsdienstlagers von 1942 stieg vor mir auf, schon gleich das vom Barackenlager auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf von 1943, und dann blieb ich haften an einem noch schlimmeren Bild: Da sah ich vor mir die schrecklichen Läusebaracken unseres Gefangenenlagers von Stalingrad 1944/45. Es war wie ein Trauma, was mich überfiel, und ich schien wie gelähmt. – Aber das ist doch was anderes hier! – Ja, schon, aber ich kam nicht weg von diesen Bildern. Indem ich sie verdrängen wollte, kam mir Gotha in den Sinn: Ilse mit unserem einjährigen Eckehard zu Hause. Wie soll das alles werden, ich hier in diesem Lager „gefangen“ und allein, sie mit dem Kleinen dort? Das alles und mehr ist mir durch den Kopf gegangen damals, und ich war unfähig, mich zu entschließen und den Schritt zu wagen – hinein ins Lager. – Ich weiß, ich kam mir miserabel vor, als ich unverrichteter Dinge vor dem Schlagbaum umkehrte und mit dem nächsten Zug zurückfuhr zu meinem Freund nach Frankfurt. Der war ärgerlich, konnte mich nicht verstehen. „Da musst du einfach durch, wie viele andere auch!“ und lauter solche Reden. „Überleg’ dir das noch mal gründlich!“ und so fort …
Am nächsten Tag bin ich heimgefahren nach Gotha – mit dem Zug. Schnell, möglichst schnell sollte das gehen. Deshalb hatte ich diesmal mein Fahrrad im Packwagen aufgegeben.
Mein Frau war – über alle beschlossene Pläne hinweg – froh, mich wiederzuhaben. Und ich hielt ziemlich glücklich wieder meinen kleinen Sohn im Arm. Später ist mir bewusst geworden, dass neben meinem Baracken-Trauma und der familiären Ungewissheit mich unbewusst noch ein anderes Bild verunsichert hatte: Die schon erwähnte lateinisierende Akademikerrunde am Nebentisch in jenem rheinischen Restaurant ist mir noch oft in den Sinn gekommen. Dieses Bild ließ mich daran erinnern oder mich in meinem damaligen Zustand glauben machen, dass meine niedere Bildung und Ausbildung für den Westen womöglich nicht ausreichte, dass ich unterliegen könnte drüben: als „Neulehrer“ vor jenen unbehelligten Studienräten nach altem Schrot und Korn.
Es war das erste Mal, dass ich zu mir sagte: Ob du es wahrhaben willst oder nicht, du bist ein Kind dieser DDR. Auch wenn es nicht so recht „deine“ DDR ist! – So ließ ich meinen Plan „abzuhauen“ erst mal fallen. – Jahre später, in schwierigen Situationen oder zugespitzten Fällen, habe ich deswegen mit mir gehadert.
Wieder in Gotha – in der Löfflerschule wie bisher
Die tägliche Arbeit in der Schule, die Familie und natürlich die Partei mit samt dem politischen Getriebe nahmen mich wieder fest in die Zügel. Vor allem mein Fernstudium zwang mich an Schreibtisch und in Bibliotheken. An einem bestimmten Tag in der Woche war ich ausgeplant in der Schule. Meine 26 Unterrichtsstunden waren auf die übrigen fünf Wochentage gelegt, so dass ich den „Studientag“ frei behielt für das individuelle Studium bzw. für die Konsultationen mit unserer Mentorin. In den Sommerferien musste ich an einem dreiwöchigen Seminarkurs in Weimar teilnehmen – mit Vorlesungen, Klausuren, Zwischenprüfungen und 1957 abschließend mit Diplomarbeit und Staatsexamen.
Zu all dem nahmen mich natürlich meine Aufgaben als Klassenlehrer und als stellvertretender Schulleiter voll in Anspruch. Ich kam kaum zur Besinnung, wohl an die 12 – 14 Stunden täglich hatte ich zu arbeiten. Manchmal noch mehr. Für Korrekturen der Schülerarbeiten musste ich meist des Sonntags Zeit finden. Auch die Ferientage zu anderen Jahreszeiten blieben größtenteils aufgespart, um notwendige Studien nachzuholen und um für Schule und Unterricht nach- oder vorzuarbeiten. Es war eine harte Zeit, und unser familiäres Vorhaben, „in den Westen zu gehen“, trat ganz in den Hintergrund.
Zudem richteten die geforderten Studien mein Interesse auch auf literarische Themen und Werke, die mir besonders zusagten und denen ich auch gern tiefer nachgehen wollte. So wurde beispielsweise meine Begegnung mit Werk und Person von Bertolt Brecht für mich ein echtes Bildungserlebnis. Es kam wie eine Offenbarung über mich, weil ich vorher – völlig ohne Kenntnisse – mit Brecht nicht viel anzufangen wusste. – Das erste Mal war ich auf ihn gestoßen, als ich 1951 im Theater in Gotha das Brecht-Stück „Die Mutter“ zu sehen bekam. In der Pause bin ich rausgegangen! Was da stattfand auf der Bühne mit roten Fahnen und Sprechchören, das empfand ich als pure politische Agitation, so wie man sie derzeit auf unseren Straßen und Plätzen bei Aufmärschen und Demonstrationen erlebte. Das war doch kein Theater, wie ich es bislang verstand! 1955, während meines Fernstudiums, als wir nur oberflächlich die deutsche Literatur der zwanziger Jahre behandelten, hatte einer nach Brecht gefragt. Warum dieser so quasi übergangen würde, er wäre doch wichtig? Unsere Mentorin wich aus: Nun ja, der mache zwar sein Theater am Berliner Schiffbauerdamm, aber er sei ein eigenwilliger Mann, und sein „Episches Theater“ habe mit dem modernen „sozialistischen Realismus“ wenig zu tun. Sie messe ihm keine herausragende Bedeutung bei.
Solch einer Wertung misstraute ich. Wenig später, nachdem Brecht 1956 gestorben war und man ihn plötzlich im Übermaß öffentlich zu loben begann, reiste auf einmal, der neuen Linie angepasst, unsere Mentorin Frau Dr. W. als Referentin der „Nationalen Front des demokratischen Deutschland“ in Städten unseres Kreises umher – mit einem Vortrag über den bedeutenden deutschen Dichter Bertolt Brecht! Dieser plötzliche Wandel in der öffentlichen Bewertung Brechts gab mir erneut zu denken und machte mich erst recht neugierig. Dann hörte ich sagen: „Da nun tot, kann er sich nicht mehr wehren!“
Zu dieser Zeit kam mir mehr per Zufall ein Propagandaheftchen vom „Deutschen Friedensrat – Berlin“ (Ag 201/56 DDR – 125) unter die Hände. Und ich muss unbedingt zitieren, was darin Karl Kleinschmidt; Dompfarrer von Schwerin, in einem Nachwort über seinen Freund Bertolt Brecht gesagt hat:
„Bert Brecht war nicht nur seinen politischen Gegnern, er war auch uns, seinen politischen Freunden, unbequem, auf eine andere, viel tiefere Weise als seinen Feinden. Er war uns unbequem auf eine besonders abgefeimte Weise, uns immer wieder nicht nur auf einzelne Mängel, sondern auf den Grundfehler unserer Überzeugungsarbeit hinzuweisen, ….auf den Grundfehler, dass sie Überredungs- und keine Überzeugungsarbeit ist. Das Unbequemste daran ist, dass es sich nicht nur um eine andere Taktik oder Technik handelt, sondern um eine höhere Stufe der Menschlichkeit, um einen Respekt vor dem Andersdenkenden, der es ihm verbot, ihn zu überreden, wenn er ihn nicht zu überzeugen vermochte.“ (6)
Diese in der Öffentlichkeit kaum bemerkte, von mir entdeckte Würdigung Brechts war für mich eine ungeheuer interessante Erklärung, deren Wahrheit ich nun sofort zu prüfen gedachte. Mein Entschluss stand fest: Du musst jetzt Brecht lesen und sein Theater genauer kennen lernen. So besorgte ich mir die „Stücke“, deren ich habhaft werden konnte, und begann – trotz Zeitnot – zu lesen und merkte bald, dass ich mich zugleich mit seiner Theorie vom „Epischen Theater“ beschäftigen müsse. Natürlich wollte ich jetzt unbedingt Brecht-Inszenierungen auf dem Theater sehen. Abgesehen vom Theater Meinigen, wo Fritz Bennewitz (an einem abgeschiedenen Rand der DDR-Kulturszene) schon in den 50er Jahren hatte ungeschoren Brecht-Stücke inszenieren können, gab es erst mit Beginn der 60er Jahre rundum mehr Brecht-Aufführungen. (Ich erinnere mich an die „Dreigroschenoper“ in Weimar, an die „Mutter Courage“ in Erfurt, an den „Kaukasischen Kreidekreis“ …, an „ … Arturo Uri“, an „Das Leben des Galilei“ und an weitere Brecht-Erlebnisse in Weimar, Erfurt und Eisenach und später auch in Berlin am „B.E.“)