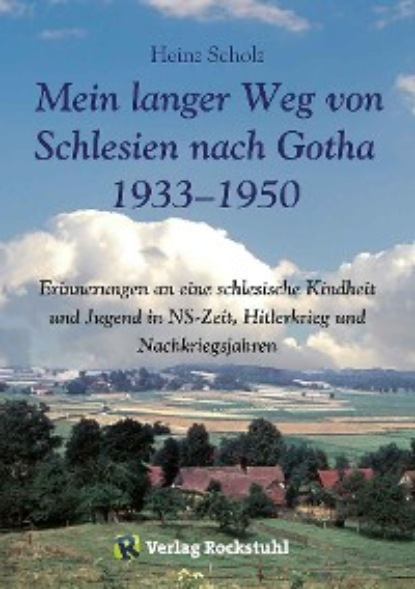- -
- 100%
- +
Käthe war als Mädchen für uns zwei Jungen, da wir keine Schwester hatten, wie eine ältere schwesterliche Freundin. Wir mochten sie, weil sie freundlich zu uns war, sich natürlich gab und sich gelegentlich um uns kümmerte.
So als unbedarfter Heranwachsender redet man ja manchmal von den „blöden Weibern“, regt sich auf über deren „Schöngetue“. Bei Käthe wären wir nie in derartige Reden verfallen. Später hat uns natürlich interessiert, mit „wem sie geht“. „Käthe ist wie ihre Mutter“, das hörte man sagen. Und es stimmt genau. So überaus gütig, so herzensgut, so voller stiller Nachsicht und natürlicher Freundlichkeit – so habe ich unsere liebe Nachbarin, Frau Schulz, in Erinnerung. Gegen uns Jungen fiel nie ein böses Wort oder eine schroffe Zurechtweisung. Manchmal steckte sie uns was zu. Ein andermal lud sie uns ein, von ihren so wohlschmeckenden Bratkartoffeln zu essen, was wir gern, aber nur zögerlich annahmen, weil bei unseren Eltern galt: Nicht betteln – zu Hause wird gegessen!
Der Vater von Hans und Käthe war uns Jungen auch gut gesonnen, aber von ihm kriegten wir manchmal schon was ab. Eine tadelnde Bemerkung, wenn wir uns ungeschickt verhielten, oder auch eine ironische, wenn ich im unpassendsten Augenblick in Jungvolkuniform daher kam, aber eben auch eine lobende, wenn man deutlich etwas „Vernünftiges“ vorweisen konnte. „Bäcker Gerhard“ war ein kritischer Mensch, selbst am Ende der Dreißiger Jahre noch stand er ziemlich „links“, während mein Vater seine alte sozialdemokratische Haltung schon fast verdrängt hatte. Über diesen Unterschied hinweg verstanden sich die beiden Männer recht gut. Beide tranken gern „an gutten Kurn“, waren sehr gesellig und spielten zur Kirmes oder zum Maskenball bei „Hiebnern“ gemeinsam so manchen Possen. Und nachbarschaftlich half man sich mit aller Selbstverständlichkeit.
Während des Krieges spürte man an seinen vorsichtig skeptischen Anmerkungen, dass bei ihm keine Siegeszuversicht aufkam. Er war auch kein militärischer Typ, der sich wie andere beim „Schissen“(Schützenfest) des „Reichkriegerbundes“ groß ins Zeug gelegt hätte. Nein, man konnte als Junge sich schon vorstellen: Der ist gegen den Krieg. Jahre später, nach 1945 haben wir darüber offen gesprochen.
Überhaupt unterschied er sich grundsätzlich vom Hilger Bruno, unserem anderen Nachbarn zur Linken. Der wohnte also in der Nr. 82 mit seiner Frau Berta. Beide waren „Hofearbeiter“, sie beim „Dunkel-Pauer“, er als Vorarbeiter beim Großbauern Heinrich im Nachbardorf. Hilger Bruno war ein renommierter Teilnehmer des Ersten Weltkrieges. In der Wohnstube hing groß und breit sein Porträt als stolzer Unteroffizier, ehrenbekränzt und mit dem Eisernen Kreuz geschmückt. Wenn die Männer in der Runde vom Krieg erzählten und wir Jungen ganz Ohr waren, dann waren die Kampfberichte von Hilger Bruno am spannendsten. Auch beim „Schissen“ trat er, militärisch ausstaffiert, mit stolzer Brust in Erscheinung. Es war für ihn selbstverständlich, dass seine Söhne nach einer Lehre beim Schmied sich freiwillig zu den Soldaten meldeten. Artur wurde Flieger und der zwei Jahre jüngere Kurt Matrose auf einem U-Boot. Sie avancierten beide und kamen zu Beginn des Krieges in schmucken Uniformen auf Urlaub. Bis dann Anfang 1941 die beiden Alten das Schlimmste traf: Zuerst erhielten sie die Nachricht, dass Artur im Luftkampf abgeschossen worden war, und vier Wochen später, dass Kurt in seinem U-Boot von einem Feindeinsatz nicht zurückgekehrt sei. Beide Söhne tot – innerhalb eines Monats! Das warf die Eltern völlig nieder, und für Bruno brach eine ganze Welt zusammen. Er war von nun an wie verwandelt, kritisierte Hitlers Kriegsführung und prophezeite, als im Sommer der Angriff auf Russland erfolgte, nun sei der Krieg nie mehr zu gewinnen. – Wie sehr doch persönliches Getroffensein, unwiederbringlicher Verlust und tiefstes persönliches Leid, die Blickrichtung ändern kann! So lange es immer nur die Anderen trifft, bleibt man in der eingefahrenen Spur.
Über unsere unmittelbaren Nachbarn hinaus hatten wir auch gute Verhältnisse zu anderen Bewohnern des Hinterdorfes. Walters Jungen, Kurt und Georg, waren mit uns gleichaltrig, also nahe Spielgefährten, selbst wenn sie als Bauernjungen viel mehr als wir in die häusliche Wirtschaft eingebunden waren und weniger Freizeit hatten als wir. Auf Walters Kellerberg sind wir Schlitten gefahren und bei Walters trafen wir uns auch manchmal abends, wenn die Eltern alle im Kretscham bei „Hiebnern“ zum Tanz waren. Und Schellenbergs Jungen, obwohl älter, so waren wir ihnen aus unterschiedlichen Gründen auch nahe. Oskar war im Dorf der Hitlerjugendführer; Richard, dem Ältesten, musste ich eine Zeit lang zur Reinholds Elli in Neuland als „Liebesbote“ dienen, und Hans, der Jüngste, mit mir gleichaltrig, konnte in der Schule etwas besser rechnen als ich.
Natürlich kannten wir gut die Bäckerfamilie, wo wir Brot holten. Und der Bäcker Kurt, ein Onkel von Käthe, war für uns Jungen irgendwie eine markante Person. Er ließ uns auch mal in die Backstube, und ich fand es interessant, wie er mit jungen weiblichen Kundinnen turtelte.
Und „die Rungen“, die war für uns insofern interessant, weil wir bei ihr neben Lebensmitteln Schokoladentafeln im Regal liegen sahen, aber höchstens für einen Pfennig ein dickes Sahnebonbon kaufen konnten. Und der Sohn, „Runge Briedl“, ein Jahr älter als ich, der hat mich auch mal heimlich mit in den Kramladen seiner Mutter hineingenommen. Aber er war vorsichtig, wir begnügten uns jeder mit einem Brathering aus der großen Blechdose.
Im Vorderdorf war ich gern bei Tüllners. Sie waren zugezogen und hatten Anfang der dreißiger Jahre einen Bauernhof übernommen, und der Sohn Lothar wurde mein bester Freund. Es war für mich eine schöne Jungenfreundschaft. Er war ruhiger als ich, aber mir sehr zugetan. Auch seine Mutter war mir auffallend freundlich gesinnt und legte Wert auf unsere Freundschaft. Ich fühlte mich wohl bei Tüllners. Der verhältnismäßig große vierflüglige Bauernhof war für mich eine andere Welt. Mit Lothar stöberte ich überall herum, von den Kellern bis hinauf in die Körnerkammern gab es allerhand zu entdecken, und er als Jüngster neben zwei älteren Schwestern brauchte nicht ernsthaft in der Wirtschaft zu helfen. Wenn wir mal Schweinskartoffeln mit dem großen „Dämpfer“ auf dem Hof vorbereiten sollten, war das eher wie eine Freizeitbeschäftigung mit einer leicht zu bedienenden Maschine. Ein ziemlich großer Hühnerhof nach dem Garten zu war oft im Gespräch. Ein Fuchs aus dem nahen Wald ging seiner Raubgier nach. Wir spürten ihn auf und machten uns dran, den Fuchsbau auszugraben, kamen wohl aber zu spät. Gänge und Nest waren leer, wahrscheinlich hatte er sich anderswo einen sicheren Bau eingerichtet. Als Lothar ernsthaft an Diphtherie erkrankt war und in Löwenberg im Quarantänehaus lag, habe ich gebangt und gelitten. Wir hatten später, auch im Krieg, während er an der West- und ich an der Ostfront war, noch brieflichen Kontakt miteinander, und sogar nach dem Krieg hatten wir uns wieder ausfindig gemacht, er in Sachsen und ich in Thüringen. Aber Lothar hat dann die Freundschaft abgebrochen, und ich glaube, ich bin schuld daran. Noch heute leide ich darunter.
Vom Dunkel-Bauer, vom einzigen Gutsbesitzer in unserem Dorf, war bereits die Rede. Er war schon ein alter Mann; der kränklich aussehende Sohn leitete die Gutswirtschaft, und mit zur Familie gehörte die verwitwete Tochter mit ihren drei Kindern Ingrid, Manfred und Reinhard. Die drei gingen nach dem 4. Schuljahr auf das Gymnasium in Löwenberg. Nur mit Manfred, so alt wie ich, blieb ich weiter in Verbindung, und zwar im Jungvolk. – Unweit von Dunkels Hof befindet sich heute noch die Ruine einer alten Wasserburg, umgeben von einer verfallenen Wallanlage mit ehemals breiten Wassergräben. Als Jungen haben wir die Ruinenmauern erstiegen und im Winter auf den zugefrorenen „Burgteichen“ „geschindert“, was heißt, dass wir mit Holzpantoffeln, auf deren Sohlen wir je zwei Kupferdrähte als Gleitschienen befestigt hatten, auf dem Eis geschlittert sind.
Diese Ringwallanlage oder Sumpfburg soll ehemals den slawischen Bewohnern der Bober-Aue als Fliehburg gedient haben. Sie könnte also 800 bis 1000 Jahre alt sein.
Die Tüllners wie auch die anderen Bauern des Dorfes waren nicht ausgesprochen reiche Bauern. Die Weltwirtschaftskrise 1929 – 32 und mit ihr die erlahmende Kaufkraft hatte die Preise ihrer Produkte sinken lassen. Mit der nazistischen Ausrichtung der Wirtschaft auf Rüstung und Kriegsvorbereitung ging es Mitte der dreißiger Jahre auch den Bauern wieder besser. Vor allem die Wehrmacht, der „Arbeitsdienst“ und die Füllung der Staatsreserven verlangten nach mehr Lebensmitteln. Wir Arbeiterjungen im Dorf waren bei den Bauern auch gefragte Arbeitskräfte, besonders in den „Kartoffelferien“. Doch wir zogen vor, uns bei den Gutsbesitzern im benachbarten Rackwitz zu verdingen. Dort bekamen wir 1,20 Mark pro Tag einschließlich Frühstück, Mittagessen und Vesper. Am liebsten arbeiteten Helmut und ich beim Sauer-Pauer. Dort konnten wir auch in der Knechtstube übernachten, bekamen zuzüglich noch das Abendbrot und gewannen nach Feierabend interessante Einblicke in das Hof- und Gesindeleben! Und die Bauersfrau nahm sich unser an, kam abends zu uns an den Tisch, drängte uns zu ordentlichem Waschen und schmierte uns die vom Kartoffellesen rauhen, aufgesprungenen Hände mit Schweineschmalz ein. Es war für uns 12- und 13-Jährige eine harte und auch qualvolle Arbeit. Von 7 Uhr an bis 18 Uhr, abzüglich der Pausen, waren wir auf den Beinen. Das heißt, meist in gebückter Haltung oder auf den Knien rutschend hatten wir hinter der Schleuder auf einem abgemessenen Streifen die Kartoffeln in Körbe zu lesen und diese in den bereitstehenden Kastenwagen zu entleeren. Der Rücken, der Rücken … ich spüre ihn heut noch, wenn ich daran denke. Und wenn wir erlahmten, wurden wir unerbittlich angetrieben! Eine Woche, höchstens 10 Tage, das konnte man gerade noch durchhalten. Aber es hat uns niemand zu solch einem Einsatz gezwungen! Weder die Eltern noch die Schule. Wir wollten das, denn es war für uns Jungen eine Möglichkeit, durch selbst verdientes Geld sich einen Sonderwunsch zu erfüllen. „Wenn du eine Fahrradbeleuchtung brauchst, dann musst du sie dir verdienen. Wir können sie nicht kaufen!“ Was will man da machen? Das gebrauchte Fahrrad für mich hatte Vater mit 18 Mark bezahlt. Also wenn ich nun in der Dunkelheit nicht mit Karbidlampe fahren wollte, musste ich eine Woche lang hart arbeiten. Dynamo und Lampe mit Kabel kosteten 7,50 Mark bei unserem Hoffmann Fritz.
An dieser Stelle muss ich endlich erklären, dass es bei uns in der schlesischen Umgangssprache üblich war, den Nachnamen vor den Vornamen zu stellen. Ich war also für die anderen, wenn sie von mir redeten, der Scholz Heinz oder der Bahner-Scholz-Heinz, und Hoffmann Fritz, das war unser Fahrradmechaniker Fritz Hoffmann, der im Hinterdorf nicht weit von uns eine Werkstatt und einen Verkaufsladen eingerichtet hatte. Eigentlich war er ein Universalmechaniker. Er reparierte und verkaufte nicht nur Fahrräder, auch Grammophone und zunehmend Radios und dann noch Nähmaschinen. Natürlich lötete er auch Töpfe, legte eine „elektrische Leitung“ oder reparierte irgend einen anderen defekten Mechanismus. Und – er hatte eine hübsche, blondzöpfige Tochter! Aber darauf komme ich noch zurück.
So als Dreizehnjähriger kannte ich so gut wie alle Leute im Dorf. Ich nahm fast jeden zur Kenntnis, wollte auch wissen, wer ist wer. Und bei 480 Einwohnern ist das kein großes Problem, wenn man im Dorf unterwegs ist, sich für andere Leute interessiert und auch hinhört, was da oder dort über diesen oder jenen erzählt wird. Manchmal erfuhr man auch durch direkte Begegnungen, durch bekannt gewordene auffällige Verhaltensweisen oder Leistungen Näheres über eine bestimmte Person, so dass man sich dann aus seiner kindlich jungenhaften Perspektive ein eigenes Bild machte. So lernten wir auch unter den verheirateten Männern einige als „Schürzenjäger“ einzuschätzen, oder wir hörten von Frauen, die es „sehr schwer hätten“ und natürlich auch von schlimmen Krankheiten, die verhältnismäßig junge Frauen oder Männer nach „schwerem Siechtum hinwegrafften“. – Einmal im Sommer hatte mich Vater in ein Haus im Vorderdorf geschickt, um dem darin wohnenden dorfbekannten Manne eine bestimmte Nachricht auszurichten. Da ich barfuß und ungehört durch offene Türen Hausflur und Wohnung erreichte, stand ich ganz plötzlich in der Wohnküche, zuckte aber ganz schnell zurück, dieweil der Hausherr eben in diesem Augenblicke am Sofa auf für mich eigenartige Weise mit seiner Frau hantierte und umging. „Das hätte ich von dem nicht gedacht!“ So meine gedankliche Reaktion aus der Sicht eines unwissenden, unaufgeklärten Jungen. Da geschah auch manches im Dorf oder in Familien, das uns, wenn wir zusammenhanglos davon erfuhren, zu einer recht bedenklichen oder zweifelhaften moralischen Wertung verleitete.
Ich denke hier an die spektakuläre Geschichte mit der Opitz Marie, aus der Erwachsenensicht: ein klassischer Fall von Kindestötung. Nun, diese Marie, eine sitzengebliebene alte Jungfer zwischen 35 und 40, hatte ihr heimlich zur Welt gebrachtes Kind im sumpfigen „Errlicht“ verscharrt. Das wurde nun auf dem Schulweg mit sensationellen Enthüllungen weitergesagt und phantasievoll bis ins Kleinste durchgesprochen. Ein richtiges Kriminalstück, an dessen Erklärung wir spekulativ mitarbeiteten. In der Scheune habe sie am Vortage noch mit Flegeln das Korn mitgedroschen! Keiner habe etwas gemerkt, keiner hat den dicken Bauch gesehen! Wie das? Darüber mussten wir nachdenken! Und wer hat sie geschwängert? Das war ja die wichtigste Frage! Und warum hat sie alles „mitgemacht“? Dass sie das Kind aus Scham verschwiegen hatte – das glaubten wir zu verstehen, denn die ganze Sache war ja wirklich „schämenswert“! – Bald wurde auch unter vorgehaltener Hand der „Schürzenjäger“ benannt. Und die Marie, sie war längst „abgeholt“ worden, aber von dem Gerichtsprozeß war nichts Genaues zu erfahren. Nur dass sie dann nach Plagwitz in die „Verrücktenanstalt“ eingewiesen worden sei, das fanden wir so ungefähr in Ordnung. „Das arme Luder“, so meine Mutter, die viel besser als wir Jungen einzuschätzen verstand, was da vorgefallen war.
Bald wurden wir wieder abgelenkt durch andere Vorkommnisse. Da waren doch noch einmal die Zigeuner ins Dorf gekommen und hatten auch am Errlicht mit ihrem Planwagen ihr Lager aufgeschlagen, und deren Frauen zogen bettelnd von Haus zu Haus. Oder das Manöver hatte wieder mal unser Dorf berührt, was uns sofort in Bewegung setzte, Kontakte zu den Soldaten zu knüpfen und Neues über Waffentechnik und Kampftaktik zu erkunden. Vielleicht war auch das „Lautsprecherauto“ von der Puddingfirma „Dr. Oetker“ mit lauter Musik durchs Dorf gefahren, um uns alle einzuladen zu einer Pudding-Filmvorführung im Saal von Hübners Gasthaus. Oder der Theaterwagen einer Puppenbühne war eingetroffen und kündigte lautstark die Aufführung eines Märchens am folgenden Tag an. Auch das „Kornfrank-Auto“ brachte Abwechslung; in einer Werbeveranstaltung verteilten die Reklameleute an uns Jungen leicht auffaltbare Pappflieger, die wir mit einem Spanngummi zum Gleitflug in die Luft schießen konnten. Alles dafür, dass unsere Mutter künftig nur noch von „Kathreiner“ und „Kornfrank“ Malzkaffe kaufen sollte, denn die Zeit, wo man die Körner selbst in einer drehbaren Trommel über einem Feuer zu Malzkaffee röstete, war mittlerweile auch im Dorf zu Ende gegangen. Nun kamen solche Spektakel nicht zuhauf über uns. Umso mehr zogen sie uns an als willkommene Abwechslungen … .
Darüber hinaus ergaben sich für uns Kinder auch besondere Höhepunkte durch Feste oder Veranstaltungen, die dem jahreszeitlichen oder dörflichen Brauchtum entsprachen, immer mehr jedoch von der „neuen Zeit“, von der „NS-Bewegung“, vereinnahmt wurden. Nur die Kirmes in der ersten Novemberwoche blieb immer noch das, was sie gewesen war, mehrtägig und mit großem Tanzfest für die Erwachsenen, wo wir höchstens mal durch die erleuchteten großen Saalfenster hineinschauen durften. Für uns war „der Bernern ihr Paschtisch“ das Wichtigste. An ihrem Verkaufsstand wurde gewürfelt, mit einem Einsatz von 5 oder 10 Pfennigen, um eine Tüte „Mehlweisen“ oder um eine Schokolade oder ähnliche begehrenswerte Süßigkeiten. Wer sicher gehen wollte oder höchstens 30 Pfennige von zu Hause mitbekam, musste genau überlegen, wie er seine Groschen anlegte. Wenn unsere Onkels oder Tanten aus Neuland zu unserer „Langvurbcher Kirms“ kamen, dann konnten wir mit deren Beigabe auf ein Kirmesgeld von 50 Pfennig kommen. Am spendabelsten war unser Großvater Albert Liebig. Zum „Blücherfest“ schenkte er jedem von uns, meinem Bruder und mir, sogar einen Fünfziger.
Interessanter für mich war das „Schissen“ im Frühsommer, das jährliche Schützenfest, das von Jahr zu Jahr militärischer und eben auch schon hakenkreuzgeschmückt vonstatten ging. Auf dem Schießplatz das große Festzelt interessierte uns weniger. Da saßen die biertrinkenden Erwachsenen, vor allem die uniformierten Schützen, die sich über ihre guten Treffer freuten oder ihren Ärger wegen schlechter Ergebnisse mit einem deftigen Korn hinunterspülten. Vor dem langen Hohlweg zum Wald hin, war der Schießstand aufgebaut. Da standen wir, wenn Vater dran war oder der Hilger Bruno. Und weit hinten, aus dem Unterstand vor den Schießscheiben, reichte man nach jedem Schuss eine gut sichtbare Tafel hoch hinaus, die über die Entfernung (von vielleicht 80 m) die Zahl des getroffenen Ringes bekannt gab. Vater meinte ja auch, es sei gar nicht so verwunderlich, dass die wohlhabenden Bauern bzw. die spendabelsten Vereinsmitglieder stets besser schossen als die armen Luder im Dorf. Die „besten Schützen“ wurden zum Schützenkönig und zum Marschall ausgerufen, entsprechend feuchtfröhlich gefeiert und mit je einer großartig bemalten Scheibe geehrt, die Tage danach sichtbar für jedermann an einer Außenwand des „königlichen“ Wohngebäudes aufgehängt wurde.
Und wir „jungen Schützen“ kamen auch auf unsere Kosten. Seitwärts und durch Absperrseile gesichert, war ein kleiner Schießstand mit Scheibe an einer 12 m entfernten Eiche eingerichtet. Hier wurde nur mit Bolzen geschossen. Man konnte das Luftgewehr auflegen beim Schießen. Das fand ich gut, denn so brachte ich es auf der 12-er-Scheibe mit 3 Schuss auf passable 30 Ringe. Irgendwann hatte ich auch einen der auf einem Tisch ausgestellten Preise zweiter Garnitur gewonnen. Neben der Schießscheibe, hinter einer hölzernen Schutzwand, verbarg sich der „Bolzenzieher“, wenn geschossen wurde. Diese Aufgabe übernahm ich gern. Ich musste nach dem Schuss den Bolzen mit einer Bolzenzange herausziehen und die Zahl des angeschossenen Ringes nach vorn laut und deutlich durchrufen. Mir war natürlich bewusst, dass nicht jeder, der wollte, als Bolzenzieher „genommen“ wurde! – Unter den Verkaufsbuden reizte mich die vom „Wehner-Flescher“ aus Kunzendorf am meisten. Weil hier unser Vater, wenn alles klappte oder wenn er gut geschossen hatte, für jeden von uns beiden ein „Viertel Warme“ für 20 Pf kaufte, mit Semmel und Senf. Hm, das schätzten wir mehr als die üblichen Süßigkeiten bei der „Bernern“ oder bei der „Rungen“ an deren Verkaufsständen unter der großen Linde. Bei denen mussten wir selber bezahlen, und mit den wenigen Groschen, die wir hatten, konnten wir keine großen Sprünge machen.
Das Beste beim Schissen war der große Umzug durchs Dorf am Sonnabend Nachmittag, mit Blaskapelle und Spielmannzug. Hinter der Kerntruppe, den marschierenden und mit Gewehren bewaffneten Uniformierten des Kriegervereins, zog alles mögliche Volk hinterher. Manche Frauen oder Kinder wollten sich mit altherkömmlichen Kleidungs- oder Uniformstücken ein undefinierbares historisches Aussehen geben. Einmal trug mein Bruder Helmut Vaters Soldatenhelm aus dem Weltkrieg, eine sogenannte Pickelhaube, unter deren Spitze wir wichtigtuerisch den Einschuß eines Schrapnellgeschosses nachweisen konnten. Und im Inneren des abgenommenen Helmes zeigten wir ebenso stolz auf das durch die Verwundung vom Blut dunkel gefärbte Leder, was wiederum bei den Staunenden weitere Fragen auslöste. So bot sich gleich die Gelegenheit, die uns geläufige Kampfszene von Vaters Kopfverwundung im Jahre 1915, zwischen Dnjestr und Pruth in der Nähe von Chernowitz und Kolomea, erzählen zu können … Doch viel Zeit zum Erzählen gab es wiederum nicht, der geblasene Militärmarsch war schon verstummt, der ganze Zug war am Kriegerdenkmal angelangt: „Abteilung halt!“ „Links um … “, und dann begann das übliche Zeremoniell mit kurzer Ansprache zu Ehren der im Krieg gefallenen Helden des Dorfes; danach ertönten die Kommandos zum Ehrensalut, worauf sechs herausgetretene Kriegsveteranen ihre Gewehre durchluden und drei Salven in die Luft schossen. Ohne viel Aufhebens ging es weiter durch das Vorderdorf, wo der König aus dem vergangenen Jahr abgeholt, nein, sagen wir besser freigekämpft werden mußte. Und das ging so vor sich: Der ganze Zug hielt – wie in diesem Fall – bei Jäckels an, sofort schwärmten angreifende Schützen aus, die den Hof von Jenke Karl umzingelten und nach heftigem Kampf erstürmten, in das Wohnhaus eindrangen und den gefundenen oder gefangenen König mit großem Siegesgeschrei herausführten. Und es wurde natürlich geschossen und geballert – mit Platzpatronen, wie wir wussten, die aber, aus der Nähe abgefeuert, auch empfindliche Verletzungen hervorrufen konnten. Deshalb hielten wir uns trotz großer Begeisterung in respektvollem Abstand zum Kampfgeschehen. Bevor der Zug sich neu formierte, gab es für die Kämpfer einen tüchtigen Zug aus der Flasche und auch einen kräftigen Bissen zu essen. Welcher Sinn hinter jenem militärischen Kampfspiel der „Kameraden vom Kriegerverein“ steckte, weiß ich nicht zu sagen. Als Jungen haben wir auch nicht danach gefragt. Wir fanden das Ganze interessant und spannend.
Auch das jährliche Erntedankfest war gekrönt von einem Umzug durch das ganze Dorf und endete dann, wenn ich mich recht erinnere, im Gasthof Mai im Ortsteil Stamnitzdorf. Festwagen mit schön dekorierten Früchten aus Feld und Garten fuhren im Mittelpunkt des Zuges, gefolgt oder begleitet von fröhlichen Menschen, die sich auf unterschiedliche Weise aufgeputzt und maskiert hatten. Es gibt noch ein Foto, auf dem mein Vater mit dem Nachbar und uns Kindern in einer Gruppe abgebildet ist. Vater, als Frau verkleidet, schiebt einen uralten Kinderwagen, darin ein unartig plärrendes Kind, und um sich herum eine große Schar von lustig gekleideten Mädchen und Buben. Unser Vater spielte sich gern in eine solche komische und lustige Rolle hinein. Im Erntedankfest mussten zunehmend die nazistischen Ideen der „Blut und Boden Politik“ sichtbar gemacht werden. Abzeichen, Fahnen und Uniformen der NS-Organisationen färbten mehr und mehr solche dörflichen Veranstaltungen.
Die ausgesprochen christliche Sinngebung zum Fest von Christi Himmelfahrt blieb erhalten, nur die Teilnahme an dem Gottesdienst im Freien ließ nach. Es war üblich, des Mittags über die Harte bis zur Goldenen Aussicht zu wandern und dort dem Waldgottesdienst beizuwohnen. Bei schönem Himmelfahrtswetter versammelten sich auf der Waldwiese ein paar Hundert Leute aus den umliegenden Dörfern. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst wurden Spiele veranstaltet, vor allem für Kinder. – Wir zwei Jungen genossen an diesem Tag die gemeinsame Wanderung mit Mutter und Vater. So gab es unter den großen Fichten interessante Ameisenhaufen zu bestaunen, im nahen Sandsteinbruch die Herstellung von Mühlsteinen zu erklären oder den Verlauf des geheimnisvollen unterirdischen Ganges zu untersuchen. Meist gingen wir auch weiter bis zum „Simonishaus“ nahe dem Neuländer Kloster, wo wir durch die an diesem Tag geöffnete Tür die figürlich gestaltete Szene der Abendmahlgesellschaft mit Jesus und seinen Jüngern an langem Tisch betrachten konnten.
Wenn uns damals jemand gesagt hätte, dass 10 Jahre später, im März 1945 hier oben auf der Harte und im Klosterbereich die Russen ihre Schützengräben und Artilleriestellungen ausbauen und in Richtung Neuland/Kunzendorf die Deutschen unter Feuer nehmen würden, dann wäre dieser Jemand für verrückt erklärt worden. Vielleicht hätte man ihn sogar wegen Volksverhetzung oder Zweifel am Sieg der „Nationalsozialistischen Revolution“ ins KZ gesperrt.
Dann gab es im Frühjahr noch ein christliches Fest, das „Neuländer Bergfest“. Unterhalb des schon besagten Klosters, auf einer Bergwiese beim Gasthof Flegel, versammelte sich Jung und Alt aus der ganzen Umgebung. Ursprünglich war man hingepilgert, ich nehme an, um die Bergpredigt zu hören. Jetzt beließ man es bei einem katholischen Gottesdienst in der nahen Klosterkirche, und anschließend vergnügte man sich auf dem Rummelplatz der Bergfestwiese.