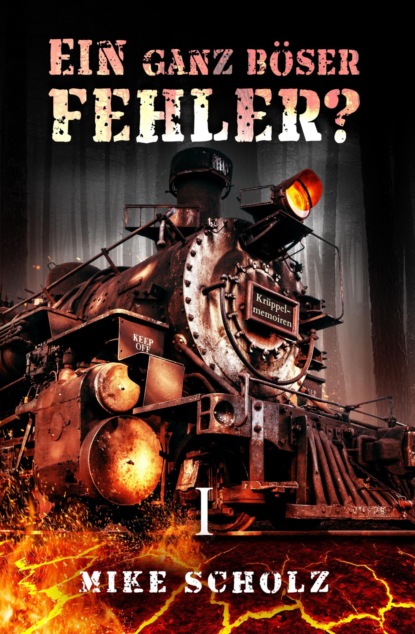- -
- 100%
- +
Ich spüre, dass da noch mehr in meiner dafür reservierten Kammer auf einen Ausbruch wartet. Was wird es noch sein, was mich dann völlig von ihr abstößt?
5
11. September. Vormittag.
Diesmal habe ich es geschafft aufstehen; wenn auch nur mit Mühe und Not. Und stehe jetzt neben dem Bett. – Da meine Aufpasseramme entlassen worden ist, kann ich mir das ohne Probleme leisten. Die anderen gucken nur misstrauisch und als ich ihnen sage, dass sie nicht klingeln sollen, drehen sie sich wieder ab. – Jetzt Lauscher ausfahren, denn ich möchte bei meinem Ausreißversuch nicht gestört werden.
Doch niemand ist zu hören. Schnell noch ein letztes Mal umschauen – von den anderen Patienten achtet keiner auf mich, also kann ich starten.
Der erste Schritt. Der zweite. – Dabei halte ich mich aber lieber fest, denn ich bin ja schon lange nicht mehr gelaufen.
Überraschend kommt plötzlich eine Schwester herein. – Innerliches Aufstöhnen – habe sie gar nicht gehört –, dann lasse ich mich grinsend ins Bett zurückfallen.
"Na, wo willst du denn hin?", fragt sie mich.
"Lieg is äääh lanweil."
"Jetzt bleibst du erst einmal liegen, gleich gibt es Mittag."
Nachdem sie mich gefragt hat, wie viel ich will (was jeden Tag passiert), dreht sie wieder ab.
Na gut, das Mittagessen wird noch abgewartet, dann geht es auf Tour.
*
Nach der Mittagsruhe richte ich mich wieder auf und strecke mein Ohr wieder in Richtung Außenterrain: Stille.
Ich stehe auf.
Jetzt ein Schritt nach dem anderen – langsam, festhaltend.
Dann vorn am Bett. Doch da sich mein Bettausgang an der Wandseite befindet, muss ich um das Bett herum, also an der Fußseite entlang.
Der erste Schritt, noch einer – plötzlich knickt mir das rechte Bein weg. – Wieder das rechte! Was ist nur los mit ihm?
Schnell versuche ich, mich am Bett festzuklammern, was aber auch schief geht. Ich falle, purzele allerdings geruhsam unter das Bett.
Zum Fluchen komme ich nicht einmal, da die anderen Patienten sich mir interessiert zuwenden.
"Ni kling, ich schaffsallee!", zische ich schnell, damit es draußen niemand mitbekommt. Und ächze mich schnellst möglichst unter mühsamer Aufbringung aller Kräfte ins Bett zurück.
*
Nach einer dringend benötigten Verschnaufpause stehe ich wieder auf. Rechts vom Bett steht ein Stuhl, den ich erst mal ansteuern will, um mich dort kurz erholen zu können. Er steht aber nicht genau am Bett, sondern ich muss erst vom Bett wegtreten. Aber zuerst um das Bett herum.
Noch langsamer als vorhin, noch vorsichtiger, denn ich kenne ja nun die Unteransicht des Bettes, brauche sie nicht noch ein drittes Mal zu besichtigen, meine Augen kleben fast am Fußboden.
"Phhh, gschafft."
Jetzt noch zum Stuhl und dann wäre der erste Zielort erreicht. Doch wie mache ich das am besten?
Ich bleibe stehen, denke nach. Und nach einer kurzen Weile fällt es mir ein: Immer an der Wand lang, na klar!
An der Wand stehend schätze ich den Raum bis zum Stuhl ab: Circa einen Meter. Doch alles frei um ihn herum, keine Möglichkeit zum Festhalten. – Den Meter schaffe ich auch noch, wäre ja gelacht, wenn nicht.
Wankend, schnell das linke Bein wieder zum Stand bringend – wobei mir mächtig die Kraft ausgeht –, erreiche ich den Stuhl und lasse mich erschöpft auf ihn fallen; wobei mir klar wird, dass ich erst mal eine Weile sitzen bleiben muss, um wieder Kraft zu tanken. Trotzdem – den ersten Teil habe ich geschafft!
Eine Schwester kommt herein. Verdutzt schaut sie mich an.
"Wie bist du denn in den Stuhl gekommen?", schaut sie sich misstrauisch um.
"Gloufe", bekommt sie lakonisch von mir zu hören. Und genieße dabei wohlig die von ihr ausgestrahlte Überraschung.
"Willst du bis zum Abendbrot im Stuhl sitzen bleiben?"
Ich nicke, hätte augenblicklich auch nicht die Kraft aufzustehen und zu flüchten. Außerdem wäre es jetzt völlig sinnlos abzuhauen, da es ja gleich was zu mampfen gibt. Denn zu dem Zeitpunkt laufen zu viele herum.
6
Mittwoch, 12 September. Morgens.
Nach dem Frühstück bin ich wieder mal dabei, mich in den Stuhl zu bugsieren, nur hilft mir diesmal eine soeben eingetretene Schwester.
Eigentlich könnten wir ja gleich weiterlaufen; wobei ich ihr natürlich nicht erzählen darf, dass ich abhauen will.
"Könntst Laufübung mitir mach, Schwesterchn, äh hm?" – So nenne ich alle hier befindlichen Krankenschwestern.
"Was für Zeug?"
"Laufübu--ngen. Od meinst, ich wi ew so rum-äh-hoppen?"
Sie schaut mich ungläubig an, dann grübelt sie nach.
"Heute Mittag, eher habe ich keine Zeit", ist sie sich dann schlüssig geworden. "Außerdem brauche ich noch jemanden dazu."
Das letzte Phonem spricht sie gar nicht mehr richtig aus, dreht schnell ab und verschwindet – wahrscheinlich, damit mir nicht noch mehr einfällt.
*
Ich warte und sitze, sitze und warte – furchtbar langweilig. Auch habe ich keine Ahnung, wie spät es ist. Ohne Uhr ist das schlecht möglich (meine Mutter ist der Meinung, ich brauche keine) und eine innere Zeituhr besitze ich nicht. Ergo gehe ich den Schwestern, immer wenn sie kommen, gehörig auf den Geist, fordere stets Laufübungen, gebe keine Ruhe mehr – irgendwann muss es ihnen doch mal zu bunt werden und irgendwann müssten sie mir doch mal den Wunsch gewähren.
*
Schließlich werde ich erhört: "Auf geht's, jetzt ist die Laufübung dran."
Sofort werde ich nervös, fühle eine nervliche Anspannung in mir. Doch wahrscheinlich ist es immer so, wenn man etwas heiß ersehnt und nach endlosem Warten endlich erhält. Deshalb achte ich auch nicht weiter darauf; und einen Rückzieher zu machen kommt sowieso nicht in Frage.
Sie heben mich an den Armen auf die Füße: Ein herrliches Gefühl, ohne festhalten wieder auf den eigenen Beinen zu stehen. (Die Schwestern halten mich an den Oberarmen, so dass ich die Hände nicht irgendwo dagegenstemmen muss.)
Der erste Gang in Richtung Tisch. Manchmal knicken mir die Beine weg, aber es muss weitergehen, denn schließlich will ich ein Ziel erreichen. Dabei merke ich aber, dass es ohne Hilfe noch (!) nicht gehen würde. – Also muss ich weitertrainieren! Das ist die einzige Möglichkeit!
Vom Tisch aus laufen wir zurück zum Bett. Doch dabei zeige ich rapide Verschleißerscheinungen, die letzten Schritte schleiche ich nur noch. Und wären nicht die Schwestern, dann würde ich schon lange wütend auf dem Boden liegen.
"Na, es reicht wohl erst einmal", sagt eine der Schwestern. "Du kannst jetzt sowieso eine Pause machen, es gibt nämlich gleich Mittag."
"Bist du zufrieden, Mike?", will die andere wissen.
"Für erst äh ja. Da aber ni heess, dass grad die letzt äh Tour war. Wann kommtirn heut wiede?"
"Das musst du unserer Ablösung sagen. Wir machen nach dem Mittagessen Schluss."
"Daserd ich. Ihr könnt euch äh drauf verlass."
Sie lachen wissend und lassen mich zurück ins Bett plumpsen.
*
Unfern vom Abendbrot wird mit mir endlich die nächste Laufübung gemacht. Und bei der erreichen wir gerade den Tisch, als meine Mutter erscheint.
"Bringen Sie ihn bitte zurück ins Bett", weist sie die Schwestern an.
Fassungslos, mich endlos aufregend, erschreckt starre ich sie an: Die spinnt wohl! Ich bin froh, dass ich aus dem Bett raus bin!
Strohdo...
Strohdoof? Strohdoppelgeil? Oder was war das? War es vielleicht wieder die besondere Kammer, die brauchbare Informationen über meine Mutter enthält?
"Waruniin Stuhl?", grollt es konfrontationsbereit in meiner Stimme.
"Im Bett geht es leichter, auch für dich."
Ich bin entsetzt, entsetzt über so viel Dummheit. Doch jetzt stehen mir die Schwestern bei: "Er kann in den Stuhl, er ist schon fast den ganzen Tag dort. Und gestern war er auch."
Meine Mutter wird rot. – Nichts mit bestimmen über mich! – "Na gut, ich wusste das nicht", lenkt sie zerknirscht ein.
Ich aber muss erkennen, dass in Bezug auf sie wieder eine Erinnerung gekommen ist: Erst fiel mir ein, dass sie meine Mutter ist, dann, dass ich von ihr als Kind wie das letzte Stück Dreck behandelt wurde, und heute, dass sie einen Dachschaden hat. Langsam öffnet die Kammer "Persönlichkeit meiner Mutter" ihre Pforten.
Nach ein paar Grußübermittlungen und dem Hinweis, dass sie morgen nicht kommt, verschwindet sie wieder. – Habe ich vielleicht an ihrer Ehre gekratzt?
7
Donnerstag, 13. September. Vormittag.
Ich sitze schon eine Zeit lang im Stuhl und warte darauf, dass mit mir wieder eine Gehschule gemacht wird. Doch die Schwestern haben mich darauf hingewiesen, dass ich mich gedulden müsse, da ich nicht der einzige Patient wäre. Was ich auch verstehe. Doch Geduld – was ist das??
Aber siehe da – nur wenig Zeit ist vergangen, da kommen zwei Schwestern herein und wenden sich mir zu: "Möchtest du ans Fenster?"
Ich brauche nicht lange zu überlegen: "Nisch äh dageg." Eine willkommene Abwechslung.
"Aer", erinnere ich sie noch, "nisch die Gehschule vergess."
"Die lässt du uns ja gar nicht vergessen. Also, auf zum Fenster.
Unterwegs schüttle ich meine Latschen ab, denn bei jedem halben Schritt fallen sie mir von den Füßen, sind dadurch äußerst hinderlich, blockieren mir laufend den Weg.
"Hast du keine anderen, Mike?", werde ich gefragt.
"Hier ni. Zu Hause äääh normweis ja. Ich frag ma mein Mutter."
"Mach das. Du brauchst dringend Schuhe. Die Latschen hier sind für dich nicht geeignet."
Und nachdem sie mir diese geholt haben, lassen sie mich am Fenster sitzen.
*
Draußen ist es sonnig. – Das wäre die richtige Zeit, um etwas zu unternehmen. Was habe ich an solchen Tagen immer gemacht? – Ach, darüber sich jetzt einen Kopf zu machen, ist eh affig, denn man kommt ja hier doch nicht raus, zumindest nicht ohne Schwierigkeiten. Was ist das eigentlich für eine Gegend hier? Ich glaube, die habe ich schonmal gesehen, aber wo? Im Krankenhaus kann es nicht gewesen sein; denn als ich mal Steffen besuchte, da sah es anders aus. Also wo bin ich? Laut Pia im Krankenhaus. Laut meiner Mutter nirgendwo. Laut den Frauen (Schwestern?) im Krankenhaus. Und ich selber glaube auch fast daran. Nur – wie komme ich hierher? Warum bin ich im Krankenhaus? Was ist geschehen? Was Pia mir erzählt hat, das ergibt keinen Sinn (Wirklich nicht?), wirft nur mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Doch ich kann machen, was ich will, meinen Erinnerungsspeicher durchforsten, so lange es mir Spaß macht; ohne die Andern habe ich keine Chance, bleibe der Trottel, der sich an reichlich einen Monat nicht erinnern kann!
Plötzlich fällt mir auf, dass mein Blick verschwommen ist. Gaukele mir aber die Ausrede vor, dass es sicher an meiner lückenhaften Erinnerung liegt. – Warum? – Doch selbst mir kommt dieser Grund schleierhaft vor. – Okay, meine Mutter hat es bisher nicht für nötig gehalten, mir mal meine Brille vorbeizubringen. – Blödsinn, ich brauche doch meine Brille nicht ständig. Aber warum ist dann alles so undeutlich hier? Vielleicht liegt es an der Atmosphäre hier drin?
Was sehe ich denn da – Trabis? Ich denke, die sind aus dem Verkehr gezogen? Na ja, irren ist menschlich, sprach der Igel und stieg von der Klobürste.
Ich sehe auch ein paar Leute herumlaufen, einer raucht dabei. – Ich rauche doch auch! Oder habe ich mal geraucht? Egal. Fakt ist, ich hätte jetzt übelst Lust drauf. Doch da ich keine Zigaretten habe, hat sich das Thema von ganz allein erledigt.
Nachdem ich einer – zu ihrem Leidwesen? – erscheinenden Schwester wieder mit der Gehschule auf den Geist gegangen bin, überlege ich, was ich jetzt tue. – Eeh das da kann mich absolut nicht zu wilden Ovationsgelagen hinreißen. Aber irgendwas muss ich gegen diese Scheiß Langeweile unternehmen. Darum: Wieder Gymnastik? Nee, dazu müsste ich ja ins Bett zurück, und dazu habe ich keine Lust. Was dann??
Als ich mitbekomme, dass mein Kopf unerwartet auf die Brust gesackt ist, schraube ich ihn zwar sofort wieder hoch, muss mir aber die Frage gefallen lassen, was er da unten zu suchen hat. – Ich bin doch gar nicht eingepennt!
Plötzlich fühle ich mich müde, unendlich müde, schlapp, saft– und kraftlos. Dazu fällt mein Kopf immer wieder herunter.
Erneut werde ich vom Gefühl der Wut gepackt, einer ohnmächtigen Wut, die mich hier fast ständig angreift, animiert wird von immerfort neuen Sachen, die merkwürdigerweise nicht mehr in Ordnung sind: laufen, sprechen, richtig essen, trinken ohne Schnabeltasse, urinieren, rasieren ...
Deshalb lasse ich mich von einer Schwester zurück ins Bett bringen. Auch wenn ich weiß, dass ich dort nicht schlafen werde können. Denn im Bett bin ich dann wieder munter, als wenn man mir einen Eimer mit kaltem Wasser übergekippt hätte.
8
Freitag, 14. September. Vormittag.
Diesmal wurde ich von einer Schwester, nachdem ich erst am Fenster sitzen durfte, zum Tisch gebracht, habe Zettel und Stift vor mir liegen, übe das Schreiben meines Namens. Und das mit rechts; denn ich habe keine Lust, mich umzugewöhnen. Zwar muss die rechte erst wieder lernen, den Stift zu halten, doch die linke müsste erst lernen, lesbar zu schreiben, womit zwischen den Schwierigkeiten ein Patt herrschen dürfte. Und außerdem will ich beide Seiten gebrauchen können.
Bei den ersten Versuchen kann ich den Stift aber wieder nicht festhalten. Worauf irgendetwas in mir ausrastet und ich der rechten eine klatsche.
Kurz summt es ganz leicht in ihr, mehr aber keineswegs. Darum versuche ich mit links den Stift festzuhalten und mit rechts zu führen, will dabei langsam das Festhalten verringern, bis ich es ganz lasse.
Als es soweit ist, darf ich beobachten, wie mir der Stift erneut aus den Fingern rutscht.
Ich werde zur Abwechslung mal knurrig auf das Papier: Scheiß-holprig ist das, bringt den Stift dazu, laufend hängenzubleiben. Doch sofort flüstert mir jemand zu: Schiebe es nicht auf das Papier. Du bist der Schuldige selbst. Und ich muss mir eingestehen, dass es stimmt. Also muss ich mit der linken weiterhin festhalten.
So klappt es einigermaßen. Und ich fange an, meine eigene Schrift wieder lesen zu können.
Das ist doch kein Kunststück. Wenn du nur deinen Namen schreibst und weißt, dass du ihn schreibst, dann kannst du sogar jauchzende Hampelmänner in rauschenden Bäumen erkennen!
Mir ist klar, dass die Unterschrift oft gebraucht wird, deswegen übe ich weiter. Schreibe sehr langsam, um Schönschrift hinzusetzen. Doch was eine sein soll, sieht aus wie die Schrift eines besoffenen Arztes. Auch eine Schwester, die ich über mein Geschreibsel urteilen lasse, befindet, dass meine Schrift manchmal unlesbar ist, sonst entzifferbar. Und mir wird klar, dass dies noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. Außerdem halte ich den Stift wie ein Kleinkind, dass seine ersten Malversuche startet. Doch ich bin kein Kleinkind mehr und strichele auch nicht irgendwas aus. Deswegen gibt es nur eins: Weiterüben.
*
Am Nachmittag lässt sich Pia wieder blicken. Sieht mich schreiben und beguckt es sich. "Nicht schlecht", meint sie dann.
"Dasisdo nur mei Nam", mindere ich das Lob ab. "Dowie wärs, wennich dir mal ee gans Satz offschreib und du sag, was geschrieb hab?" Und setze meinen Vorschlag in die Tat um, ohne erst ihr Ja–Wort abzuwarten, einen Satz, welcher mich – nicht nur derzeit – ungemein beschäftigt.
"Der erste Satz ist gut geschrieben", meint sie beim ersten Blick auf das Papier. "'Ich liebe dich!' – Stimmt das?"
Ich nicke mit sehr ernstem Gesicht.
"Danke!", bekomme ich genauso ernst zurück. "Ich dich auch! Ich werde auf dich warten!"
Dann ist ein Ruck an ihr zu erkennen, der ihr Lächeln wieder auf ihren Mund zaubert: "Zurück zum Zettel."
Sie gibt mir noch einen Kuss – Immer nur kleine; warum eigentlich nie große? – und konzentriert sich wieder auf das Geschriebene: "Also das erste Wort ist wieder 'ich'. Dann folgt" – sie versucht zu buchstabieren – "achso, "ich will mit dir". Doch das letzte Wort kann ich nicht lesen. Was soll das heißen?"
"Dadoch das Wichtigs am gans Satz!"
"Sag es mir bitte", bettelt sie.
"Na gu, weil dusist: 'schlafen'."
"Also zusammengefasst heißt das – hä, du hast zu viel Zeit hier! Aber das ist ganz typisch für dich. Daran sieht man, dass du dich absolut nicht geändert hast. Nur – das dürfte hier drin schlecht möglich sein."
"Ich wijaouniewig hör drin bleib. Aber fürerst werd ich Ulau beantagn."
"Kriegst du denn hier drinnen welchen?"
"Weeßchni, dopobiern gehvor studier. Unnach Hiefe schein kannimmernoch."
"Okay, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert", bestätigt sie. "Aber jetzt gehen wir ins Besuchszimmer. Oder willst du nicht?"
"Beiir stichswoh, wa?" – Seit gestern ist das für uns reserviert.
*
Dort angekommen, zeigt sie mir erst einmal, was sie mitgebracht hat: drei Schmöker. – Sind zwar Liebesromane alias Mitglieder des Schnulzenkabinetts aus dem Zeitungskiosk, aber die Hauptsache ist, wenigstens etwas zum Lesen, zum Vertreiben der quälenden Langeweile. – Dann packt sie noch Sachen aus, welche sie von meiner Mutter für mich bekommen hat: einen Schlafanzug – zu Hause habe ich zwar nie einen an, aber wenn ich hier die ganze Zeit nackt rumlaufen würde, so einen großen Terminkalender habe ich gar nicht –, meine Brille – die ich sofort aufsetze und dadurch wieder einen verbesserten Durchblick habe – und ein Paar Turnschuhe – Ich wusste gar nicht, dass Adidas auch solche barbarisch hässlichen herstellt. Ach ja, kann mich erinnern: Meine Mutter hat ja den Geschmack einer blinden Bergziege. – "Ich wollte auch Anziehsachen für dich haben", erzählt mir Pia, "doch deine Mutter wollte da nichts rausgeben. Ich musste ihr schon mächtig auf den Pelz rücken, um das hier zu kriegen."
Ich bedanke mich bei ihr und will noch wissen, warum meine Mutter sich so hat.
"Kann ich dir auch nicht sagen. Vielleicht will sie die selber anziehen."
Wir halten es beide für möglich und machen uns lustig darüber, haben endlich mal Gelegenheit, ein Weilchen miteinander zu lachen.
Danach zeigt sie mir Bilder von ihrem Urlaub im letzten Monat. "Eigentlich wollte ich gar nicht fahren, doch meine Mutter meinte, ich müsse, damit ich wieder auf andere Gedanken käme. Was auch richtig war. Nur wurde der ganze Urlaub überschattet von dem Unfall. Es war mir ein bisschen peinlich, dich im Krankenhaus zu wissen und mich im Urlaub an der Ostseeküste."
Aha, also schon im August hier. Hm. Was ist jetzt? September? Doch wieso war ich im August im Krankenhaus? Hat sie mir ja schon gesagt; sehe bloß noch nicht durch. Aber was war nun im August? Fragen? Nee, würde bloß die traute Atmosphäre zerstören. Also lass ich es, mache es später. – Ich schaue mir weiter die Bilder an.
*
Die Tür geht auf – nur ich darf bis zum Abendbrot 17.30 Uhr Besuch empfangen, bei den anderen ist als Ende der Besuchszeit 17.00 Uhr verbindlich –, eine Schwester kommt herein und teilt mir mit, dass es an der Zeit ist.
"Pia", holen mich meine Depressionen wieder ein, "ich finsum Kotzn, dass meruns wietrennmüssn. Kannstasni irnwie abännern?"
Ich kann jetzt ganz tief in ihre blauen Augen schauen, bis hinunter zur Seele, als sie langsam den Kopf schüttelt.
Plötzlich kommt mir eine Idee – eine verrückte Idee, yeah, doch was soll's? Verrückt sein ist eigenartig und damit interessant. "Pia, kammirn Gefalltu?", versuche ich, hinab in ihre Seele zu sprechen.
"Welchen?"
"Mizrück indä Bett bring?"
"Du meinst die Schwestern begleiten, wenn sie dich zurückbringen? Na klar. Aber das mache ich doch immer."
"Nee, das meinichni. I mein, dassde mich rübschafft."
Ein Anschein von Verwirrung auf ihrem Gesicht. "Machen das nicht die Schwestern?"
"Normal--erweise ja. Aber ich möch, dass dus heutut – tust", bitte ich sie.
"Aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht", wendet sie ein. "Außerdem bin ich dazu viel zu schwach."
"Meinse, die Schestern sin kräfter?" Wissentlich vermeide ich es zu erwähnen, dass das immer von zweien gemacht wird. Denn ich will einfach in ihren Armen liegen und dadurch für einen Moment alles vergessen können, was mich derzeit fast erstickt.
"Aber was ist, wenn es schief geht?"
"Gehesni." Daran habe ich überhaupt keine Zweifel. Weise sie viel mehr daraufhin, dass ich hier schon zweimal unter dem Bett landete, dabei mir aber nie was passiert war.
Damit habe ich sie überzeugt. Wir starten.
Sie nimmt mich an der Schulter, ich lehne mich auf sie – spüre ihren berauschenden Duft, kann die goldenen Härchen sehen, die sich auf ihrem Hals aufgerichtet haben, fühle, wie ich meiner Umwelt enteile, in diesem Augenblick so glücklich bin wie schon seit Jahrhunderten nicht mehr.
Durch die Tür treten wir Arm in Arm hindurch. Doch jetzt dringt unvermittelt ein Schimmer in mein eingenebeltes Bewusstsein, der mich dazu zwingt, meinen Blick von ihrem Hals, ihrer Schulter, ihren Brustansätzen abzuwenden und ihn auf die ganze Frau zu richten: Sie kämpft wie eine ihr Junges behütende Bärenmutter, um mich nicht fallen lassen zu müssen, keucht dabei, als wöllte sie einen Orgasmus herbeizwingen, der jedoch keine Lust hat, in ihr aufzusteigen. Doch sogleich wandere ich in den Dämmerzustand zurück, rede mir ein: Sie wird es schaffen.
Draußen wird der Vorgang sofort von den Schwestern bemerkt, die sich nun wie bei einer Parade aufstellen, um uns zu beobachten. Und ich – ich erwache und muss lächeln.
Doch lange lächeln kann ich nicht. Denn plötzlich merke ich, wie Pia Schwierigkeiten bekommt. Ihr Keuchen wird immer stärker, jetzt muss sie mir auch immer wieder neu unter die Schulter fassen. Ich mache mich bereit, auf Tauchstation zu gehen, lockere den Griff. – Nicht sie soll sich dabei verletzen; ich bin ja eh schon im Eimer.
Dann – ich merke, dass sie anfängt zu stolpern. Ich lasse los.
Wie ein nasser Sack bin ich zu Boden gefallen, versuchte zwar noch, die linke zum Abfangen zu benutzen, doch auch die ist zu schwach dafür. Diesen Moment ihrer Nähe aber bereue ich keinen Augenblick.
Pia, nachdem sie ihr Gleichgewicht wieder gefunden hat, und auch die Schwestern, welche sofort zu mir gerannt gekommen sind, wollen wissen, ob mir was passiert sei, ob ich verletzt bin, ob ich Schmerzen verspüre.
Doch nach einem Blick auf Pia habe ich mein Lächeln wieder gewonnen. Vor allem jetzt, bei dem Anblick der besorgten weiblichen Gesichter um mich herum, wird es breiter. "Iwo", beruhige ich sie dann, "allin Butter. Konnja schließ ni mehr as schiefgehn."
"Du bist verrückt!", erklärt mir eine der Schwestern.
Währenddessen wendet sich Pia ihnen zu. "Tut mir leid, aber er war einfach zu schwer für mich."
Die gleiche Schwester, die mich als verrückt abgestempelt – gepriesen! – hat, meldet sich wieder zu Wort: "Das ist auch kein Wunder, so viel, wie er isst. Eigentlich müsste er so richtig fett sein. Wer weiß, wo sein Fett sitzt."
Pia und ich schauen uns lächelnd an; ich glaube, wir denken beide das Gleiche.
Damit verabschiedet sie sich aber, wonach ich ins Bett gebracht werde – von zwei Schwestern.
9
Sonnabend, 15. September. Vormittag. Visite.
"Herr Doc, fol-äh-gend--es Probem: I möch nächses Wochnend Ulaub bekommeen!" Während ich ihm das sage, bin ich enorm aufgeregt, versuche aber, mir das nicht anmerken zu lassen, weil ich glaube, damit meine Erfolgschancen zu schmälern.
Verdutzen quillt nun zu mir herüber. "Was wollen Sie – Urlaub??", scheint er so ein Ansinnen noch nie gehört zu haben. "Das würden Sie doch gar nicht durchstehen!"