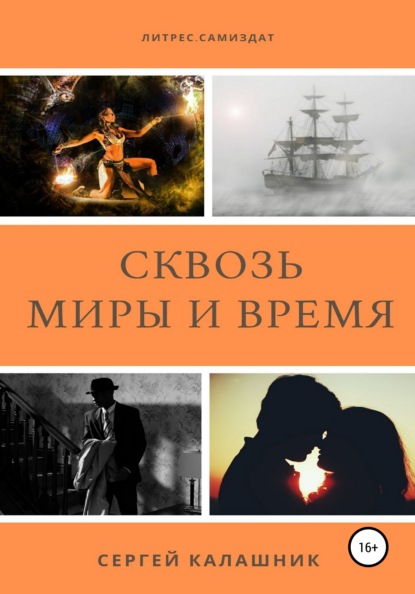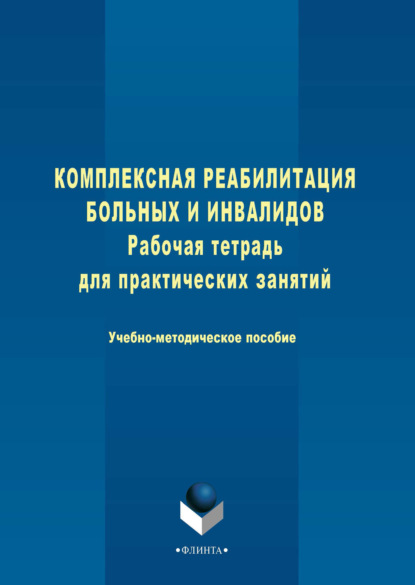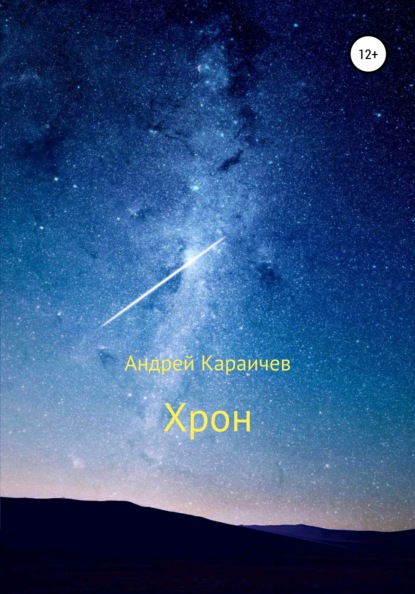- -
- 100%
- +
Beispiele: Vernetzung der Lernorte, virtuelle Lernräume, flexiblere Gestaltung von Lehrgängen, Wahl des Studienmodus je nach Lebenssituation (z. B. Fern-, Teilzeitstudium).
Obwohl aber im System der Berufsbildung weiterführende und flexiblere Bildungswege geschaffen wurden, nehmen die Zielgruppen die Option eines Wechsels zwischen formalen Bildungsniveaus seltener als erwartet wahr. So sind die Quoten derjenigen, die beispielsweise nach der Berufsmaturität ein Fachhochschulstudium oder gar – über eine den Anschluss herstellende »Passerelle« – ein universitäres Studium aufnehmen oder die nach einem Fachhochschulabschluss an der Universität weiterstudieren, bescheiden geblieben (Weber 2013, 29f.; Gonon 2012). Die Erstausbildung, die in der Schweiz seit jeher die Erwerbskarriere stark vorbestimmt, bewahrt offensichtlich ihre hierarchisch ordnende Kraft, und das Hochschulsystem bleibt gespalten in ein beruflich ausgerichtetes und ein akademisches Segment (Kiener 2013, 347f.).
Internationale Regulierung und Steuerung von Bildung
Die schweizerische Bildungspolitik hat sich in ihren Reformen den internationalen Regulierungsbestrebungen im Bildungswesen frühzeitig angeschlossen und neue Modelle rasch umgesetzt. Dies betrifft vor allem die Richtlinien für den Europäischen Hochschulraum (Bologna-Prozess, vgl. Müller 2012, 247), aber auch die Einrichtung eines »europäischen Raums der beruflichen Bildung« (Kopenhagen-Prozess). Weitere Formen der internationalen Regulierung zielen auf die standardisierte Messung von Schülerinnen- und Schülerleistungen (z. B. PISA) oder die länderübergreifenden Referenzrahmen zur Einstufung beruflicher Kompetenzniveaus (Europäischer bzw. nationale Qualifikationsrahmen, Dehnbostel 2008, 167f.). Auch in der beruflichen Bildung wurden Standards der Modularisierung, Kompetenzorientierung und Individualisierung in die Lernorganisation der Bildungsgänge aufgenommen, besonders zügig bei der Neuordnung der Fachhochschulen und höheren Fachschulen.
Als wichtige Regulierungsinstrumente erweisen sich die Normierung der Studienstrukturen und die Einführung der standardisierten Leistungsbemessung mit ECTS-Leistungspunkten auf Hochschulebene respektive mit ECVET-Leistungspunkten in der höheren Berufsbildung.[4] Leistungspunkte werden in Abhängigkeit von der Anzahl der absolvierten Module, Kompetenz- und Praxisnachweise an die Gesamtleistung angerechnet. Der Stand der zertifizierten Leistungsergebnisse zeigt an, wo die Lernenden im Curriculum stehen und welche Verwertungsoptionen für den Einstieg in andere Ausbildungen oder Berufsfelder bestehen. Wichtiger jedoch ist die wirtschaftliche Funktion solcher Regulierung. Sie soll die Mobilität der Qualifikationsträgerinnen und -träger auf den internationalisierten Bildungs- und Arbeitsmärkten erhöhen und – in wettbewerbspolitischer Perspektive – ein optimal entwickeltes und quantifizierbares Humankapital für die Wirtschaft am jeweiligen Standort verfügbar machen. In diesem Sinne hat die EU bereits in ihrer Lissabon-Strategie im Jahr 2000 die Vorstellung eines offenen Europäischen Bildungsraums festgeschrieben, mit dem hochgesteckten Ziel, Europa zum weltweit wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum zu machen (Knust & Hanft 2009, 40f.).
Gestärkt wurde seit den 1990er-Jahren auch die politisch-administrative und die betriebswirtschaftliche Steuerung im Bildungssektor (Dehnbostel 2013, 42f.). Zum einen verlagerte sich die Steuerung von der Inputseite (Budgetplanung) hin zu Leistungsprozessen und Output, wobei der Auftraggeber Leistungsziele (Umsatzziele, Abschlussquoten, Zufriedenheitsergebnisse) vorgibt und überprüft. Zum anderen wird indirekt über Qualitätsvorgaben und Zertifizierungsverfahren gesteuert. Im Hochschulbereich müssen sich Bildungsanbieter gemäß staatlichen und internationalen Richtlinien akkreditieren lassen, das heißt: Sie müssen den Nachweis erbringen, dass sie Standards einhalten und Vorkehrungen treffen, um formale Leistungs- und Qualitätsziele zu erreichen. Diese Veränderungen zielen bei Weitem nicht nur auf die Steuerungseffizienz in der Institution, sie führen ein neues Regime ein, unter dem sich jede einzelne Fachhochschule bzw. Universität als unternehmerische Einheit versteht (Kiener 2013, 346f.).
Internationale Regulierung, politisch-administrative und betriebswirtschaftliche Steuerung haben Auswirkungen auf die berufsorientierte Weiterbildung, nicht nur auf die ohnehin stark regulierte höhere Berufsbildung, sondern auch auf die anderen Segmente. So finden beispielsweise Standards der Curriculumentwicklung, der Leistungsmessung und Zertifizierung auch in der Weiterbildung Beachtung. Allerdings folgt ihre Anwendung oft einer anderen Systematik; zudem gibt es für die Qualitätsentwicklung vielfach nur Empfehlungen (vgl. Kapitel 3.3).
Kohärenz der Bildung aus gesellschaftspolitischer Sicht
Wie sind die Veränderungen im Bildungssystem gesellschaftspolitisch einzuschätzen? Verfügt die Bildungspolitik über eine kohärente Orientierung, die ihr erlaubt, auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Problemlagen differenziert zu reagieren? Mit Bezug auf die berufliche und schulische Grundbildung und die primäre Integration junger Erwachsener in den Arbeitsmarkt kann die Frage für die Schweiz in der Tendenz positiv beantwortet werden, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Die institutionellen Träger der beruflichen Grundbildung sind heute mit der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor eng vernetzt.
Einschränkungen sind jedoch beim Zugang zur beruflichen Grundbildung zu machen: Der Übergang von der obligatorischen Bildung in die berufliche Grundbildung, auch in die Erwerbstätigkeit fällt Schülerinnen und Schülern mit schwächeren Leistungen oder mit Migrationshintergrund nach wie vor nicht leicht. Sondermaßnahmen (»Brückenangebote«) lösen dieses Problem nicht zureichend, es kommt öfter zum Abbruch von Bildungslaufbahnen (Künzli & Scherrer 2013).
Probleme gibt es ferner bei der beruflichen Nachholbildung Erwachsener ohne Berufsabschluss. Nach Lindenmeyer (2013) werden die gesetzlich vorgesehenen Wege der Nachholbildung via Erfahrungsjahre, spezielle Bildungsgänge und Validierungsverfahren auch deshalb wenig genutzt, weil es den Betroffenen an Selbstlernkompetenzen mangelt, aber auch weil Begleitung und finanzielle Überbrückungshilfen fehlen.
Weitere Vorbehalte sind mit Bezug auf die soziale Selektivität der höheren Bildung anzubringen. Zwar sind Fortschritte bei der institutionellen Durchlässigkeit der Bildungswege zu verzeichnen (siehe oben). Der Zugang zur höheren Bildung ist jedoch nach wie vor in hohem Maße abhängig von der sozialen Herkunft, und zwar besonders ausgeprägt auf dem akademischen Niveau. Die Segregation des Bildungssystems nach Geschlecht ist in den letzten Jahrzehnten insofern schwächer geworden, als sich der Zugang von Frauen zu höheren Ausbildungsniveaus deutlich verbessert hat; dies schlägt sich aber nach wie vor nicht in einem gleichberechtigten Zugang zu Führungspositionen am Arbeitsmarkt nieder. Die Selektivität der höheren Bildung zeigt sich auch daran, dass im Lehr- und Forschungsbetrieb der Hochschulen Fragestellungen der Geschlechterforschung und des Feminismus nach wie vor nur am Rande existieren (Fankhauser & Schöni 2013).
Der Beitrag der Bildung zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen könnte also in vielen Bereichen gezielter und wirksamer gestaltet werden. Über die Ansatzpunkte allfälliger Korrekturen besteht allerdings wenig Einigkeit. Vielmehr werden auf dem Gebiet der Bildung grundsätzliche gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen geführt. Sie betreffen etwa die Gewichtung des schulischen und des beruflichen Bildungswegs, der Wirtschaftsbedürfnisse und der sogenannten Akademisierung (vgl. Strahm 2014). In der Analyse dieser Konfliktpunkte ist zu beachten, dass der Bildungssektor längst selber ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Seine Akteure haben keineswegs nur den Bildungsauftrag oder die Kohärenz der Bildung im Blick, sie verfolgen vielmehr eigene Einfluss- und Wachstumsinteressen.
Fazit: Das Bildungssystem nimmt Probleme der Arbeitswelt auf, um sie zu bearbeiten und Wege der Qualifizierung anzubieten. In der Abstimmung der Bildungswege und in der Steuerung der Bildungsleistungen sind in den letzten Jahrzehnten Fortschritte erzielt worden. Zunehmend definiert das Bildungssystem aber auch selber Probleme und Lernbedürfnisse, für die es »passende« Angebote bereitstellt und damit neue Geschäftsfelder besetzt. Als Folge haben die Bildungsmärkte, ob staatlich reguliert oder kommerziell, ihr Sortiment stark erweitert. So entstanden neben den großen Bereichen der formalen (Grund-)Bildung ausgedehnte zielgruppenspezifische Angebotsprogramme: Karrieremodule für Arbeitskraftunternehmerinnen, Lebensgestaltungstools fürs breite Publikum, arbeitsmarktliche Zwangsmaßnahmen für Problemgruppen usw.
Die Expansion zeitigt ambivalente Folgen. Sie kann in Teilbereichen die berufliche Handlungskompetenz der Erwerbstätigen stärken. Zugleich festigt sie bei ihnen jedoch die Vorstellung, dass Probleme der Erwerbsarbeit, der wirtschaftlichen Entwicklung oder der sozialen Beziehungen sich ohne die Teilnahme an Lernveranstaltungen nicht lösen lassen; und dass alles nur eine Frage des passenden Lernangebots sei. Werden gesellschaftliche Problemlagen in dieser Weise »pädagogisiert«, wie die Bildungswissenschaftler K. A. Geißler und F. M. Orthey schon vor einigen Jahren diagnostizierten (1998, 33f.), birgt dies das Risiko, dass nur thematisiert wird, was sich mit pädagogischen Mitteln und marktgängigen Angeboten bearbeiten lässt.
2 Weiterbildungspolitik und Weiterbildungsmärkte
Die Veränderung von beruflichen Funktionen, Geschäftsprozessen und Arbeitsmarktstrukturen verlangt, dass erworbene Kompetenzen aktualisiert, erweitert und vertieft werden. Wie das Weiterbildungssystem auf den Bedarf reagiert und welche Angebote es bereitstellt, ist indessen nicht allein durch den Bedarf bestimmt. Zum einen kann, was als »Bedarf« gilt, selber Resultat der Einschätzung und Interpretation sein. Zum anderen reagiert das Weiterbildungssystem immer auf der Grundlage von bereits aufgebauten Angebotsstrukturen und Kapazitäten, von Geschäftskonzepten der Anbieter, von Marktdynamiken und Vorgaben der Bildungspolitik. Weiterbildung deckt folglich nicht einfach Bedarfe »im Dienste der Wirtschaft« oder »im Dienste der Lernenden«. Ihre Tätigkeit steht vielmehr im Spannungsfeld sich überlagernder Strukturen, Politiken und Akteursinteressen.
Dieses Kapitel untersucht die politischen Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Weiterbildungsbranche. Wie verändert sich das Geschäft der berufsorientierten Weiterbildung, welche Angebotsstrukturen sind etabliert, wie werden die Weiterbildungsbranche und ihre Teilmärkte reguliert? Die Ausführungen nehmen Bezug auf die schweizerische Weiterbildungslandschaft. Ihre Begriffskategorien und Fragestellungen sind jedoch auch auf andere Länder und Bildungskontexte anwendbar, vor allem im deutschsprachigen Raum.
Kapitel 2.1 beginnt mit einem kurzen Abriss der Weiterbildungspolitik in der Schweiz. Der Fokus liegt auf der Entstehung der Erwachsenen- und Weiterbildung, auf den ordnungspolitischen Vorstellungen zur Weiterbildung und auf der Entwicklung ihrer institutionellen und gesetzlichen Grundlagen. Danach wird in Kapitel 2.2 dargelegt, welche Segmente bzw. Geschäftsfelder heute zur berufsorientierten Weiterbildung zu zählen und wie Marktvolumen und Branchentrends einzuschätzen sind. Kapitel 2.3 beschreibt Dynamiken der Angebotsexpansion und Angebotsdifferenzierung in den wichtigen Geschäftsfeldern der berufsorientierten Weiterbildung. Ziel der Analysen ist es, Trends der Weiterbildungspolitik und der Weiterbildungsmärkte zu identifizieren.
Auf dieser Basis fragt das 3. Kapitel nach der Wirksamkeit des Weiterbildungssystems: Inwieweit ist es in der Lage, angemessene Antworten auf die Veränderungen der Arbeitswelt zu geben, geforderte Kompetenzen zu stärken, kohärente Bildungswege aufzubauen und die Ungleichheit der Bildungschancen zu vermindern? Darauf folgt die Analyse der Wertschöpfung im Weiterbildungsgeschäft.
2.1 Weiterbildungspolitik in der Schweiz
In der Schweiz steht die Weiterbildung politisch-ideologisch in einer liberalen Tradition, sofern die über Jahrzehnte dominierende Verbindung aus bildungspolitischer Zurückhaltung und generalisiertem Marktvertrauen überhaupt eine Tradition begründen kann. Konstanten dieser Ideologie sind das »eigenverantwortliche Individuum« und der »freie Markt«, während dem Staat nur subsidiäre Aufgaben zukommen (Fischer 2014, 15; Weber & Tremel 2008, 3f.). Die Schwäche der staatlichen Steuerung bedeutet aber nicht, dass die Weiterbildung nur den Lernbedürfnissen und der Nachfrage in Wirtschaft und Gesellschaft folgen würde.
Ursprünge und Professionalisierungsschritte
Die Anfänge der Weiterbildung stehen unter expliziten politischen Vorzeichen. So geht die außerschulische »Erwachsenenbildung« auf die aufklärerische Initiative der politischen Arbeiterbewegung, der sozialreformerischen und konfessionellen Bewegungen im 19. Jahrhundert zurück (Furrer 2005). Ausgehend von diesen Entstehungskontexten, verläuft die weitere institutionelle Entwicklung der Erwachsenenbildung großenteils in getrennten Segmenten, was nicht nur für die Schweiz gilt (Nuissl 2011, 330f.). In den Kämpfen um soziale Gerechtigkeit, Bürgerrechte, Frauenrechte und eine Demokratisierung des politischen Systems übernimmt die Erwachsenenbildung Aufgaben der politischen Bildung für breite Bevölkerungsschichten. Substanzielle politische Mitbestimmung wird allerdings noch für längere Zeit verweigert, den Frauen sogar bis in die 1970er-Jahre.
Im 20. Jahrhundert konsolidiert sich die Erwachsenenbildung mit erweiterten Zwecksetzungen zunehmend als Domäne spezialisierter Bildungsorganisationen. Volkshochschulen, gemeinnützige Verbände, Gewerkschaften, Branchen- und Berufsorganisationen bauen ein Programmangebot auf, teils für ein breites Zielpublikum, teils speziell für Verbandsmitglieder. Zur politischen Bildung und Allgemeinbildung kommt nun auch die berufs- und arbeitsmarktbezogene Weiterbildung hinzu, also die Weiterentwicklung einmal erworbener beruflicher Grundqualifikationen (Schläfli & Sgier 2008, 15f.). »Arbeitsmarktfähigkeit« tritt damit programmatisch zunehmend an die Stelle der politischen und sozialen Emanzipation.
Erwachsenenbildnerische Tätigkeit erfährt einen Professionalisierungsschub. Für die Qualifizierung der Ausbildenden entstehen Ausbildungsgänge, zunächst in einzelnen Professionen, dann im Berufsbildungssystem. Die Erforschung der Erwachsenenbildung etabliert sich als Teildisziplin der Erziehungs- und Bildungswissenschaften in der akademischen Lehre und Forschung. Daraus entstehen Standards für die Praxis der Erwachsenenbildung, die über einzelne Segmente hinaus Geltung erhalten. Im Zuge dieser Konsolidierung wird Erwachsenen- und Weiterbildung von kommerziellen Anbietern, auch von international agierenden, als Geschäftsfeld entdeckt. Aus den unterschiedlichen Entwicklungssträngen entsteht die heutige ausgedehnte und fragmentierte Weiterbildungslandschaft aus privaten, gemeinnützigen und staatlichen Bildungsträgern (Furrer 2005).
Traditionen: Marktliberalismus, Korporatismus, schwache Regulierung
Der Weiterbildungsmarkt ist heute durch langfristig aufgebaute Anbieterstrukturen und korporatistische Interessenverbünde geprägt. Diese entsprechen dem bürgerlichen, auch in weiterbildungspolitischen Diskursen stets hochgehaltenen Idealmodell des »freien« Marktes nur sehr bedingt. Sie werden aber als »Kräfte der Selbstorganisation« und des »Marktes« positiv gewertet und liefern über Jahrzehnte die ideologische Rechtfertigung dafür, dass die politische und gesetzliche Regulierung der Weiterbildung dem Grundsatz der Subsidiarität folgt, also kaum in Erscheinung tritt. Der schweizerische Bundesstaat übernimmt bis in die 1970er-Jahre kaum Aufgaben der zentralen Koordination. Er steuert die Weiterbildung nur in den ihm vom Gesetz zugewiesenen hoheitlichen Handlungsfeldern – so in der Berufsbildung, in der Arbeitssicherheit, im Umweltschutz oder Verkehr. Im Übrigen bestehen föderalistisch abgestufte und disparat ausgelegte gesetzliche Zuständigkeiten auf den nationalen und kantonalen Ebenen (Fischer 2014, 15f.).
Doch auch die Kantone nehmen ihre regulative Tätigkeit recht spät auf, etwa mit der Schaffung kantonaler Weiterbildungsgesetze in den 1990er-Jahren. Sie gestalten ihre Rolle in der Weiterbildung überdies sehr unterschiedlich. Koordinative Aufgaben liegen in der Regel bei den Fachkommissionen und paritätischen Gremien der Wirtschaftssektoren und Berufsfelder. Konglomerate von Anbietern, Verbänden und Branchenorganisationen bestimmen insgesamt die Entwicklung der Weiterbildungsbranche.
In den 1980er-Jahren setzen auf Bundesebene breit angelegte Initiativen im Bereich der beruflichen Weiterbildung ein. Die Weiterbildung an Fachhochschulen und Eidgenössischen Technischen Hochschulen erhält gesetzliche Grundlagen. Und die »Weiterbildungsoffensive« des Bundes legt ab 1990 landesweit thematische Förderungsschwerpunkte fest, zum Beispiel die technische Weiterbildung an Fachhochschulen, die Weiterbildung von Berufsleuten, von Frauen, von Ausländerinnen und Ausländern. Seither expandiert die Weiterbildung auch in der höheren Berufsbildung und an den Hochschulen. Die Aktivitäten der Fachhochschulen geraten dabei auch in Konkurrenz zur höheren Berufsbildung.
Nach der Jahrtausendwende verstärken sich auf nationaler Ebene die Bestrebungen, die Weiterbildung bundesgesetzlich zu regeln. Im Jahr 2006 stimmt die Bevölkerung einem neuen Verfassungsartikel zu, der Weiterbildung als Aufgabenbereich des Bundes erstmals in der Verfassung verankert. Jahre später beginnen die Arbeiten am Bundesgesetz über die Weiterbildung, das die neue Weiterbildungspolitik des Bundes begründen soll. Es versteht Weiterbildung »als Teil des lebenslangen Lernens im Bildungsraum Schweiz«, so ein Kommentar des zuständigen Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI zum damaligen Gesetzesentwurf (SBFI 2013a).
Neues Weiterbildungsgesetz: Marktfreiheit plus Wirtschaftsförderung
Das neue Weiterbildungsgesetz des Bundes wird 2014 vom Parlament verabschiedet und tritt Anfang 2017 in Kraft (WeBiG 2014). Es schreibt die marktliberale Doktrin fort. Vorrangiges Ziel ist gemäß Gesetzestext (Art. 4) die Sicherstellung »günstiger« Rahmenbedingungen für Weiterbildungsanbieter und für die individuelle Weiterbildungsteilnahme. Die Verantwortung ist vor allem den Einzelnen zugewiesen, während der Beitrag der Arbeitgeber erwähnt, aber nicht eingefordert wird (Schläfli 2015). Damit ist gesetzlich festgelegt, dass wichtige Ansatzpunkte zielgerichteter Weiterbildungsförderung und Steuerung auch künftig ungenutzt bleiben sollen. Dem Staat kommen weiterhin vor allem subsidiäre Aufgaben zu »in Ergänzung zur individuellen Verantwortung und zum Angebot Privater« (WeBiG 2014, Grundsätze, Art. 5).
Zu den wenigen konkret beschriebenen Aufgaben des Bundes zählen etwa die Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener, die Nachfragefinanzierung in begrenzten Bereichen, die Weiterbildungsstatistik (Monitoring) und die Weiterbildungsforschung. Das Gesetz definiert regulative Grundsätze zu Eigenverantwortung, Qualität, Chancengleichheit und Wettbewerbsfreiheit sowie zur Anrechnung von individuellen Weiterbildungsleistungen an die formale Bildung, deren Ausgestaltung allerdings offen bleibt. Das Gesetz ist so konzipiert, dass seine Grundsätze in den bereichsspezifischen Bildungsgesetzen konkretisiert werden, beispielsweise im Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (HFKG 2011) und im Berufsbildungsgesetz (BBG 2002).
Für alle staatlichen Aktivitäten auf dem Gebiet der Weiterbildung gilt im Übrigen die Einschränkung, dass sie »den Wettbewerb nicht beeinträchtigen« dürfen, da dies die Märkte verzerren würde. Diesem Anliegen widmet der ansonsten allgemein und knapp gehaltene Gesetzestext einen eigenen Artikel (WeBiG 2014, Art. 9). Zum bescheidenen weiterbildungspolitischen Gestaltungswillen, der im Gesetz zum Ausdruck kommt, haben sich Verbände der Erwachsenenbildung und Gewerkschaften bereits in der Entwurfsphase kritisch geäußert (z. B. SVEB 2012a; Polito 2012). Offensichtlich konnten sich im Gesetzgebungsprozess jedoch Interessenorganisationen der privaten Bildungsanbieter (z. B. der Verband edu-suisse, edu-suisse 2012), unterstützt durch Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parlamentsmehrheit, gegen wirkungsvollere Regulierungen und zukunftsorientierte staatliche Finanzengagements erfolgreich durchsetzen. So, dass mit dem Weiterbildungsgesetz nun auch ein Wirtschaftsförderungsgesetz für die Weiterbildungsbranche vorliegt.
Die Tatsache, dass in der Schweiz ein aktives marktordnendes und qualitätssicherndes staatliches Engagement fehlt, bedeutet aber nicht, dass die Gesamtentwicklung der berufsorientierten Weiterbildung dem »freien Spiel« der Märkte überlassen wäre. In der Art und Weise, wie das Weiterbildungssystem auf Qualifizierungsbedarfe von Wirtschaft und Arbeitsmärkten antwortet, sind durchaus strukturierende Kräfte erkennbar. Angebot und Entwicklungsdynamik werden von den bestehenden Strukturen der Bildungsbranche bestimmt, insbesondere von großen Anbietergruppen und korporativen Interessenverbünden. Diese verfolgen nicht nur weiterbildungsspezifische Zielsetzungen. Sie konkurrieren um Themenführerschaft und Alleinstellung im Geschäftsfeld, um Marktanteile und Nachfragevolumen, um staatliche Anerkennung und Förderbeiträge, um Qualitätszertifikate oder Rankingpositionen. In ihren kompetitiven Zielsystemen stehen die Kohärenz, die Transparenz und Anschlussfähigkeit der Bildungswege nicht zwangsläufig an erster Stelle. Dennoch festigen Weiterbildungsdiskurse bis heute den Glauben, das bestehende Weiterbildungssystem schaffe hohen Gebrauchswert für die Gesellschaft – überprüfen lässt sich das nur schwer, da klare weiterbildungspolitische Zielsetzungen und aussagekräftige Datengrundlagen fehlen.
Indem das Weiterbildungsgesetz die Vorstellungswelt der Märkte und der freien Marktteilnahme bedient, entbindet es die Akteure von der Notwendigkeit, weiterbildungspolitische Grundsatzfragen überhaupt zu debattieren, denn dies wäre in der Marktlogik ein politischer Übergriff. Die Nachfrage figuriert im Gesetz als freie Marktteilnehmerin, und der Blick auf real vermachtete Märkte und Monopole, auf die Machtposition von Anbietergruppen bleibt verstellt. Diese berufen sich in ihrer Angebotspolitik denn auch gerne auf das »Marktbedürfnis« und legitimieren so ihre Verkaufsstrategie.[5]
Unsere kritische Einschätzung der politischen und kommerziellen Struktur der berufsorientierten Weiterbildung bezieht sich hier auf das Gesamtsystem und gilt nicht für alle Teilbereiche gleichermaßen. In vielen Berufs- und Bildungssegmenten gelten heute einheitliche Standards, koordinieren die Anbieter ihr Angebot und hat sich die Kohärenz in den letzten Jahren verbessert. Dies gilt für Teile der höheren Berufsbildung, der Hochschulweiterbildung und der Weiterbildung für öffentliche Funktionen (z. B. in der Gesundheit oder der Betreuung). Für den Anbieter stehen in der Regel die bildungsinhaltlichen Anliegen im Zentrum, während wirtschaftliche und marktbezogene Ziele ebenfalls erfüllt werden müssen. Im Gesamtsystem jedoch haben sich die Gewichte verlagert. Wirtschaftliche und marktbezogene Ziele haben eine gesetzlich bestätigte Vorrangstellung. In vielen privatwirtschaftlichen und öffentlich regulierten Bereichen der Weiterbildung diktieren Strategien der Angebotsexpansion und Produktedifferenzierung den Rhythmus, unterbrochen durch Innovation und Strukturbereinigung. Das unstete Geschäft konditioniert dadurch die Nachfrage nach Weiterbildung, wie Kapitel 3.1 zeigen wird.
Fazit: Geschäftige Weiterbildungsbranche, konzeptlose Politik
Die aktuelle Weiterbildungslandschaft in der Schweiz hinterlässt den Eindruck hoher Geschäftigkeit bei mangelnder Bereitschaft zu politischer Konzeption und transparenter Regulierung von Weiterbildung. Es fehlen nicht nur regulative Bestimmungen, sondern auch weiterbildungspolitische Orientierungskriterien. Während in den Anbieterorganisationen der Weiterbildung – genauso wie im gesamten Bildungssystem (vgl. Kapitel 1.3) – Strategien forcierten Marketings und betriebswirtschaftliche Steuerungsmechanismen sich weitgehend durchsetzen, gibt es kaum konsensuale Vorstellungen darüber, wie denn in der bestehenden Bildungsordnung kontinuierliches Lernen und kohärente Bildungswege zu gewährleisten wären. Immerhin sah selbst die zuständige schweizerische Bundesbehörde, das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), starken Verbesserungsbedarf bei der Transparenz am Weiterbildungsmarkt, bei der Qualität der Angebote, bei der Durchlässigkeit und bei den Schnittstellen zur formalen Bildung (SBFI 2013b).