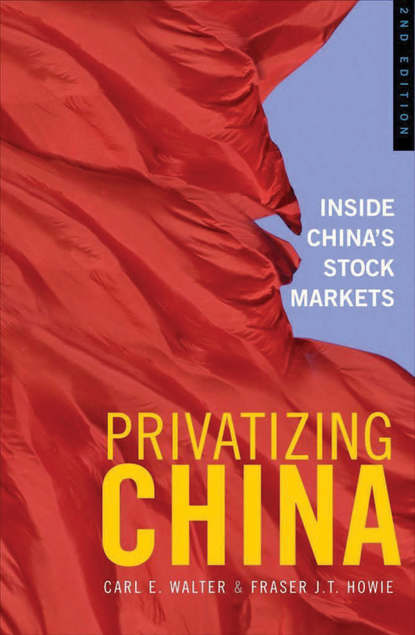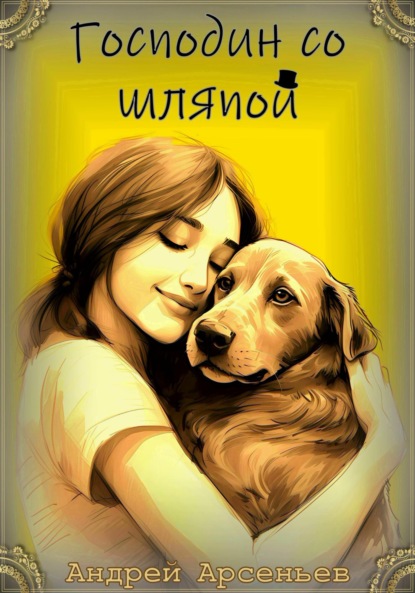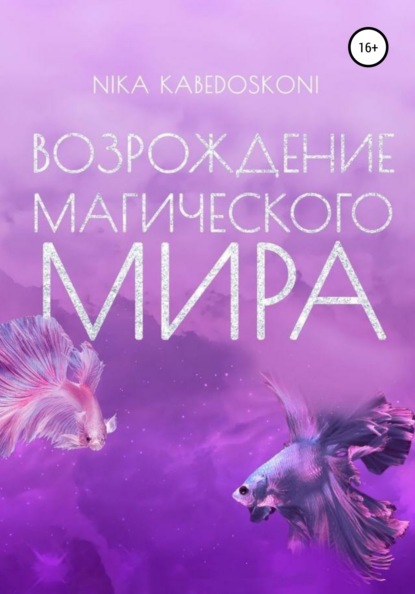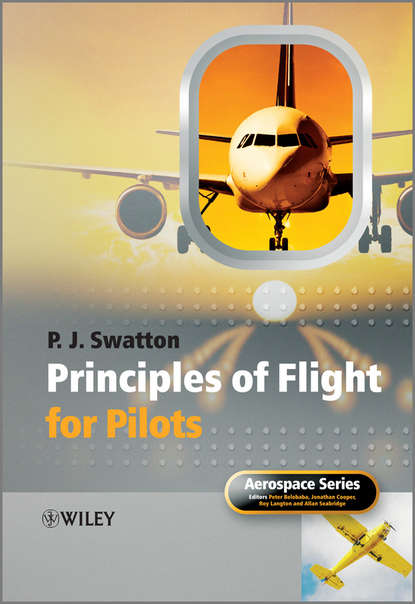- -
- 100%
- +
Ob mit dem neuen, weiterhin der marktliberalen Orthodoxie verpflichteten Weiterbildungsgesetz das von der Fachbehörde formulierte, anspruchsvolle Ziel eines »kohärenten Bildungsraums Schweiz« künftig erreicht werden kann, erscheint aber fraglich.
2.2 Strukturen und Trends in der Weiterbildungsbranche
Zum Gegenstand dieser Studie, der »berufsorientierten Weiterbildung«, zählen Angebote und Programme, die der formalen schulischen und beruflichen Grundausbildung nachgelagert sind oder diese ergänzen. Es handelt sich um Angebote der nichtformalen Bildung, wie sie im Rahmen der internationalen Systematik der Formen lebenslangen Lernens von der Unesco und der OECD definiert wurde (BFS 2013, 3; Zeuner 2011, 586f.). Die höhere Berufsbildung und die Hochschulweiterbildung weichen zwar von dieser Kategorisierung insofern ab, als die betreffenden Abschlüsse in der Schweiz dem formalen Bildungssystem zugerechnet werden (Fischer 2014, 23). Diese Zuordnung gilt allerdings nur sektorspezifisch, es gibt keine generelle Anerkennung von Weiterbildung in der formalen Bildung. Die Ausbildungsgänge, die auf die Abschlüsse der höheren Berufsbildung hinführen, werden als »Vorbereitungskurse« bezeichnet (SKBF 2014, 266f.), obwohl sie formell geregelt sind und staatliche Bewilligungsverfahren durchlaufen müssen. In Ermangelung einer konsistenteren Systematik wird die berufsorientierte Weiterbildung in dieser Publikation generell der Kategorie der nichtformalen Bildung zugeordnet. Die Begriffe Weiterbildung und Erwachsenenbildung werden synonym verwendet.[6]
Welches sind die wichtigsten Angebotssegmente und Geschäftsfelder der berufsorientierten Weiterbildung, und wie sind Marktvolumen und Entwicklungstrends der Weiterbildungsbranche einzuschätzen?
Gliederung des Weiterbildungsangebots
In der Fachdiskussion gibt es mehrere Ansätze, das sehr heterogene Feld der Weiterbildung zu strukturieren. In Anlehnung an die Kategorisierungen bei Weber und Tremel (2008, 10f.) unterscheiden wir in dieser Publikation fünf Angebotssegmente der berufsorientierten Weiterbildung, jeweils einschließlich der Bereiche Beratung und Begleitung (Abb. 2.1).
Zwischen diesen Angebotssegmenten bestehen markante Unterschiede hinsichtlich der formellen Anerkennung, der Finanzierung und der regulativen Bestimmungen. Die Unterscheidung zwischen öffentlich-rechtlich und privatwirtschaftlich geregelten Märkten ist dabei von sekundärer Bedeutung. Anbieter und Träger von Weiterbildung können sein:
–staatliche Anbieter, z. B. Schulen, Volkshochschulen, Berufsfachschulen, höhere Fachschulen, Hochschulen, Beratungseinrichtungen;
–korporative Anbieter, z. B. Schulen, Akademien, Kursanbieter, Bildungs- und Beratungsstellen von Verbänden, Gewerkschaften, gemeinnützigen Trägern;
–private Anbieter, z. B. Schulen, Fachschulen, Hochschulen; Kursanbieter und Beratungsstellen; betriebliche Weiterbildung und Personalentwicklung.
Viele Anbieter sind in mehreren Segmenten tätig. Einige bieten beispielsweise Vorbereitungskurse für Abschlüsse der höheren Berufsbildung (im Segment 1) und allgemeine Weiterbildungskurse (im Segment 3) an. Die Angebote decken ein breites Spektrum von Organisationsformen ab, mit unterschiedlichen Gewichten selbst- und fremdgesteuerten Lernens; gelernt wird einzeln oder in Gruppen an Präsenzveranstaltungen und in virtuellen Netzwerken. Das Angebotssortiment erstreckt sich vom Standardkurs bis zum prozessbegleitenden Training und zum Einzelcoaching im Praxisfeld.
Abb. 2.1: Angebotssegmente der berufsorientierten Weiterbildung
1. Höhere Berufsbildung (mit Abschluss)Kurse zur Vorbereitung auf Berufsprüfungen und höhere Fachprüfungen; Weiterbildungs- und Nachdiplomstudiengänge (Tertiärstufe B)Weiterbildungs- und Laufbahnberatung für die höhere Berufsbildung2. Hochschulweiterbildung (mit Abschluss)Certificate, Diploma und Master of Advanced Studies (inkl. vormalige Nachdiplomstudiengänge) an Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen (Tertiärstufe A)Weiterbildungs- und Laufbahnberatung für die Hochschulstufe3. Allgemeine berufsorientierte Weiterbildung (mit oder ohne Zertifikat)Fachliche, funktions- und laufbahnunterstützende Kurse, Seminare, Coachings; Angebote der betrieblichen Weiterbildung und Personalentwicklungallgemeine Weiterbildungs- und Laufbahnberatung4. Arbeitsmarktbezogene WeiterbildungKurse, Trainings, Integrationsprogramme im Auftrag der Arbeitsmarkt-, Berufsbildungs-, MigrationsbehördenWeiterbildungsberatung zur Erhaltung von »Arbeitsmarktfähigkeit«5. Weiterbildung für öffentliche FunktionenKursprogramme, Seminare, Trainings in den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz, Sicherheit, Migration, Betäubungsmittel usw.Weiterbildungsberatung in diesen ThemenIm Zentrum der Ausführungen dieser Studie stehen als gewichtige Angebotsbereiche die berufsorientierte Weiterbildung mit Abschluss (Segmente 1 und 2) und die allgemeine berufsorientierte Weiterbildung (Segment 3). Die Ausführungen lassen sich unter Beachtung der Spezifika auch auf die anderen Segmente anwenden.
Marktvolumen und Trendeinschätzungen der Branche
Es ist nicht einfach, einen Überblick über die quantitative Entwicklung des Weiterbildungsgeschäfts in der Schweiz zu gewinnen. Während zum Weiterbildungsverhalten der Einzelnen und zur betrieblichen Weiterbildung die Weiterbildungsstatistik des Bundes seit vielen Jahren regelmäßig Daten erhebt (Schweizerische Arbeitskräfteerhebung SAKE, seit 2011 Mikrozensus Aus- und Weiterbildung), gibt es zum Weiterbildungsangebot und -markt keine standardisierten, periodisch aktualisierten branchenweiten Datengrundlagen. Dies hängt unter anderem mit der starken Aufsplitterung in (unterschiedlich geregelte) allgemein zugängliche, korporative und organisationsinterne Teilmärkte der Weiterbildung zusammen (SKBF 2014, 270). Man behilft sich mit punktuellen Primärerhebungen, z. B. mit Anbieterbefragungen und Branchenstudien zu Teilmärkten, deren Resultate aggregiert und hochgerechnet werden; oder mit der Sekundärauswertung ausgewählter Indikatoren der Weiterbildungsstatistik, von denen auf Anbieterstrukturen geschlossen wird. Seit einigen Jahren erhebt der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB) Stichproben von Weiterbildungsanbietern zu wechselnden Schwerpunktthemen.
Marktvolumen und Umsätze sind über die letzten Jahrzehnte in den meisten Angebotssegmenten der Weiterbildung markant gewachsen. Eine Hochrechnung, basierend auf der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) und zusätzlichen Erhebungen bei rund 500 Weiterbildungsanbietern, schätzt das Marktvolumen der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung in der Schweiz für 2007 auf 5,3 Milliarden Franken pro Jahr (Messer & Wolter 2009). 50 Prozent dieser Ausgaben werden von den Nachfragenden selbst finanziert, die andere Hälfte wird von staatlichen Institutionen, Arbeitgebern und anderen Akteuren bezahlt.[7] Rund 60 Prozent des Marktvolumens der gesamten Weiterbildung sind der berufsorientierten Weiterbildung zuzuordnen, bei den restlichen 40 Prozent ist die Zuordnung nicht eindeutig (Sprachkurse z. B. können für berufliche oder private Zwecke absolviert werden). Die Anteile der Angebotssegmente am Marktvolumen können wegen unzureichender Datengrundlagen und definitorischer Abgrenzungsprobleme nur grob geschätzt werden. So liegt etwa der Anteil der Hochschulweiterbildung am gesamten Marktvolumen der Weiterbildung bei rund 6 Prozent (Fischer 2014, 31).
Die berufsorientierte Weiterbildung ist in der Schweiz seit jeher von privaten Anbietern dominiert (SKBF 2014, 270; Fischer 2014, 15). Gemäß Weiterbildungsstatistik des Bundes (BFS 2011) entfällt das Gesamtvolumen der angebotenen Weiterbildungsstunden zu 88 Prozent auf private und korporative Anbieter (Kursinstitute, Privatschulen, Berufs- und Branchenverbände, Unternehmen, Institutionen) und bloß zu 12 Prozent auf öffentliche Anbieter wie Hochschulen, höhere Fachschulen und Berufsschulen. Bei den privaten und korporativen Anbietern besteht eine große Vielfalt an Betrieben, die vom Kleinstanbieter – der selbstständigen Trainerin – über das Kursinstitut bis zum großen Bildungsunternehmen mit stark diversifiziertem Angebot reicht. Große Anbieter dominieren einzelne Segmente des Weiterbildungsmarktes, etwa jenes der höheren Berufsbildung, während sich kleine Anbieter vor allem in Nischen mit besonderen Qualitätsansprüchen, fachlichen Monopolen und individualisiertem Lernangebot halten können.
Im Segment der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung und der Weiterbildung für öffentliche Funktionen hat sich die Zahl der spezialisierten privaten Anbieter im letzten Jahrzehnt besonders stark ausgeweitet. Zugleich wurden die Finanzierungsmechanismen der öffentlichen Hand neu ausgerichtet: Kursangebote werden nicht mehr aufgrund eines Anerkennungsverfahrens subventioniert; vielmehr schreiben die zuständigen Behörden Weiterbildungsaufträge aus (Submission) und teilen die Mittel aufgrund von Bewerbungsverfahren zu. Dies hat die Konkurrenz im Segment verschärft und die Planungssicherheit für Anbieter, vor allem aber die Beschäftigungssicherheit für das Fachpersonal markant reduziert.
Zunehmend haben international agierende Bildungsunternehmen im lokalen Weiterbildungsgeschäft Fuß gefasst. Seit der Einführung des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) im Jahr 1995 forciert die marktliberale Politik die Öffnung der nationalen Bildungsmärkte. Sie ist im deutschsprachigen Raum weniger weit vorangeschritten als etwa im angelsächsischen. Die Forderung nach grenzüberschreitender Marktliberalisierung beruft sich auf noch unausgeschöpfte Marktpotenziale: auf die zunehmende Mobilität der Studierenden und Arbeitskräfte, die Bildungsdienstleistungen auch im Ausland beziehen; und auf die erweiterten Möglichkeiten, mit elektronischen Medien und Netzwerken räumlich und zeitlich ungebundenes Lernen zu unterstützen (Fernstudium, webbasiertes Lernen, mobiles Lernen). Mit den lerntechnologischen Innovationen haben auch internationale Anbieter wie Fachverlage, Webdienstleister oder Entwickler von Lernplattformen, also branchenfremde Unternehmen, den Einstieg ins Weiterbildungsgeschäft gefunden. Es verschärft sich damit die Konkurrenz nicht nur in den Kerntätigkeiten der Weiterbildung, sondern auch in den begleitenden Dienstleistungen (Weber 2008, 68f.).
Genaueren Aufschluss über Anbieterstrukturen und Trends in der Weiterbildung geben die Anbieterbefragungen des Schweizerischen Verbands für Weiterbildung (z. B. SVEB 2012b). Sie basieren auf quantitativen Angaben und Trendeinschätzungen der Anbieter. An der Erhebung im Jahre 2011 haben 207 Weiterbildungsanbieter teilgenommen, wobei die großen Anbieter überproportional vertreten waren. 70 Prozent der Anbieter haben eine private, 25 Prozent eine öffentliche und 5 Prozent eine gemischte Trägerschaft. Die Stichprobe deckt nach Aussage des SVEB rund ein Drittel aller Kursangebote und ein Drittel der Teilnehmenden der Weiterbildungsbranche ab. Das traditionell geringe Engagement des schweizerischen Bundesstaats in der Weiterbildung spiegelt sich im Befund, dass 80 Prozent der befragten Anbieter ihre Angebote ganz oder teilweise aus Teilnahmegebühren finanzieren (bei den privaten Anbietern sind es sogar 88 Prozent); rund 40 Prozent können zusätzlich mit Arbeitgeberbeiträgen rechnen. Nur 47 Prozent der privaten gegenüber 62 Prozent der öffentlichen Anbieter können – in sehr unterschiedlichem Ausmaß – mit Beiträgen der öffentlichen Hand rechnen (a.a.O., 27).[8]
Die weitere Marktentwicklung wird von öffentlichen und privaten Anbietern unterschiedlich eingeschätzt, wie die SVEB-Anbieterbefragung zeigt: Private Anbieter sehen sich im Wettbewerb gegenüber den öffentlichen klar benachteiligt (a.a.O., 12); sie sprechen sich umso deutlicher für die Offenlegung aller Finanzflüsse und die generelle Durchsetzung des Prinzips der Kostendeckung in der Weiterbildung aus (a.a.O., 21). Tendenziell einig sind sich Öffentliche und Private in der Frage, welche regulativen Maßnahmen die Transparenz am Weiterbildungsmarkt verbessern könnten: Qualitätssicherung durch Labels, staatliche Regelung und Normierung der Weiterbildungsabschlüsse, ein nationaler Qualifikationsrahmen und zentral koordinierte Angebotsübersichten erhalten durchweg hohe Zustimmung. Ein aktiveres staatliches Engagement, etwa in der Form von gesetzlichen Vorschriften oder behördlichem Monitoring, erhält dagegen wenig Zustimmung (a.a.O., 9). Entsprechend findet auch die Aussage, die Bildungspolitik solle den Weiterbildungsmarkt stärker regeln, durchgängig eine unterdurchschnittliche Zustimmung (a.a.O., 15).
Bemerkenswert ist die erwähnte hohe Zustimmung zur staatlichen Regelung der Weiterbildungsabschlüsse. Drei Viertel der befragten Anbieter sind der Ansicht, dass Weiterbildung ohne staatlich anerkannten Abschluss an Bedeutung verlieren werde (a.a.O., 18). Der Bericht des SVEB fordert daher, dass absolvierte Weiterbildungen künftig als Teilqualifizierung anerkannt und »in das formale System einbezogen werden« (a.a.O., 2). Wie dies angesichts der heterogenen und dynamischen Entwicklung neuer Angebote zu bewerkstelligen ist, ohne den Weiterbildungsmarkt und seine Angebote stärker zu koordinieren, wäre zu klären. Die meisten Anbieter möchten die Regulierung des (intransparenten) Marktes darauf beschränken, dass der Staat wettbewerbsförderliche Rahmenbedingungen sicherstellt, und wenden sich gegen ein aktives Engagement des Staates. Ihre Doktrin hat sich im neuen Weiterbildungsgesetz nahezu vollständig durchgesetzt (vgl. Kapitel 2.1), dies, obwohl das bisher schon vorherrschende Modell Steuerungsdefizite und Fehlfunktionen offensichtlich nicht verhindert. Die Chance, dass die Weiterbildung dereinst kohärente Antworten auf den Strukturwandel der Arbeitswelt liefert, wird dadurch nicht besser.
2.3 Dynamik der Angebotsentwicklung
Der wirtschaftliche und soziale Strukturwandel erzeugt Weiterbildungsbedarf in den Berufsfeldern und Organisationen, und er lässt neue Weiterbildungsbedürfnisse bei den Erwerbstätigen entstehen.
Die Weiterbildungsbranche definiert dazu passende Kompetenzziele und stellt Curricula und Qualifikationsverfahren bereit, die den Bedarf decken und für Erwerbstätige und Gesellschaft eine existenzielle Aufgabe erfüllen. So jedenfalls versteht die Weiterbildung seit jeher ihre Funktion, wie die Analyse ihrer einschlägigen Diskurse zeigt (Rosenberg 2015, 134). Die Weiterbildung begründet dies mit der in den 1970er-Jahren entstandenen Einsicht, wonach die in der Jugend erworbene formale Bildung den neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen nicht mehr genüge und aktualisiert werden müsse.
Pfadabhängigkeit, Expansion und Ausdifferenzierung
Das aktuelle Weiterbildungsangebot ist jedoch nicht als direkte Antwort auf manifeste Bedarfe und Bedürfnisse zu verstehen, es ist eine systembedingte Antwort auf den Strukturwandel. »Systembedingt« heißt: Bei der Entwicklung neuer Weiterbildungsangebote wirken jeweils etablierte Angebotsstrukturen und Leistungskapazitäten der Branche, Marktdynamiken, politische Vorgaben und Finanzierungsmechanismen mit. Die Vorstellung, das Angebot resultiere aus einer einfachen Bedarfsfeststellung und der daraus folgenden Planung von Weiterbildung, ist unangemessen, denn die Voraussetzungen solcher Steuerung fehlen. Das Weiterbildungssystem ist kontextbestimmt und pfadabhängig, d. h., seine weitere Entwicklung vollzieht sich in Abhängigkeit von bereits aufgebauten Binnenstrukturen. Es entzieht sich daher einer simplen Funktionsbestimmung.
Hinzu kommen starke eigendynamische Momente der Expansion und Ausdifferenzierung des Angebots (der Formen und Inhalte) und der institutionellen Strukturen. Treiber dieser Entwicklung sind die Deregulierung der (internationalisierten) Weiterbildungsmärkte, die technische Diversifizierung von Lerndienstleistungen und die dadurch verschärfte Konkurrenz der Anbieter. Mit der Vielfalt der Anbieter und Geschäftsfelder steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Diskrepanzen unter den Segmenten des Weiterbildungssystems sowie zwischen diesem und dem Beschäftigungssystem kommt (Heintz 1971, 2). Denn etablierte Institutionen verfolgen eigene Bestandsinteressen: Sie beanspruchen formelle Anerkennung, Marktanteile, Erträge und Subventionen und rechtfertigen dies mithilfe von Konstrukten (»Ideologien«, a.a.O., 4), welche die Nützlichkeit des Angebots für Wirtschaft und Berufe hervorheben und das institutionelle Eigeninteresse in den Hintergrund treten lassen. So erhalten vereinfachende Deutungen der Weiterbildungsfunktion gerade in Phasen des Wachstums und der Ausdifferenzierung der Branche neuen Auftrieb.
Was die inhaltliche Ausrichtung des expandierenden Angebots der berufsorientierten Weiterbildung betrifft, so fällt es angesichts der heterogenen Marktstrukturen und Institutionen schwer, allgemeine Aussagen zu treffen oder gar Gesetzmäßigkeiten auszumachen. Dies gilt auch für andere Länder (Tippelt 2011, 454). Dennoch gibt es typische Entwicklungsmuster in Angebotssegmenten. So stellen wir erstens einen engen Bezug zu beruflichen Funktionen in der berufsorientierten Weiterbildung mit Abschluss fest; und zweitens eine große Vielfalt, teilweise gar Beliebigkeit der Themen in der allgemeinen berufsorientierten Weiterbildung.
Funktionsbezug der berufsorientierten Weiterbildung mit Abschluss
Die Angebotsprogramme der berufsorientierten Weiterbildung mit Abschluss sind in den letzten Jahrzehnten ausgebaut und zugleich feiner gegliedert und gestuft worden (Weber 2013, 28f.). Diese Entwicklung hat in der höheren Berufsbildung und in der Hochschulweiterbildung stattgefunden, hier am stärksten bei den Fachhochschulen und etwas weniger ausgeprägt bei Universitäten (Fischer 2014, 31f.). Treibende Kräfte dieser Entwicklung waren und sind Veränderungen in den beruflichen Tätigkeitsfeldern, die bessere vertikale Durchlässigkeit im beruflichen Bildungssystem, ebenso die Interessen seiner Akteure. Für fast jedes zusammenhängende Aufgabenbündel und jede Qualifikationsstufe, die in beruflichen und betrieblichen Funktionen identifiziert sind, werden neue Curricula und Qualifikationsverfahren entwickelt, sofern sich dafür Anzeichen einer Nachfrage finden lassen – selbst wenn davon auszugehen ist, dass sie unter Umständen bei einer nächsten Veränderung infrage gestellt werden.[9]
So entsteht ein enger Bezug der Ausbildungsgänge zu beruflichen und/oder betrieblichen Funktionen, obschon die Ausbildung eigentlich auf allgemeine Abschlüsse mit breiten Anwendungsmöglichkeiten hinführen sollte. Der Funktionsbezug der Curricula kommt zum einen dadurch zustande, dass die Unternehmen immer spezifischere, in ihren Branchen und Geschäftsfeldern direkt verwertbare Qualifikationsbündel nachfragen. Zum anderen bringt er die Standesinteressen von Berufs- und Branchenorganisationen und die wirtschaftlichen Interessen der Weiterbildungsanbieter zum Ausdruck. Letztere setzen neue Qualifikationsprofile rasch in marktgängige Produkte um und stellen damit deren »Markttauglichkeit« auch gegenüber Bewilligungs- und Akkreditierungsinstanzen unter Beweis. Wie jedoch Kompetenzen zu polyvalenteren, im Strukturwandel beständigen und entwicklungsfähigen Profilen zusammenzufügen wären und wie neben den fachlichen auch allgemeine kulturelle und politische Fertigkeiten besser integriert werden könnten – solche Fragen werden höchstens in größeren zeitlichen Abständen aufgeworfen; etwa bei Reformen im Berufsbildungssystem.
Volatilität der allgemeinen berufsorientierten Weiterbildung
Gewissermaßen als Korrektiv zum engen Funktionsbezug der berufsorientierten Weiterbildung mit Abschluss hat die allgemeine berufsorientierte Weiterbildung in Themenbereichen wie Arbeitsmethoden, Kommunikation, Management, Führung und Persönlichkeit ebenfalls eine starke Ausweitung und Differenzierung erfahren. Denn im marktgesteuerten, flexiblen Arbeitsverhältnis soll die Arbeitskraft – wie in Kapitel 1.1 beschrieben – nicht nur innerhalb der ihr zugewiesenen beruflichen und betrieblichen Funktionsgrenzen kompetent handeln, sondern im gesamten Geschäftsprozess Verantwortung übernehmen. Sie soll zum Beispiel in wechselnden Teams mitwirken, Aufträge von Anfang bis Ende selbstständig bearbeiten, mit Kunden kommunizieren. Das kommerzielle Weiterbildungsgeschäft reagiert situativ auf Themen und Problemstellungen, die einzelne oder institutionelle Kundinnen und Kunden beschäftigen. Es reagiert außerdem auf die Profilierungsbedürfnisse und Nöte der »Arbeitskraftunternehmerinnen und -unternehmer«, indem es in seinen Angeboten Modethemen anspricht, also z. B. den persönlichen Auftritt, das angemessene Outfit oder Fähigkeiten des Selbstmarketings und der psychischen »Resilienz« (Widerstandskraft).
Das allgemeine Weiterbildungsangebot ist daher im Unterschied zu jenem der höheren Berufsbildung und der Hochschulweiterbildung durch eine ausgeprägte Vielfalt und Flüchtigkeit der Formen und Themen gekennzeichnet. Es nimmt Bezug auf wechselnde Themen der betrieblichen Führung und Organisation, aber genauso des individuellen Lebensentwurfs und der Konsumsphäre. Die Differenzierung nach Themen, Konsumstilen, Preisniveaus, Zielgruppen oder Vorwissen der Teilnehmenden ist nahezu unbegrenzt. Seine Rechtfertigung sucht das flüchtige Angebot nicht unbedingt im Weiterbildungsbedarf etablierter Rollen und Niveaus des Berufssystems, sondern in Trends und Herausforderungen, die oft erst in Umrissen erkennbar sind.
Fazit: Heterogene Angebotsstrukturen, schwierige Orientierung
Der Weiterbildungsmarkt zeigt eine expansive und sich ausdifferenzierende Entwicklung, deren Dynamik durch das Angebotssegment geprägt ist. Während der wirtschaftliche Strukturwandel in den Berufen und Beschäftigungsbereichen unablässig neue Qualifikationsanforderungen und Bedürfnisse entstehen lässt, reagieren die Segmente darauf mit Angeboten, die ihrem bisher verfolgten Entwicklungspfad entsprechen. Die berufsorientierte Weiterbildung mit Abschluss befähigt Teilnehmende, berufliche Rollen und betriebliche Funktionen zu übernehmen; ihr Angebot fügt sich in gewachsene Qualifikationssysteme ein und ist an typische »Abnehmer« – Berufsfelder, Wirtschaftsbranchen, Unternehmenstypen – adressiert. Die allgemeine berufsorientierte Weiterbildung reagiert auf Trends der Arbeits- wie der Konsumwelt mit einem stärker situativen Angebot, das von aktuellen beruflichen, betrieblichen oder individuellen Bedürfnissen bestimmt ist. Dieses Angebot ist flüchtig und lässt in der Regel weder weiterführende Bildungsziele noch anschlussfähige Bildungswege erkennen, zielt aber auch nicht unbedingt auf solche Kohärenz.
Das Gesamtsystem der berufsorientierten Weiterbildung zeigt somit eigendynamische, heterogene und sprunghafte Entwicklungen. Es entzieht sich einfachen Funktionsbestimmungen und bietet keine klare Orientierung. Erschwerend kommt hinzu, dass die Fachdiskussion zur Aus- und Weiterbildung in den letzten Jahrzehnten Kernbegriffe des Lernens neu definiert hat. Diese beziehen sich nicht mehr auf den Wissenserwerb in klar abgrenzbaren bildungsbiografischen Phasen, sondern auf die ganze Lebensgeschichte und den Erwerb von Kompetenzen in vielfältigen Lernkontexten. Die Begriffe erfassen die gesellschaftliche Realität der Bildung besser, verlieren aber an definitorischer Schärfe. Dies schlägt sich in weiteren Differenzierungen am Angebotsmarkt nieder – und macht es für die Nachfrage, das heißt für Teilnehmende und Abnehmer der Weiterbildung, eher noch schwieriger, sich zurechtzufinden.
Genauso stellt sich aber die Frage nach der Orientierungsfähigkeit der Anbieter von Weiterbildung: Wie kann es ihnen gelingen, in dem Marktumfeld, dessen Dynamik sie selber vorantreiben, sich zu orientieren und mit ihren Angeboten Verantwortung zu übernehmen für sinnhaftes, aufbauendes Lernen? Und inwieweit ist das gesamte System der berufsorientierten Weiterbildung heute in der Lage, Anforderungen und Bedarfe der Gesellschaft richtig zu erkennen, ein kohärentes und nachvollziehbares Angebot bereitzustellen und das Lernen breitester Zielgruppen aller Qualifikationsstufen wirksam zu unterstützen?