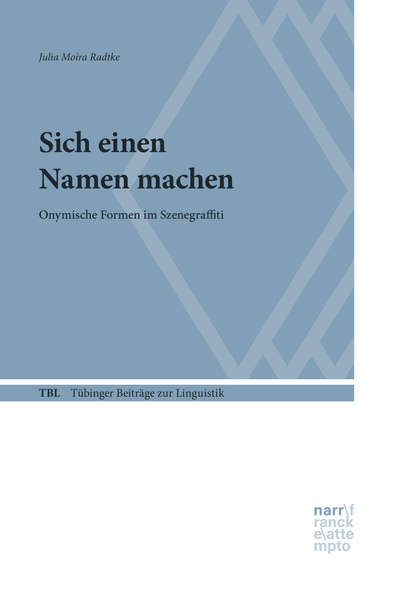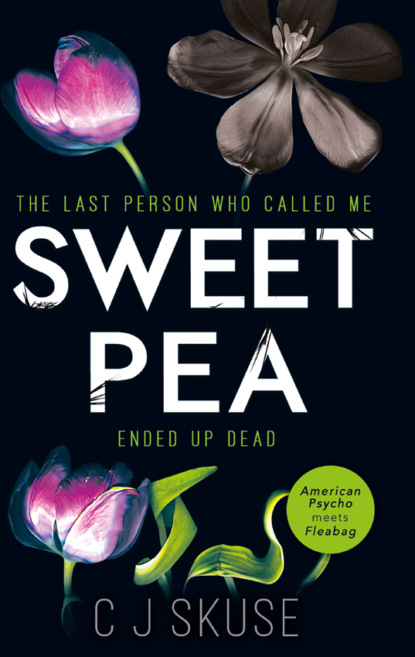Das Verständnis von Vulgärlatein in der Frühen Neuzeit vor dem Hintergrund der questione della lingua
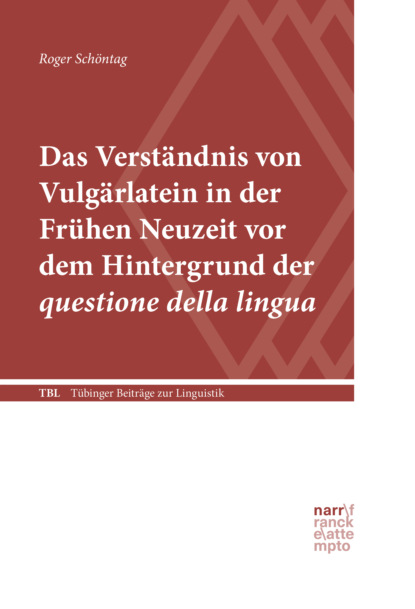
- -
- 100%
- +
Wichtig erscheint im Folgenden noch einmal zu betonen, daß die Situation, in der sich ein Sprecher befindet – und dies soll bei obigem Modell deutlich werden – nicht nur die Wahl des Stilregisters, also die diaphasische Ebene determiniert, sondern im gleichen Maße die Frage bestimmt, ob ein Dialekt oder Soziolekt etc. in der nämlichen Situation adäquat ist oder eben nicht. Ändert sich die Sprechsituation insgesamt oder auch nur einzelne Komponenten dieser Situation, so wird unter Umständen wieder aufs Neue nachjustiert.
Die Anordnung der determinierenden Faktoren für die Varietätenwahl in obigem Modell ist nicht zufällig, sondern folgt der Rangfolge einer postulierten Dominanz, d.h. der wichtigste Faktor ist der der Situation (formell vs. informell, offiziell vs. privat, etc.), gefolgt vom Gesprächspartner (mit Parametern wie bekannt vs. unbekannt, Dialektsprecher vs. Standardsprecher, etc.) und dem Ort der Kommunikation (in Abgrenzung zur Situation rein regional zur verstehen). In nicht so eindeutiger Hierarchisierung stehen folgen schließlich noch die Faktoren Thema (des Gesprächs), der Sprecher selbst (individuelle Disposition) und das Kommunikationsziel. Die Faktoren sind dabei in Bezug auf ihre Prominenz in einer bestimmten Kommunikationssituation als interagierend und interdependent anzusehen.
Was nun die Erfassung des Varietätenraumes mit Hilfe des Diasystems anbelangt, so muß man wohl mit bestimmten Aporien leben. Dazu gehört zum einen die, aufgrund der in der sprachlichen Realität engen Verquickung dieser beiden Aspekte, oft unscharfe oder gar unmögliche Trennung von diaphasischer und diastratischer Dimension112 sowie die Frage, welche Bereiche unter die Diastratik fallen, da ja letztendlich fast alle sprachliche Variation an größere oder kleinere soziale Gruppen gebunden ist (schichtenspezifisches Sprechen, altersspezifisches, berufsspezifisches, etc.). Die diatopische Ebene bleibt zudem eine besondere, da es sich hierbei um historisch gewachsene (Regional-)Sprachen handelt, die einst, in Epochen vor der Herausbildung und Verbreitung einer nationalen Standardsprache, in sich geschlossene vollständige Sprachsysteme bildeten113 (mit entsprechender Variationsbreite auf allen Dia-Ebenen) und für alle Sprecher, bzw. noch lange für viele, das einzige Kommunikationsidiom darstellten. So kann auch heute noch die diatopische Ebene für manche Sprecher die Basis der mündlichen Verständigung bilden und ist situationsbedingt nicht zwingend auf gleiche Weise auszublenden bzw. abrufbar wie Varietäten der Diastratik oder der Diaphasik.
Für vorliegendes Modell wurde aus diesen Gründen neben der unstrittigen diatopischen Ebene, weiterhin die Unterscheidung von diastratischer und diaphasischer Ebene beibehalten, allerdings mit der Einschränkung, daß anstelle von ‚diastratisch‘ hier der Begriff ‚diasozial‘ bevorzugt wird.114 Dies sei damit begründet, daß aufgrund seiner etymologischen Herleitung sowie aufgrund seiner häufigen Verwendung im Kontext mit schichtenspezifischem Sprechen dieser Terminus eine zu geringe Extension suggeriert, insofern das in den modernen Gesellschaften – und nicht nur dort – dominierende gruppenspezifische Sprechen hier als sekundäres und nicht primäres Verständnis konnotiert wird. Mit ‚diasozial‘ ist demnach also ganz allgemein und neutral das an eine spezifische soziale Gruppe gebundene Sprechen gemeint – und dies kann natürlich auch ein schichtenspezifisches sein. Deshalb soll im weiteren der Begriff ‚diastratisch‘ rein auf die Varietäten in Abhängigkeit von sozialen Schichten und Klassen appliziert werden. Für das gruppenspezifische Sprechen hingegen sei in Anlehnung an die homogene griechische Prägung der anderen Begriffe ‚diakoinonisch‘ (zu griech. κοινωνία ‚Gesellschaft, Gemeinschaft‘ bzw. κοινός ‚Teilnehmer, Genosse‘) vorgeschlagen. Beide Begriffe sollen demnach Teilbereiche der diasozialen Dimensionen konstituieren. Alternativ müsste man zur Verdeutlichung von ‚diastratisch im weiteren Sinne‘ (also schichten- und gruppenspezifisch) und ‚diastratisch im engeren Sinne‘ (also nur schichtenspezifisch) sprechen, wobei dann trotzdem eine terminologische Lücke für die rein gruppensprachlichen Varietäten bliebe.
Die grundsätzliche Frage, ob es legitim ist, über das Coseriu’sche Dreier-Schema hinaus weitere dia-Dimensionen anzunehmen, sei dahingehend salomonisch beantwortet, daß dies davon abhängt, ob man weitere Varietäten identifizieren kann. Das Problem sei also auf die bereits gestellte Problematik (v. supra), wieviel Variation ist nötig, um von einer Varietät zu sprechen, verlagert. Das extreme Beispiel einer Proliferation von dia-Ebenen war das Modell von Schmidt-Radefeldt, der quasi 1:1 die metalexikographische dia-Kategorisierung (wie z.B. bei Hausmann 1979) auf die Beschreibung des Varietätenraumes übertragen hat. Wo ist hier also eine Grenze zu ziehen bzw. gibt es eine?
Das Grundkriterium ist dabei m.E. nicht die Frage nach der Anzahl der sprachlichen Varianten, die nötig sind, um eine eigenständige Varietät zu postulieren, sondern, ob es eine soziale Gruppe gibt, der eine oder mehrere Varianten klar attribuiert werden kann.
Es sei also definiert, daß man von einer Varietät sprechen kann (und nicht nur allgemein von sprachlicher Variation), wenn ein oder mehrere zusammenhängende, spezifische (markierte) Varianten eindeutig und stabil (über einer längeren Zeitraum) einer bestimmten abgrenzbaren sozialen Gruppe von Sprechern zuzuordnen sind oder eindeutig und stabil in einer bestimmten Sprechsituation zum Tragen kommen. Eine Varietät ist dabei immer als ein Teilsystem einer bestimmten Sprache zu verstehen, die durch einen mehrdimensionalen Varietätenraum konstituiert ist.115
In diesem Sinne ist es zwar nach wie vor der Normalfall, daß eine bestimmte Anzahl von spezifischen sprachlichen Varianten eine Varietät ausmacht, im äußersten Fall kann aber eben auch ein Merkmal konstitutiv sein.116 So wäre dies der Fall der r-Ausprache in den Untersuchungen Labovs (1966), wo allein durch diese Abweichung von der Norm eine soziale Gruppe identifiziert werden kann (hier diastratisch bzw. diasozial zu verstehen) oder die norditalienischen Aussprache des r-Lautes (uvular), die eine diatopische Zuordnung erlaubt. Aus diesem Grunde sind Bezeichnungen wie ‚diafrequent‘ oder ‚diaplanerisch‘ unpassend, da hier zwar auf eine bestimmte Art der Variation innerhalb einer Sprache abgehoben wird, aber die Tatsache, daß bestimmte Lexeme, die allgemein häufiger oder seltener gebraucht werden, oder eben solche, die durch bestimmte Normierungsversuche in die Sprache gelangen, nicht einer bestimmten sozialen Gruppe zugeordnet werden können.117 Auf diese Weise kann auch die Existenz einer diatechnischen, diasexuellen sowie diagenerationellen Ebene begründet werden, d.h. als Varietäten einer bestimmten sozialen Gruppe. Dabei ist zu beachten, daß alle drei Ebenen prinzipiell auch als Subebenen der diastratischen bzw. diasozialen (genauer: diakoinonischen) Ebene gesehen werden könnten. Aber gerade der Bereich der Fachsprachen nimmt sowohl in der sprachlichen Realität der heutigen Gesellschaft als auch in der sprachwissenschaftlichen Forschung einen sehr breiten Raum ein, so daß eine eigene Ebene durchaus vertretbar erscheint.118 Die beiden weiteren Ebenen (diasexuell und diagenerationell) sind hingegen womöglich nicht in jeder Sprachgemeinschaft klar abgrenzbar oder identifizierbar; sofern dies jedoch möglich ist und ausreichend Merkmale ermittelbar sind, sind sie als eigenständige Varietätenebenen etablierbar.
Schließlich soll in vorliegendem Modell auch der Erkenntnis der vorherigen beiden Kapitel zur Genese und Interaktion sozio- und varietätenlinguistischer Ansätze Rechnung getragen werden, und zwar dahingehend, daß die aus der anglistischen (variationslinguistischen) und germanistischen (soziolinguistischen) Tradition stammenden Begrifflichkeiten der Lekte konsequenter als bisher, den dia-Begrifflichkeiten gegenübergestellt werden.119
Löffler (11985, ²1994:86) entwickelt dazu ein diversifiziertes Modell, in dem er „Großbereiche des Sprechens“ (Lekte) annimt, die sich überlagern, und zwar in Form von Mediolekten (nach Medium), Funktiolekten (nach Funktion), Dialekte (nach arealer Verteilung), Soziolekten (nach sozialer Gruppe), Sexolekten/Genderlekten (nach Geschlecht), Situolekten (nach Situation/Interaktionstyp) und Idiolekten (nach Individuum). Das Modell macht zweifellos die Vielfalt der Arten des Sprechens deutlich, über die ein Individuum verfügen kann, jedoch fehlt eine gewisse Systematik.120
Auf der Ebene der Diatopik, gibt es nun neben dem traditionellen Dialekt-Begriff, der im Verständnis Coserius zunächst vor allem primäre Dialekte bezeichnet und terminologischer Ausgangspunkt aller weiteren Lekte ist, den sehr nützlichen Begriff des Regiolektes. Hiermit wird üblicherweise auf die bei Coseriu als tertiärer Dialekt bezeichnete Varietät referiert, die zwischen Standardvarietät und primärem Dialekt angesiedelt ist. Dabei ist der Begriff des Regiolektes hier sehr viel eindeutiger und transparenter als die Coseriu’sche Denomination. Was die Abgrenzung groß- vs. kleinräumig angeht, kann man entsprechend dem in der strukturellen Areallinguistik üblichen bottom-to-top-Konzept zwischen den Gradationsstufen Standardlekt – Dialekt – Regiolekt – Lokolekt unterscheiden (cf. Ebneter 1989:872).121 Mit Urbanolekt (cf. Dittmar 1997:193) wird hingegen eher eine spezifische diatopische Situation von Metropolen oder größeren städtischen Zentren beschrieben.122
Was die Ebene der Diaphasik angeht, so ist festzustellen, daß die bisherigen Begrifflichkeiten eher schwankend sind, und zwar insofern als hier von Stilregistern, Stilen, Registern oder Sprachregistern gesprochen wird, so daß mit Situolekt (cf. Dittmar 1997:206) eine gewisse Einheitlichkeit möglich wäre, zumal auch dieser Begriff relativ transparent ist.
Die inzwischen recht übliche Bezeichnung Soziolekt (cf. Dittmar 1997:189) im Bereich der diastratischen Ebene, erscheint eine recht gute Lösung, um gleichermaßen neutral sowohl gruppenspezifisches als auch schichtenspezifisches Sprechen zu umreißen.123 Hinzu kommt, daß man hier eine sehr transparente begriffliche Parallele zu diasozial ziehen kann. Das gleiche Argument wäre bezüglich des Technolekts vorzubringen, mit der Ergänzung und Präzisierung, daß hierbei nicht allein auf Sprachvariation im Bereich der Technik abgehoben wird, sondern jegliches berufs- und wissenschaftsspezifisches Sprechen miteinbezogen werden soll.
Bei dem noch neueren Feld der diagenerationellen Differenzierung sind auch die Begrifflichkeiten noch recht schwankend und zum Teil wenig etabliert. Am ehesten untersucht ist in der Regel die Jugendsprache, die beispielsweise bei Michel (2011:194) als Juventulekt bezeichnet wird; eher selten zum Tragen kommt die Sprache der älteren Generation, die mitunter als Gerontolekt (cf. Dittmar 1997:229–231) oder Gerolekt (Veith 2005:173) benannt wird. Diesbezüglich sollte man eine gewisse Konsequenz und Kohärenz in Bezug auf die Bezeichnungen einführen, weshalb hier der Vorschlag sowohl eines neutralen Hyperonyms notwendig erscheint, als auch einer homogenen griechischen Denomination. Aus diesem Grund sollte man sinnvollerweise von Helikialekten (zu griech. ʿηλικία ‚Lebensalter‘), also altersbedingten Sprachunterschieden sprechen, die man in Gerontolekte (griech. γέρων ‚alter Mann‘, ‚alt‘) und Neotolekte (zu griech. νεότης ‚Jugend‘) differenzieren könnte.124
Analog zu diesem Vorschlag wären auch die Begrifflichkeiten im Bereich der diasexuellen Ebene zu gestalten, so daß hier neben dem bereits etablierten, neutralen Sexolekt (cf. Dittmar 1997:228–229) zwischen Androlekt (zu griech. ʾανδρός ‚Mann‘) und Gynaikolekt (zu griech. γυναικός ‚Frau‘) unterschieden werden sollte.125
Unabhängig von den einzelnen Begrifflichkeiten und ihrer etymologischen Transparenz und Adäquatheit, geht es vor allem darum, mit der Koppelung des Spektrums der Lekte-Denominationen den Termini, die mit der Konzeption des Diasystems einhergehen, ein Begriffsinventar zur Seite zu stellen, das die Variation im Varietätenraum einer Sprache so präzise wie möglich zu erfassen hilft.126 Ziel ist es ja letztlich, die Architektur einer Sprache so exakt wie möglich in der gesamten Bandbreiten ihrer Heterogenität beschreiben zu können, dabei die Kategorisierung aber nur so weit zu treiben, als den einzelnen Kategorien dann auch ihnen attribuierbare sprachliche Realitäten gegenüberstehen, die – soweit möglich – klar voneinander abgrenzbar sind.
Mit vorliegendem Modell soll also versucht werden, die Gesamtheit des Varietätenraumes zu erfassen, um auf diese Weise das Verständnis für die sprachliche Realität zu schärfen. Ein Anliegen des Modells war es dabei, deutlich zu machen, daß auch bei einer Darstellung mit dem Fokus auf den Varietäten, die Sprechsituation, d.h. die konstitutiven Faktoren bei der Wahl einer Varietät mehr Raum einnehmen müßten bzw. vielmehr ohne diese zusätzliche Perspektive die Beschreibung defizitär bleibt. Dies bedeutet auch, daß sowohl dem Sprecher als auch dem Hörer sowie der sozialen Gruppe mehr Gewicht in der Betrachtung einer varietätenlinguistischen Untersuchung zukommen müßte.
Diese Überlegungen zu Sprechsituation gelten in erster Linie für zeitgenössische synchrone Kommunikationssituationen, da nur in diesen die Determiniertheit des Sprechers (und Hörers) adäquat eingeschätzt werden kann. Für eine historische Kommunikationssituation, bei der man auf rein schriftliche Dokumente angewiesen ist, fällt der erste Bereich (‚schriftlich/mündlich‘) der Selektion in obigem Modell weg. Es bleiben dennoch determinierende Faktoren bei der Sprach- und Varietätenwahl, vor allem die Diskurstraditionen, allerdings sind manche Faktoren ungleich schwerer zu ermitteln. Die vorgeschlagene Erweiterung bzw. Präzisierung des Varietätenraumes mit Rückgriff auf die verschiedenen Terminologien der dia- und der lekte-Begriffe ist hingegen prinzipiell auch in einem historischen Kontext anwendbar. In der vorliegenden Untersuchung soll daher dieses Begriffssystem auch bei der Beschreibung des Lateinischen verwendet werden (cf. Kap. 4).127 Wie ausdifferenziert dies dabei möglich ist, hängt grundsätzlich von der Dokumentationslage bezüglich der einzelnen sprachlichen Phänomene ab.
Was den metasprachlichen Diskurs des 15. und 16. Jh. anbelangt (cf. Kap. 6), so wird diese hier vorgestellte Begriffssystem nicht vollständig zum Tragen kommen können. Dies liegt vor allem darin begründet, daß die Beschreibung des antiken Lateins durch die Humanisten nicht mit gleicher Präzision geleistet werden konnte, wie das heutzutage möglich ist. Die Möglichkeiten, die von den damaligen Gelehrten beschriebenen Phänomene des antiken Lateins im Sinne einer modernen Interpretation in einer sozio- und varietätenlinguistische Terminologie darzustellen, sind daher begrenzt und nur vereinzelt wird es sich anbieten, begrifflich weiter zu differenzieren. In diesem Teil wird deshalb im Wesentlichen auf „traditionelle“ Begrifflichkeiten wie ‚diatopisch‘, ‚diastratisch‘, ‚diaphasisch‘ etc. rekurriert.
3.2 Die Rekontextualisierung: Klassische Hermeneutik und historische Verortung
Die methodische Vorgehensweise zur Analyse der frühneuzeitlichen Traktate, die sich mit der Frage nach der Art des Lateins in der Antike auseinandersetzen, soll in vorliegender Arbeit zwei Facetten umfassen (cf. Kap. 1.4). In den vorherigen Kapiteln wurde dazu das Inventar der aktuellen varietätenlinguistischen und soziolinguistischen Begrifflichkeiten vorgestellt und diskutiert, mit deren Hilfe die zu untersuchenden Texte aus einem modernen sprachwissenschaftlichen Blickwinkel heraus analysiert werden, zum Teil unter bewußter Ausblendung zeitgenössischer Implikationen der jeweiligen Epoche (cf. Kap. 3.1.1–3.1.3).
In vorliegendem Kapitel soll hingegen die zweite Perspektive näher dargelegt werden, die dazu dient, die zuvor durch die Applikation moderner Termini und Konzepte entkontextualisierten Traktate dann in ihrem geistesgeschichtlichen Zusammenhang zu rekontextualisieren. Ziel ist es also, im Rahmen einer traditionellen philologischen Analyse die literarischen, geschichtlichen und philosophischen Bezüge, die den einzelnen Texten immanent sind, in Bezug auf die hier relevante Fragestellung adäquat herauszuarbeiten. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, daß nur eine möglichst exakte Verortung eines Textes in seinem geistes- und ideengeschichtlichen Kontext die Möglichkeit eröffnet, die im vorliegenden Fall angestrebte Nachzeichnung einer sich verändernden Vorstellung über das Latein der Antike angemessen zu erfassen. Die Kontrastierung mit der modernen sprachwissenschaftlichen Perspektive dient dabei der Schärfung des Blicks auf die untersuchte Fragestellung, so daß auf diese Weise die Ursprünge und frühen Ansätze aktueller sprachgeschichtlicher Erkenntnisse besser herauspräpariert werden können.
Im Rahmen dieser zweiten Sichtweise auf die hier zu untersuchenden Traktate, in der wie eben dargelegt der Text in seinen historischen Bedeutungszusammenhang eingebettet werden soll, sind die Verfahren der Hermeneutik ein wesentlicher Bestandteil. Dabei sei Hermeneutik ganz allgemein als „Theorie und Methodik […] des Verstehens, Interpretierens und Anwendens von Texten“ (Zabka 2007:313) verstanden.
Ziel der Erkenntnis ist es, einen kohärenten Bedeutungszusammenhang des Interpretationsgegenstands zu bestimmen oder das Fehlen eines solchen Zusammenhangs kohärent zu erklären. […]
Als eine Theorie und Methodik des historischen Fremdverstehens zielt die Hermeneutik auf die Rekonstruktion jener Bedeutungen, die einem Text im Kontext seiner Entstehung zukamen. (Zabka 2007:313)
In dieser Definition des hermeneutischen Grundgedankens ist für vorliegende Zielsetzung vor allem der zweite Teil relevant, insofern das Anliegen der Untersuchung die Rekonstruktion einer geistesgeschichtlichen Entwicklung darstellt, die anhand ausgewählter frühneuzeitlicher Traktate sichtbar gemacht werden soll.
Im Folgenden seien einige Aspekte traditioneller Modelle und Konzepte der Hermeneutik, die für das hier angestrebte Vorgehen von Relevanz sind, herausgegriffen und vorgestellt.128 Der Ausgangspunkt der modernen Textanalyse- und interpretation ist der heutigen communis opinio folgend die Hermeneutik Friedrich Schleiermachers (1768–1834), die in Bezug auf die zuvor von der hermeneutica sacra und der hermeneutica profana geprägten Zweiteilung der theologischen und juristischen Perspektive einen Neuanfang markierte.129 Dabei war der Ansatz Schleiermachers insofern neu, als er das Verstehen an sich sowie die Auslegung als Dreh- und Angelpunkte eines Textverständnisses formulierte und problematisierte (cf. Geisenhanslüke 2004:44; Rusterholz 2005a:113).130
Für die hier vorzunehmende Textanalyse bedeutet dies, daß die Kunst des Verstehens darin liegt, die zur Verfügung stehenden Schriftzeugnisse hinsichtlich ihrer sprachlichen Eigenart, ihrer Zielsetzung und ihrer geistesgeschichtlichen Verankerung entsprechend einzuordnen und nur vor diesem Hintergrund vorsichtige Schlüsse über das darin ausgedrückte Denken zu ziehen bzw. die dahinterstehenden Ideen und Vorstellungswelten zu rekonstruieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt hinsichtlich des vorliegenden Anliegens findet sich in den Schriften Wilhelm Diltheys (1833–1911). Die von Dilthey entwickelte Hermeneutik basiert zunächst auf den theoretischen Ausführungen Schleiermachers, geht aber darüber hinaus. Er erweitert beispielweise die „Kunst des Verstehens“ zu einer allgemeinen Erkenntnistheorie, zu einer „methodischen Auseinandersetzung mit Gegenständen der Kultur“ (Rusterholz 2005a:119). In Bezug auf schriftliche Äußerungen, die ein Teil davon sind, präzisiert er seine Vorstellung eines methodisch angelegten Erkenntnisprozesses als „kunstmäßige[s] Verstehen von dauernd fixierten Lebensäußerungen“, welches er wiederum als „Auslegung oder Interpretation“ (Dilthey 1990:319) benannt haben möchte. Diese schriftlich fixierten Äußerungen, vornehmlich in Form von Literatur (aber nicht nur), sind Ausdruck des menschlichen Seins und Schaffens; der Zugang erfolgt dabei über die Sprache.131
Es soll nun eine letzte Anleihe bei der „klassischen“ Hermeneutik vorgenommen und diesbezüglich einige Überlegungen aus den Schriften Hans-Georg Gadamers (1900–2002) dargelegt werden. Gadamers Blick auf das Verstehen von Texten bzw. von Äußerungen im Allgemeinen ist von einem auf Martin Heidegger (1889–1976) zurückgehenden Wahrheitsanspruch geprägt, d.h. Anliegen ist es, „eine Erfahrung von Wahrheit auszumachen, die speziell in der Kunst zutage tritt“ (Geisenhanslüke 2004:54), um so die Geisteswissenschaften im Vergleich mit den Naturwissenschaften entsprechend aufzuwerten. Schlüssel für das Verstehen ist dabei wiederum die Sprache, wobei es ihm vorrangig nicht rein um das Verstehen geht, sondern um Verständigung.132 Basis ist deshalb in erster Linie die lebendige Rede, die schriftlichen Erzeugnisse müssen deshalb sozusagen erst wieder zum Sprechen gebracht werden, denn die „Urszene des Verstehens ist das Gespräch“ (Watzka 2014:213). Zentraler Punkt der Hermeneutik Gadamers ist der Aspekt der Historizität im Verstehen (cf. Gander 2011:93).133 Dabei ist hervorzuheben, daß die von ihm angesprochenen Horizonte nicht im eigentlichen Sinne verschmelzen, sondern daß es unter Berücksichtigung von Traditionsprozessen darum geht, einen Gegenwartshorizont von anderen historischen Horizonten zu isolieren. Dieser kann jedoch nicht für sich bestehen, sondern nur im Kontext der anderen bzw. aller, die es als Rezipient immer wieder neu zu bestimmen gilt (cf. Rusterholz 2005a:126).134
Aus den bisher angeführten Ausführungen Schleiermachers, Diltheys und Gadamers sind deshalb folgende hier zentrale Elemente herauszugreifen: Ausgangspunkt der Untersuchung bilden schriftliche Zeugnisse, die wiederum Gedankengänge ihrer Autoren widerspiegeln. Um nun wie für vorliegende Untersuchung erstrebt, die Vorstellungswelt einer vergangenen Zeit zu rekonstruieren, ist es nötig, bei der Untersuchung der zur Verfügung stehenden Texte die historischen Implikationen der Epoche zu berücksichtigen und bei der Interpretation und Auslegung die Schlüsselfunktion der Sprache dahingehend in Betracht zu ziehen, daß die Diskrepanz zwischen je unterschiedlich versprachlichtem Text und daraus ableitbaren Gedankengängen bzw. erschließbaren Vorstellungen und Konzepten berücksichtigt wird. Dies bedeutet letztendlich vor allem Vorsicht bei den interpretatorischen Schlußfolgerungen aus dem vorhandenen Textmaterial obwalten zu lassen und dabei alle zeitgeschichtlichen Implikationen möglichst adäquat einzubeziehen.
An diesem Punkt trifft die Hermeneutik, die nicht selten literarische Texte im Fokus hat, also Texte mit einem ästhetischen Anspruch und einer entsprechenden, dezidierten Wirkungsabsicht, auch auf die Geschichtswissenschaft, die ebenfalls an der Auslegung von Schriftzeugnissen interessiert ist.135 Historiographische Texte dienen zwar dazu, historische Ereignisse und Abläufe entsprechend der Wahrheit darzustellen (Simon 1996:277), so der grundsätzliche Anspruch, nichtsdestoweniger ist es auch möglich, diese als literarische Erzeugnisse im weiteren Sinne (d.h. Schriftzeugnisse mit spezifischen Inszenierungsstrategien und Kommunikationsabsichten) mit hermeneutischen Methoden zu beleuchten oder wie es Simon (1996:277) prägnant formuliert: „Historiographie ist Literatur, also der Literaturgeschichte und -kritik zugänglich […].“136 Die Wechselwirkung zwischen literaturwissenschaftlichen hermeneutischen Methoden und der Perspektive des Historikers besteht demnach darin, daß der zu untersuchende Text einerseits als sprachliches und damit in sensu largo literarisches Produkt zu sehen ist, und andererseits als ein geistesgeschichtliches, welches in einen entsprechenden Diskurs eingebunden ist, der wiederum den Zugang zu historischen Fakten ermöglicht (soweit objektivierbar).137
Dies ist für vorliegende Untersuchung insofern relevant, da aus den Traktaten des Korpus, die ja mit je unterschiedlichen Zielsetzungen (literaturtheoretische, historiographische, sprachtheoretische, etc.) konzipiert wurden und keine literarischen Produkte im engsten Sinne sind, der jeweilige Kenntnisstand in der Debatte um das antike Latein herausgelesen werden soll, d.h. als historische Fakten eines Diskurses zu rekonstruieren ist.