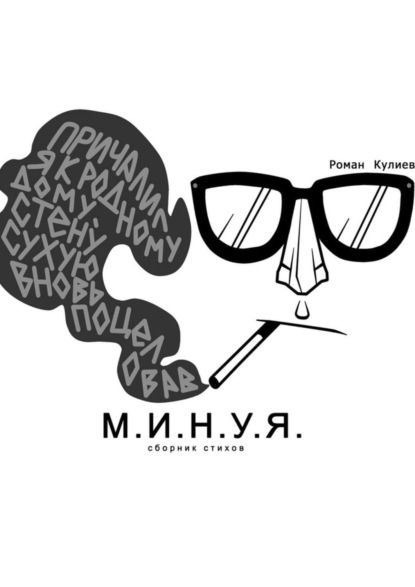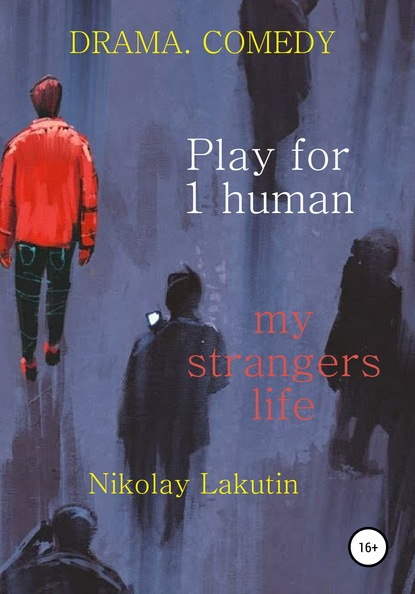Wirtschafts- und Sozialgeschichte Westeuropas seit 1945
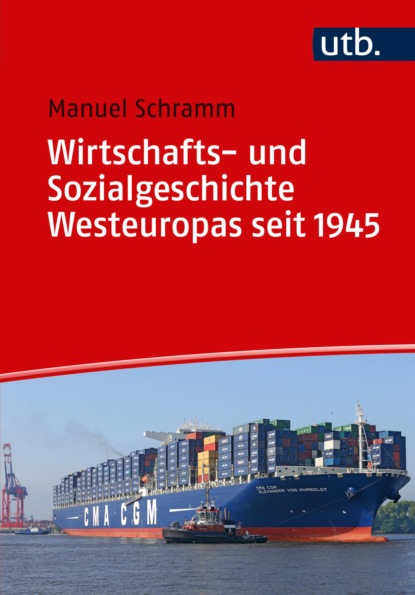
- -
- 100%
- +
Eine geringe Rolle spielte dagegen die justizielle Säuberung in Italien. Zwar wurden nach Kriegsende außerordentliche Schwurgerichte eingesetzt, und ca. 20.000 bis 30.000 Verdächtige angeklagt. Bereits im Sommer 1946 kam es jedoch zu einer großzügigen Amnestieregelung, so dass viele Faschisten, die die „wilden“ Säuberungen überlebt hatten, ohne Strafe oder mit geringen Strafen davonkamen. Darunter waren nicht nur kleine Fische, sondern auch prominente Personen wie Rodolfo Graziani, der frühere Oberbefehlshaber der faschistischen Truppen der Republik von Salò, der nicht mehr als drei Monate im Gefängnis verbringen musste.
Nicht nur in Italien, sondern auch in anderen Ländern kam es angesichts der Vielzahl der Fälle von „kleinen“ Nazis und der Überforderung des Justiz- und Verwaltungsapparats immer wieder zu Forderungen nach Amnestien. In der Tat wurden in vielen Ländern mehr oder weniger weitreichende Amnestiegesetze beschlossen: in Italien und den Niederlanden bereits 1946, in Österreich und Norwegen und wiederum in Italien 1948, in Deutschland 1949 und 1951, in Frankreich 1951 und 1953. Neben der wohl unvermeidlichen Amnestierung der „kleinen“ Nazis und Faschisten profitierten von der „Rehabilitierungswut“ (Bauerkämper) auch „große“ oder zumindest „mittelgroße“ Belastete, die zum Teil sogar wieder in Führungspositionen aufstiegen. So hatten sowohl der Pariser Polizeichef Maurice Papon, der 1961 eine Demonstration von Algeriern brutal niederschlagen ließ, als auch der deutsche Vertriebenenminister Theodor Oberländer, als auch der Fraktionsvorsitzende der niederländischen Christdemokraten Willem Aantjes eine NS-Vergangenheit, über die sie später stolperten.
Solche Biografien ließen schnell den Verdacht aufkommen, die Entnazifizierungen seien im Grunde gescheitert und es sei eigentlich nur die Führungsriege der Nationalsozialisten bestraft worden. Diese Kritik ist nicht neu und auch nicht auf Deutschland beschränkt. Auch in Italien sprachen Angehörige der Widerstandsbewegung von einer ausgebliebenen Säuberung („epurazione mancata“). Aber das Urteil ist wohl zu hart. Der primäre Zweck der Säuberungen, nämlich die Stabilisierung der Nachkriegsdemokratien, wurde erreicht. Das ist nicht selbstverständlich. Als abschreckendes Beispiel für eine tatsächlich ausgebliebene Säuberung mag das griechische Beispiel dienen. Hier kam mit britischer Unterstützung im Frühjahr 1946 eine rechtsgerichtete Regierung an die Macht, die nicht antifaschistische, sondern antikommunistische Säuberungen durchführte und dabei auch viele nicht kommunistische Widerstandskämpfer aus Führungspositionen entfernte. Das Ergebnis war ein dreijähriger Bürgerkrieg mit Zehntausenden Toten, der an seinem Ende 1949 ein weitgehend verwüstetes Land hinterließ.
Dass es gleichwohl unterhalb der Führungsebene eine weitgehende Elitenkontinuität gab (etwa in Wirtschaft, Justiz, Polizei oder Verwaltung), ist wohl unbestritten. Eine gründlichere Säuberung war aber in den europäischen Nachkriegsgesellschaften keineswegs populär, weshalb auch linke Parteien, wie die italienische kommunistische Partei, sich für weitgehende Amnestien einsetzten. Vielmehr war das kulturelle Gedächtnis von der Heroisierung des Widerstands einerseits und der tatsächlichen oder vermeintlichen Opfererfahrung andererseits geprägt. Selbst in Deutschland fühlten sich die meisten Menschen als Opfer des Nationalsozialismus und nicht als Mittäter. Gerade deswegen wurden die Grausamkeit und Bestialität der angeblich kleinen Gruppe von Tätern (z.B. KZ-Wachpersonal) in der medialen Berichterstattung hervorgehoben. Sie wurden dadurch aus der angeblich unbelasteten Mehrheitsgesellschaft ausgesondert. Eine kritischere Sicht auf die Vergangenheit sollte sich erst viel später durchsetzen, in den siebziger und achtziger Jahren.
Literatur
Bachmann, Klaus: Vergeltung, Strafe, Amnestie. Eine vergleichende Studie zu Kollaboration und ihrer Aufarbeitung in Belgien, Polen und den Niederlanden, Frankfurt am Main 2011
Bauerkämper, Arnd: Das umstrittene Gedächtnis. Die Erinnerung an Nationalsozialismus, Faschismus und Krieg in Europa seit 1945, Paderborn 2012
Frei, Norbert (Hg.): Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2005
Frei, Norbert: Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1999
Fühner, Harald: Nachspiel. Die niederländische Politik und die Verfolgung von Kollaborateuren und NS-Verbrechern, 1945–1989, Münster 2005
Niethammer, Lutz: Die Mitläuferfabrik. Die Entnazifizierung am Beispiel Bayerns, Berlin 2. Aufl. 1982
Woller, Hans/Henke, Klaus-Dietmar (Hg.): Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg, München 1991
Woller, Hans: Die Abrechnung mit dem Faschismus in Italien 1943 bis 1948, München 1996
1.3Die europäische Flüchtlingskrise
Die europäische Flüchtlingskrise der Nachkriegszeit verschärfte die ohnehin vorhandenen Verteilungsprobleme der „Rationen-Gesellschaft“. Sie war ein direktes Resultat des Krieges und der NS-Herrschaft. Obwohl Deutschland vielleicht am stärksten betroffen war, handelte es sich im Kern doch um eine europäische, in gewisser Weise sogar eine globale Erscheinung. Das muss besonders in Deutschland betont werden, wo die Erinnerung vor allem von der Problematik der so genannten „Vertriebenen“ dominiert wird. Deren Schicksal verdient selbstverständlich Beachtung, handelte es sich doch bei dieser ethnischen Säuberung um die wohl größte Zwangsmigration der europäischen Geschichte. Aber das sollte nicht den Blick dafür verstellen, dass auch andere westeuropäische Länder von der Flüchtlingskrise betroffen waren wie z. B. Italien, das ebenfalls zur Drehscheibe für große Flüchtlingsgruppen wurde, oder Frankreich, das über 2 Millionen repatriierte Landsleute aufnahm, oder Großbritannien, das als Besatzungsmacht in Deutschland und in Palästina entscheidend zur Bewältigung der Flüchtlingskrise beitrug (im einen Fall recht erfolgreich, im anderen eher weniger).
Die Fakten sind an sich mittlerweile gut bekannt, auch wenn die vorhandenen Zahlen aufgrund der schwierigen Quellenlage und differierender Definitionen nur grobe Orientierungswerte darstellen. Immerhin schätzt Peter Gatrell, dass nach dem Ersten Weltkrieg ca. 12 Millionen Menschen in Europa auf der Flucht waren, nach dem Zweiten Weltkrieg ca. 60 Millionen und nach dem Ende des Kalten Krieges weniger als 7 Millionen. Das verdeutlicht, dass die Flüchtlingskrise einerseits nicht prinzipiell neu war, sondern Vorläufer in der Zwischenkriegszeit hatte, andererseits von den quantitativen Dimensionen her alles andere, erst recht die Arbeitsmigrationen nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Schatten stellte. Diese Zahlen beinhalten allerdings auch die Binnenflüchtlinge, die von internationalen Organisationen nicht als Flüchtlinge gezählt wurden. Die Ursache für diese große Zahl an Flüchtlingen ist in Verlauf und Folgen des Krieges zu suchen. Viele waren freigelassene Kriegsgefangene, ehemalige Zwangsarbeiter im NS-Deutschland, Evakuierte oder Ausgebombte, Opfer ethnischer Säuberungen, flüchtige Kriegs- oder NS-Verbrecher oder freigelassene Insassen der Konzentrationslager, insgesamt also eine sehr heterogene Gruppe.

Abb 3Flüchtlingsströme in der Nachkriegszeit; schwarz: ethnische Säuberungen; grau: „Displaced Persons“ (eigene Grafik auf Basis der Karte aus: Paul Werth, University of Nevada, Las Vegas; https://faculty.unlv.edu/pwerth/Europe-1945-territorial.jpg).
1.3.1„Displaced Persons“
Bei Kriegsende existierten in Deutschland ca. 8 Millionen „Displaced Persons“ (DPs), darunter ca. die Hälfte Sowjets, 2 Millionen Franzosen, 1,6 Millionen Polen und 700.000 Italiener. Die deutschen Vertriebenen wurden nicht zu ihnen gezählt, obwohl sie ohne Zweifel „displaced“ waren. In den Konzentrationslagern im Reich hatten nur ca. 50.000 bis 100.000 Juden den Holocaust überlebt, und viele starben noch nach der Befreiung an Unterernährung und Krankheiten infolge der grausamen Lagerhaft. Allerdings wuchs die Zahl der Juden in Deutschland zunächst wieder an, da viele befreite Juden aus der Sowjetunion oder Polen nach Westen wanderten. In Polen setzte 1945/46 eine Welle von Pogromen ein, die dazu führte, dass viele Juden in Deutschland, Österreich oder Italien Zuflucht suchten, meist allerdings nicht, um dort zu bleiben, sondern um entweder nach Palästina oder in andere Staaten zu emigrieren.
Die Verantwortung für die DPs übernahmen die Alliierten und die vor allem von den USA finanzierte United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), die bereits im Herbst 1943 gegründet worden war. Nach Auffassung der Alliierten bestand das primäre Ziel in der Repatriierung, also der Rückführung der DPs, die durch die Kriegsfolgen gegen ihren Willen in ein fremdes Land geraten waren (z. B. als Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter). Stillschweigend vorausgesetzt wurde, dass tatsächlich alle DPs in ihr Heimatland zurückkehren wollten. Das war aber nicht der Fall, und zwar nicht nur bei den befreiten Juden, die verständlicherweise nicht mit den ehemaligen Tätern zusammenleben wollten. Für diplomatische Spannungen sorgte vielmehr zunächst die Frage der sowjetischen DPs, die häufig nicht in die stalinistische Sowjetunion zurückkehren wollten. Die Sowjetunion pochte jedoch auf deren Rückkehr, zum Teil aufgrund des hohen Arbeitskräftebedarfs, zum Teil, um die Entstehung von großen unkontrollierbaren Emigrationspopulationen in westlichen Ländern zu verhindern. Rein quantitativ war die Arbeit der UNRRA in den ersten Monaten nach Kriegsende ein Erfolg: 5,25 Millionen Westeuropäer wurden im Mai und Juni 1945 repatriiert und 2,3 Millionen sowjetische DPs bis Ende September 1945, allerdings häufig gegen ihren Willen. Der Transfer solch großer Bevölkerungsteile gelang nur, weil die Alliierten ihre militärische Logistik für diesen Zweck zur Verfügung stellten.
Erst im Herbst 1945 begann sich die Haltung der Westalliierten zu wandeln und die Zwangsrepatriierung sowjetischer DPs wurde eingestellt. Bereits vorher war die Behandlung der jüdischen DPs revidiert worden. Der Anlass dafür war der im August 1945 an den amerikanischen Präsidenten gerichtete „Harrison Report“, der die Zustände in den jüdischen DP-Lagern anprangerte. Der Autor Earl G. Harrison argumentierte, für die Juden habe sich mit Kriegsende nichts verändert, außer dass sie nicht mehr umgebracht würden. Ansonsten waren sie noch in denselben Lagern unter militärischer Bewachung inhaftiert wie vor der Befreiung. Daraufhin wurden die Lager entweder der jüdischen Selbstverwaltung oder der UNRRA unterstellt.
Im Laufe des Jahres 1946 wurde immer deutlicher, dass die Politik der Repatriierung an ihre Grenzen stieß. 1947 hausten noch ca. 1 Million DPs in Deutschland und Österreich, die nicht repatriiert werden konnten oder wollten. Um sie sollte sich die 1946 gegründete Internationale Flüchtlingsorganisation kümmern. Die meisten Flüchtlinge dieser „letzten Million“ verließen Europa und kamen in den USA, Australien, Israel und Kanada unter. Ca. 140.000 DPs waren 1951 noch in der Bundesrepublik und blieben dort. Das letzte DP-Lager in Wehnen bei Oldenburg wurde erst 1959 geschlossen.
Die Integration der DPs in den westeuropäischen Herkunfts- oder Aufnahmeländern erwies sich als schwierig. Das gilt sogar für diejenigen, die in ihr Heimatland zurückkehrten. Besonders die ehemaligen Zwangsarbeiter hatten mit dem Vorurteil zu kämpfen, sie seien eigentlich als Kollaborateure nach Deutschland gegangen. Die Nachkriegserinnerung konzentrierte sich in Frankreich, aber auch in anderen westeuropäischen Ländern wie Belgien, den Niederlanden und Italien auf den verklärten Widerstand und die Opfer im Kampf gegen die deutschen Besatzer. Demgegenüber stießen viele ehemalige Zwangsarbeiter auf Desinteresse oder Ablehnung. Auf der anderen Seite war die berufliche und familiäre Eingliederung vergleichsweise unproblematisch. Angestrebt wurde besonders in Frankreich, die ehemaligen Zwangsarbeiter in ihre alten Betriebe zu reintegrieren. Wo dies nicht gelang, genossen sie Vorrang bei der Zuweisung von Arbeitsplätzen. Schwieriger war naturgemäß die Integration der ausländischen, meist osteuropäischen Flüchtlinge. Viele, insbesondere qualifizierte Arbeiter oder Akademiker, mussten einen Statusverlust hinnehmen und fanden lediglich in niedrig qualifizierten Bereichen Arbeit.
1.3.2Ethnische Säuberungen
Ähnliche Integrationsprobleme zeigten sich bei den deutschen Vertriebenen. Insgesamt handelte es sich bei den summarisch „Vertreibungen“ genannten ethnischen Säuberungen der Deutschen aus Polen, der Tschechoslowakei, der Sowjetunion und Ungarn um die größte Zwangsmigration der europäischen Geschichte. Man schätzt, dass 12 bis 14 Millionen Deutsche ihre Heimat verlassen mussten. Ca. 8 Millionen siedelten sich in den westlichen Besatzungszonen Deutschlands an, ca. 4 Millionen in der SBZ. Der prozentuale Anteil der Vertriebenen an der Bevölkerung lag also im Osten Deutschlands höher als im Westen. Allerdings war dort die öffentliche Thematisierung der Vertreibung (offiziell „Umsiedlung“) tabuisiert, im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo besonders die Vertriebenenverbände die Erinnerung bis heute wachhalten. Die Zahl der Todesopfer ist umstritten, aber neuere Schätzungen gehen eher von ca. 30.000 (Tschechoslowakei) bzw. 400.000 (Polen) Toten aus, als von den in der älteren Literatur häufig genannten 2 Millionen.
Generell muss man, was die zeitliche Abfolge angeht, zwischen Flucht in den letzten Kriegstagen, Vertreibung nach Kriegsende und vertraglich geregelter Zwangsaussiedlung nach dem Potsdamer Abkommen (August 1945) unterscheiden. Vor allem die ersten beiden Phasen, Flucht und Vertreibung, waren von massiver Gewalt und hohen Opferzahlen begleitet. Das Potsdamer Abkommen legitimierte zwar einerseits die Vertreibungen, versprach aber auch einen „geordneten und humanen“ Bevölkerungstransfer. Auch wenn dies nicht in jedem Fall eingehalten wurde, sanken die Opferzahlen nach dem Potsdamer Abkommen deutlich. In der Ikonografie dominiert das Bild der Flüchtlingstrecks mit Planwagen, aber wahrscheinlich sind mehr Vertriebene mit der Eisenbahn gekommen (allerdings nicht in bequemen Personenwaggons, sondern in Vieh- oder Güterwaggons).

Abb 4Ein Flüchtlingstreck nach Deutschland im Juli 1944 (Quelle: Bundesarchiv 183-W0402–500).
Bei den Motiven für die ethnischen Säuberungen überschnitten sich populäre Rachegelüste und ethnischer Hass mit den Zielen und Planungen der Alliierten. Es ist wohl nicht zutreffend, dass die Westalliierten den ethnischen Säuberungen nur widerwillig zugestimmt hätten. Vielmehr sahen sie in der Schaffung ethnisch homogener Nationalstaaten ein Mittel zur Verhinderung von neuen Konflikten in der Zukunft. Das Motiv der kollektiven Bestrafung spielte ebenfalls eine Rolle.
Die Integration dieser großen Zahl an Vertriebenen wird nicht zu Unrecht als große Leistung der jungen Bundesrepublik angesehen. Sie wurde begünstigt durch die Ende der vierziger Jahre einsetzende gute Konjunktur, die die Integration in den Arbeitsmarkt erheblich erleichterte. Im Übrigen aber hat die neuere Forschung gezeigt, dass die Integration nicht so reibungslos verlief wie früher gedacht. In vielen Teilen Deutschlands wurden die Vertriebenen nicht als bemitleidenswerte (noch dazu deutsche) Opfer gesehen, sondern als „Polacken“ beschimpft und ausgegrenzt. Auch sozioökonomisch mussten viele einen Statusverlust hinnehmen. In sozialhistorischer Hinsicht bemerkenswert ist, dass die Vertreibungen erheblich zum Strukturwandel der bundesdeutschen Wirtschaft von der Landwirtschaft zur Industrie beitrugen. Viele der Neuankömmlinge hatten vorher in der Landwirtschaft gearbeitet und fanden in der neuen Heimat Arbeit in der Industrie. Das entlastete die einheimische Bevölkerung, die somit nicht oder doch sehr viel langsamer zur Abwanderung in die Industrie gezwungen wurde.
1.3.3Die Geburt des modernen Flüchtlings
Was waren die Ergebnisse dieser wohl größten Flüchtlingskrise der europäischen Geschichte? Auf internationaler Ebene die UN-Flüchtlingskonvention von 1951, die noch heute die Grundlage für den internationalen Flüchtlingsstatus bildet. Ursprünglich war sie beschränkt auf europäische Flüchtlinge, die aufgrund von Ereignissen vor 1951 fliehen mussten. Diese Einschränkungen wurden 1967 aufgehoben. Die Konvention konstituierte einen individuellen Flüchtlingsstatus, der auf begründeter Furcht des Flüchtlings vor Verfolgung aufgrund von Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder politischer Meinung beruht. Dieser individuelle Schutzanspruch war neu; in der Zwischenkriegszeit waren lediglich Flüchtlingskontingente von einigen Staaten aufgenommen worden.
Die Veränderung des Flüchtlingsstatus war aber nicht der entscheidende Grund, warum die Flüchtlingskrise in der europäischen Nachkriegszeit doch in den meisten westeuropäischen Staaten relativ glimpflich verlief. Vielmehr wurde die Eingliederung erleichtert durch den wirtschaftlichen Aufschwung der fünfziger und sechziger Jahre. Zwar mussten viele Flüchtlinge sozialen Abstieg hinnehmen, aber eine dauerhafte Konfliktlinie entstand aus dem Flüchtlingsproblem nicht. Allerdings trugen die Flüchtlinge einen überproportionalen Teil der Kosten des Strukturwandels und der Modernisierung der westeuropäischen Gesellschaften.
Literatur
Cohen, Gerard Daniel: In War´s Wake. Europe´s Displaced Persons in the Postwar Order, Oxford 2012
Gatrell, Peter: The Making of the Modern Refugee, Oxford 2013
Jacobmeyer, Wolfgang: Vom Zwangsarbeiter zum heimatlosen Ausländer. Die displaced persons in Westdeutschland 1945–1951, Göttingen 1985
Lüttinger, Paul: Der Mythos der schnellen Integration. Eine empirische Untersuchung zur Integration der Vertriebenen und Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland bis 1971, in: Zeitschrift für Soziologie 15 (1986), S. 20–36
Marrus, Michael R.: The Unwanted. European Refugees in the twentieth century, Oxford 1985
Naimark, Norman: Flammender Haß. Ethnische Säuberungen im 20. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2008
Schwartz, Michael: Vertriebene und „Umsiedlerpolitik“. Integrationskonflikte in den deutschen Nachkriegs-Gesellschaften und die Assimilationsstrategien in der SBZ/DDR 1945–1961, München 2004
Steinert, Johannes-Dieter/Weber-Newt, Inge (Hg.): European Immigrants in Britain, 1933–1950, München 2003
Ther, Philipp: Die dunkle Seite der Nationalstaaten. „Ethnische Säuberungen“ im modernen Europa, Göttingen 2011
1.4Der Nachkriegskonsens
1989 erschien ein Aufsatz des britischen Historikers Ben Pimlott unter dem Titel „Is the post-war consensus a myth?“ Die zugrunde liegende These ist, dass es, anders als damals angenommen, keinen überparteilichen Nachkriegskonsens gegeben habe. Die damals unter britischen Zeithistorikern und Politikwissenschaftlern vorherrschende Meinung war, dass die Zeit zwischen 1945 und Mitte der siebziger Jahre von einem breiten parteienübergreifenden Nachkriegskonsens geprägt worden sei, der erst durch den Neoliberalismus und die entsprechenden Reformen der Regierung Thatcher aufgebrochen wurde. Beide Ansichten lassen sich heute nicht mehr halten. Es gab in der Tat einen Nachkriegskonsens, der alle Parteien von den Kommunisten bis zu den Konservativen oder Christdemokraten umfasste (allerdings nicht die Faschisten oder Nationalsozialisten), aber er hielt nicht bis Mitte der siebziger, sondern zerbrach schon Ende der vierziger Jahre.
Im Grunde genommen war es nicht verwunderlich, dass es diesen Nachkriegskonsens gab. Politisch beruhte er auf der gemeinsamen Gegnerschaft gegen Faschismus und Nationalsozialismus. In Ländern wie Italien oder Frankreich resultierte er direkt aus den Widerstandsbewegungen, in denen Kommunisten, Sozialisten und bürgerliche Kräfte zusammengearbeitet hatten. Hinzu kam aber etwas anderes. Bis weit in die Mittelschichten hinein war die Überzeugung verbreitet, dass der Kapitalismus eigentlich am Ende sei und dass die Zukunft einem wie auch immer gearteten Sozialismus gehören werde. Vor allem die Weltwirtschaftskrise nach 1929 hatte zu dieser Stimmung beigetragen. Hinzu kam, dass die Unternehmer durch die Kollaboration mit dem Nationalsozialismus und Faschismus belastet waren. „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen Volkes nicht gerecht geworden“, erklärte das Ahlener Programm der CDU in der britischen Besatzungszone im Februar 1947. Es forderte eine „gemeinwirtschaftliche Ordnung“ und die Vergesellschaftung der Kohlenbergwerke. Das Ergebnis waren Bemühungen, den Sozialstaat auszubauen und die Wirtschaft generell einer mehr oder weniger starken Steuerung zu unterwerfen. Diesem Ziel diente bereits vor Kriegsende die Konferenz von Bretton Woods (USA) im Juli 1944, die ein festes Wechselkurssystem mit gewissen Schwankungsbreiten etablierte.
1.4.1Widerstand und Volksfrontregierungen
Die Zusammenarbeit zwischen Kommunisten, Sozialisten und bürgerlichen Kräften gegen faschistische oder andere rechtsdiktatorische Bewegungen (z. B. Frankismus in Spanien) ging auf die Zwischenkriegszeit zurück. Nach der leidvollen Erfahrung des Scheiterns der „Sozialfaschismus“-Strategie der Weimarer Republik, nach der nicht die Nationalsozialisten, sondern die Sozialdemokraten den Hauptfeind der Kommunisten darstellten, hatte sich auch die Kommunistische Internationale solchen breiten Bündnissen geöffnet. In Frankreich und in Spanien existierten Volksfrontregierungen aus linken und liberalen Parteien 1936/37 und während des Spanischen Bürgerkriegs 1936–1939. Mit dem Hitler-Stalin-Pakt erfolgte zwar eine Abkehr Stalins von der Volksfrontpolitik, die jedoch im Zweiten Weltkrieg wieder aktuell wurde.
Der Widerstand gegen die faschistischen und nationalsozialistischen Regime war vielfältig. An ihm nahmen Männer und Frauen ganz unterschiedlicher politischer Überzeugung teil, von Kommunisten bis Nationalkonservativen. In Frankreich hatte Charles de Gaulle bereits nach der militärischen Niederlage 1940 zum bewaffneten Widerstand aufgerufen. In der Folgezeit gründeten sich mehrere Gruppen, die gegen die deutsche Besatzung und das Vichyregime kämpften. Sie vereinigten sich 1943 im Nationalen Widerstandsrat, in dem mit André Mercier auch ein Vertreter der kommunistischen Partei saß. Und am 5. September 1944 bildete de Gaulle eine provisorische Regierung, die auch kommunistische Vertreter einschloss. Ähnlich verhielt es sich in Italien, wo die Kommunisten unter Palmiro Togliatti im April 1944 in die postfaschistische Regierung Badoglio eintraten. Die Kommunisten stellten im Sommer 1944 ca. 50.000 von insgesamt 80.000 italienischen Partisanen. In Belgien war sogar schon im Herbst 1941 eine „Unabhängigkeitsfront“ gegen die Nationalsozialisten aus Kommunisten, Sozialisten und Liberalen gebildet worden. Auch hier wurde die kommunistische Partei an der Regierung beteiligt.
Der militärische Beitrag der Partisanen und das Ausmaß der Widerstandsbewegungen sollten nicht überschätzt werden. Nur ca. 2 Prozent der französischen Bevölkerung beteiligten sich an der Résistance. Die Alliierten weigerten sich zumeist, ihre militärischen Pläne mit den Partisanen zu koordinieren, selbst wo dies möglich gewesen wäre. Im November 1944 empfahl der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen in Italien den italienischen Partisanen gar, den Kampf bis zum Frühjahr einzustellen. Aber symbolisch hatte der militärische Widerstand eine wichtige Bedeutung, da er zum Gründungs- und Einigungsmythos der europäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg avancierte.
Nicht in allen Ländern waren Kommunisten an der Regierung beteiligt, aber überall gab es die Suche nach einem übergreifenden Konsens, der nur die Kollaborateure, Nationalsozialisten und Faschisten ausschloss (sofern sie sich nicht reumütig zeigten). Gleichzeitig gab es in den ersten Wahlen nach dem Krieg einen bemerkenswerten Linksruck. So gewann die Labour Party unter Clemens Attlee überraschend die Unterhauswahl von 1945 und schickte den Kriegshelden Winston Churchill in die Opposition. In Frankreich wurde noch Anfang 1947 der Sozialist Vincent Auriol mit den Stimmen der Kommunisten zum Staatspräsidenten gewählt.