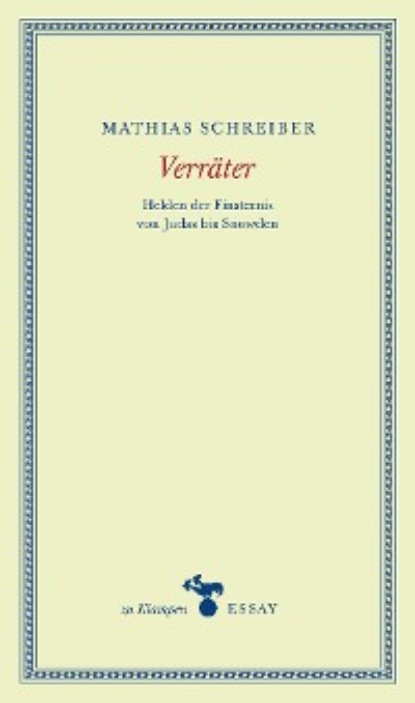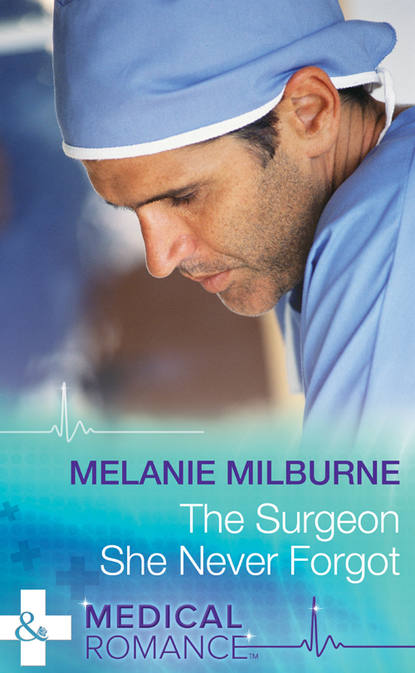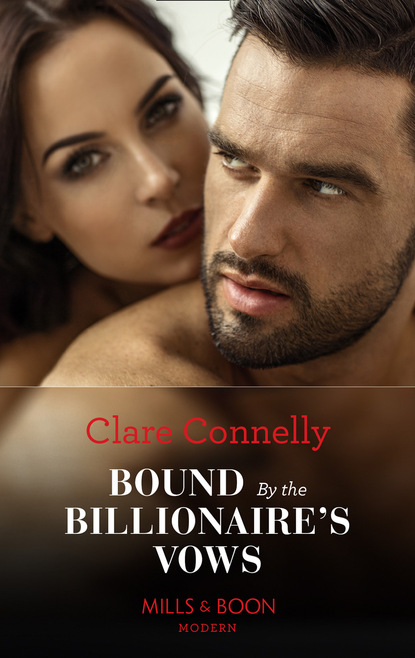- -
- 100%
- +
Wenig später meldete ein Wiener Lokalblatt, die Tschechoslowaken hätten einen britischen Spion erwischt. Auf einer tschechoslowakischen Liste von etwa 40 westlichen Spionen, die wegen ihrer Aktionen oder Agitationen gegen den Kommunismus hingerichtet wurden, tauchte schließlich auch der Name des Jan Masek auf. Dabei war Masek »bloß ein einfacher Mann, der seine Mutter sehen wollte«, wie der BBC-Mitarbeiter Gordon Corera, der den Fall recherchiert hat, anrührend formuliert.4
Der Überläufer im Kalten Krieg hat viel mit dem Deserteur im Krieg gemeinsam. Die Fronten zu wechseln, ist in jedem Fall physisch, aber auch moralisch riskant. Siegfried Lenz, einst selbst Kriegsteilnehmer und Deserteur, schildert in seinem atmosphärisch bedrängenden Romanerstling »Der Überläufer« (postum 2016 publiziert) dieses Risiko so: Im letzten Sommer des Zweiten Weltkriegs wechselt der von der »abscheulichen Klicke« der Nazis desillusionierte deutsche Wehrmachts-Soldat Walter Proska die Fronten, beeinflusst von einem anderen Überläufer, der sich selbst mit Judas vergleicht, beflügelt auch durch die Liebe zu der polnischen Partisanin Wanda, die von ihm ein Kind erwartet. Den »Bösen« ist er verhasst als Verräter der nationalistischen Selbstüberschätzung, den Befreiern willkommen als »Außenseiter«, der seinem Gewissen folgt. Die Flucht von den »Bösen« zu den »Gerechten« macht Proska, den moralischen Helden, aber auch schuldig, weil er als Verbündeter der Partisanen versehentlich seinen Schwager erschießt. Am Ende verlässt er auch die Gerechten: Ihre sozialistische Überwachungs-Diktatur, unter der ihm, dem notorischen Zweifler, wegen irgendeiner Denunziation die Verhaftung droht, verängstigt ihn; in einem abenteuerlichen Kraftakt kriecht und rennt er bei Nacht, durch Schlamm und Gestrüpp, knapp vorbei an russischen Wachtposten, auf den Weg in den Westen. So verrät er gewissermaßen den eigenen Verrat. Dabei verliert er die Verbindung zu der Mutter seines Kindes ebenso wie die zu seiner geliebten Schwester Maria – seine komplizierte Verratsgeschichte endet zwar in der Freiheit, aber auch im Selbstverlust.
Jan Masek war als Informant über die militärischen Strukturen des kommunistischen Ostblocks im Westen willkommen, im totalitären Osten aber galt er als Systemfeind, dem die Todesstrafe drohte. Dass ihm diese extrem gegensätzliche Bewertung seines Tuns bewusst war, darf man annehmen. Die psychische Anspannung, die daraus für ihn folgte, mag ihn unvorsichtig gemacht haben.
Ganz einfach und eindeutig ärmlich ist in dieser Geschichte der Verrat der Dorfbewohner, die dem tschechoslowakischen Geheimdienst geflüstert haben, dass Masek zu Besuch bei seiner Mutter weilte – ohne Not, nur aus Geldgier. Diese Charakterlosigkeit wollen wir nicht perspektivisch relativieren. Der Verrat an Masek, mit tödlicher Folge, ist eindeutig abscheulich, seine eigene Verräter-Rolle wird je nach dem Standpunkt des Betrachters gegensätzlich bewertet – wie fast bei allen Überläufern im Krieg. Der Befund, abscheulich zu sein, ist jedenfalls nicht die ganze Wahrheit dieses Verrats.
»Verrat trennt alle Bande«, heißt es in Schillers Drama »Wallensteins Tod«. Der böhmische Feldherr Wallenstein, im Dreißigjährigen Krieg des 17. Jahrhunderts zunächst erfolgreich im Dienst des katholischen Kaisers, wurde wegen eigenmächtiger Verhandlungen mit dem protestantischen Gegner des »Hochverrats« angeklagt und von wahrscheinlich irischen Söldnern des Wiener Hofes heimtückisch mit der Lanze ermordet. Er hatte die Bande zum Kaiser allzu sehr gelockert, heimlich vielleicht sogar gekappt. Die Entscheidung zu diesem Verrat war eine Entscheidung für das protestantische Nordeuropa – für die Zukunft.
Die Frage drängt sich auf: Ist das Durchtrennen der Bande immer von Übel? Auch dann, wenn Kinder sich gegen die Gewohnheiten und Ideale ihrer Eltern wenden, diese insofern auch verraten? Ist nicht so mancher Partner einer unglücklich gewordenen Ehe nach der Auflösung dieses eigentlich unkündbaren Bündnisses, also nach dem Verrat am Liebespakt mit dem anderen Partner, erst richtig aufgeblüht? Das verräterische Trennen der Bande ist nicht selten auch eine segensreiche Abweichung von fragwürdig gewordenen Gewohnheiten, Vereins-Verpflichtungen oder sogar Normen. Der Philosoph Arnd Pollmann schreibt: »Der couragierte ›Whistleblower‹, der auf die Gefahr hin, seinen Job zu verlieren, brisante Informationen über illegale Machenschaften innerhalb seiner Firma, Organisation oder Dienststelle weitergibt, ist kein Verräter.«5 Mögen auch diejenigen, die sich von ihm verraten fühlen, ihn als »Nestbeschmutzer« verachten, so könne er für die Außenstehenden »sogar ein Held sein, der einen Preis für Zivilcourage verdient« – so Pollmann. Dass der mutige Whistleblower kein Verräter sei, ist wohl eine allzu sonnige Sicht. Die Institution, aus der er als illoyaler Insider Brisantes ausplaudert, wird jedenfalls von ihm hereingelegt. Es könnte allerdings sein, dass der so verratene Inhalt bedeutend für das Wohlergehen der Menschheit ist, und in diesem Fall wird es schwierig, den Verrat als solchen moralisch einzuordnen – was wir im folgenden dennoch versuchen werden.
»Whistleblower« heißt eigentlich, gemäß der Redewendung »to blow the whistle on someone«, soviel wie: etwas Geheimes öffentlich machen, jemanden sozusagen verpfeifen, aber zu einem Zweck, der – nach Einschätzung des Verpfeifenden – der Allgemeinheit dient. In Geheimdienstkreisen heißen Verräter sachlich »Informanten« – schon hier beginnt die Täuschung, sie funktioniert wie der ideologisch verordnete »Neusprech« in George Orwells Roman »1984«. Die sogenannten Informanten müssen so auftreten und wirken wie die trügerische Bezeichnung ihrer Tätigkeit: unauffällig, keinesfalls irgendwie aufregend oder abweichend.
In einer Fernsehreportage der BBC über Scotland Yard und andere Geheimdienste der britischen Inseln, die im Sommer 2016 auch von »Spiegel TV« ausgestrahlt wurde, bekennt ein – unkenntlich gemachter – jüngerer Spion: »Man muss in meinem Beruf wie ein Niemand aussehen.« Der Akteur richtet sich nach dem Motto des britischen MI6, man könne am besten die Geheimnisse der anderen stehlen, wenn man gleichzeitig die eigenen hüte, und zwar so erfolgreich, dass die Leute glaubten, so etwas wie der MI6 »existiere überhaupt nicht«6. Welches Profil aber hat ein »Niemand«, der niemandem auffällt, gleichzeitig aber die Einsicht über sich selbst aushalten muss: »Man lebt eine Lüge«, wie eine Agentin in dem erwähnten BBC-Film gesteht? Er hat am liebsten gar kein Profil. Diese Gesichtslosigkeit ist für sich bereits anrüchig, daran ändert ihr Spionage-Erfolg nichts.
Der Begriff des Verrats
SITTLICHKEIT (oder Moralität) meint eine Haltung der uneingeschränkten Verbindlichkeit. Für diese Haltung werden die Maßstäbe gesetzt durch Prinzipien wie Gerechtigkeit, Achtung der Menschenwürde, Wahrhaftigkeit, Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit. Ein zentraler Wert ist die Vertragstreue im privaten wie öffentlichen Miteinander – der Grundsatz »Pacta sunt servanda« (Verträge sind einzuhalten) gilt seit dem Mittelalter, mag er auch noch so oft missachtet worden sein. Solche Prinzipien haben für den sittlich orientierten Menschen klaren Vorrang gegenüber dem praktischen Vorteil oder wirtschaftlichen Nutzen wechselnder Opportunität. Von hier aus gesehen ist Verrat an sich unsittlich. Er verweist auf eine Haltung fundamentaler Unzuverlässigkeit. Der Verräter kümmert sich in der Regel nicht um die Geltung moralischer Grundsätze, er bringt es sogar fertig, den Schein der Moralität als Maske für eine heimlich begangene Schurkerei zu missbrauchen. Dabei ignoriert er allgemeine Grundsätze des Humanen und schadet zugleich ganz konkret einzelnen Menschen. Jene Verrats-Delikte, die milder beurteilt werden müssen, sind nicht die Regel, sondern Ausnahmen. Sie sollten nicht dazu missbraucht werden, den üblen Regelfall zu verharmlosen.
Im Mittelhochdeutschen hat das Verb »verraten« mehrere Bedeutungen: »durch falschen Rat irreleiten, verführen, vernichten, einen Anschlag machen gegen«; es gibt aber auch schon den heutigen Gebrauch des Wortes: »verraten« – ein Geheimnis preisgeben zum Schaden eines anderen oder einer größeren Gruppe. »Verräter« heißt auch »Wahrsager« – der verrät das Geheimnis des Kommenden.1 Jeder Verrat ist ein Vertrauensbruch, der Anschlag auf ein »Verhältnis der Loyalität«, wie der Schriftsteller und Jurist Bernhard Schlink formuliert.2 Zu der Beziehung zwischen dem Verräter und dem Verratenen (das kann auch ein Prinzip oder eine Partei sein) gehört ein Dritter (das kann auch eine Institution sein); ein Dritter, der von dem Verrat profitiert, der den Verräter belohnt und den Verratenen notfalls tötet oder anders bestraft.
Meistens zerbricht der Verräter ein über längere Zeit entwickeltes, darum relativ intensives Verhältnis der Loyalität oder des Vertrauens. Denn ohne tiefere Vertraulichkeit dürfte der Verratene dem Verräter kaum heikle Informationen anvertraut haben, und nur heikle Informationen sind ja wertvoll. Der Verrat bedeutender Geheimnisse ist deshalb fast immer zugleich Freundesverrat. Der Verräter missachtet das Gebot der Treue zu Freunden, die ihm vertrauten; aber auch zu sich selbst, sofern er beansprucht, ein verlässliches, freundschaftsfähiges Mitglied der Gesellschaft zu sein. Der Begriff der »Treue«, wenn er mehr meint als die emotionale Bindung zwischen vertrauten Menschen, benennt eine »unveränderlich gewissenhafte Gesinnung«3. Fremde Personen kann man, etwa bei der Polizei, wegen irgendeines Vergehens anzeigen, also verraten, aber der Begriff des Verrats trifft hier eher technisch zu. Im Sinne des moralisch partout Verwerflichen passt er nur in Fällen schlimmer Denunziation, etwa von Oppositionellen an ein Unrechtsregime. Zu Opfern eines fundamentalen Verratsgeschehens »taugen nur diejenigen, die aufgrund einer bestehenden Vertrauensbeziehung kategorisch damit rechnen dürfen, dass die Treue – koste es, was es wolle – gehalten werde«, so Arnd Pollmann.4 Demnach besteht der Verrat aus der einseitigen Aufkündigung dieses Treueverhältnisses, etwa durch die Preisgabe bedeutender Fakten, die aus der Sicht des Verratenen geheim hätten bleiben müssen. Durch die Weitergabe der geheimen Informationen an Dritte (oder eine Institution) wird aus dem ursprünglichen Treueverhältnis eine unmoralische Dreiecksbeziehung, was den Verrat übrigens von einem Wortbruch unterscheidet, der diese Instanz des Dritten nicht involviert. Pollmann definiert treffend: »Zu einem Verrat kommt es, wenn vertrauliche, durch eine Loyalitätsbeziehung geschützte Informationen, die geeignet sind, der jeweils hintergangenen Person oder Personengruppe gravierende Nachteile zu bescheren und eben dadurch das bestehende Loyalitätsverhältnis zu zerstören, heimlich, d. h. ohne Zustimmung, an Dritte weitergereicht werden.«5 Wenn die Preisgabe der Geheimnisse allerdings unter Zwang, etwa Folter oder Erpressung, geschieht, der Preisgeber die Nachteile für die hintergangene Vertrauensperson also keineswegs gewollt hat, können wir zwar von Verrat reden und diesen auch verurteilen, sollten aber den Auslöser des Vorgangs, den Verräter, nicht allzu streng verdammen.
Zur Semantik des Verrats an einer Gruppe oder Institution gehört eine spezielle duale Struktur: Es gibt stets diejenigen, die dem verabredeten politisch-moralischen Code treu, sozusagen daheim geblieben sind; und auf der anderen Seite die Abweichler, die Nest-Flüchtigen, die Verräter der Truppe. Die Treuen verurteilen die Abweichler als Verräter; die Abweichler selbst sehen sich ganz anders: als Revolutionäre, Erneuerer, produktive Zerstörer verkrusteter Strukturen, mutige Enthüller unwürdiger oder gar gefährlicher Geheimnisse. Die Identität der beiden Gruppen ist selten so kompakt, die Motive ihrer Akteure sind selten so eindeutig, dass die Analyse bei der ursprünglichen Zweiteilung in Bleibende und Flüchtige, Heim-Treue und Fremdlinge stehen bleiben darf. Die Fronten wechseln wie die Identitäten. Dieses Verrats-Geschehen ist besonders verwirrend.
Die häufigsten Verräter-Typen sind Spione, Doppelagenten, Denunzianten, Konvertiten, Renegaten, Überläufer, Ausplauderer von Geschäftsgeheimnissen, Hochverräter, Ketzer, Abtrünnige von Freundeskreisen, Vereinen, Ämtern, Geheimbünden, Ehebrecher. Im Ehebruchs-Dreieck ist der profitierende Dritte diejenige Person, mit der einer der Ehepartner die Ehe bricht. Der Code, der hierbei desavouiert wird, ist das bei der Eheschließung gegebene Treue-Versprechen und das meistens als ausschließlich, wenn nicht »absolut« empfundene emotionale Zweierbündnis, das sich im Lauf der Zeit gebildet hat.
Besonders kompliziert ist die Abgrenzung zwischen gängigem Verräter und denunziatorischem Verräter. Der Denunzierte ist nicht, wie der Verratene im landläufigen Sinn, notwendig eine Vertrauensperson des Denunzianten. Die römische denuntiatio meint schlicht eine »Mitteilung an das Gericht«. Der Begriff des »Denunzianten« wurde bis ins 19. Jahrhundert hinein wertneutral gebraucht, im Sinne einer prozessrechtlichen Bestimmung. Noch im späten 18. Jahrhundert ist die Rede vom »Amt eines Denuncianten« wie von einer Vorform der Staatsanwaltschaft, wobei es etwa um das Anzeigen, um den »geheimen Angeber« eines Betrugs bei der für die öffentliche Ordnung zuständigen Obrigkeit geht. Wer so denunzierte, tat etwas Nützliches, geriet freilich insofern rasch in schlechtes Licht, als die Methode, mit der er seine Beweise beschafft hatte (Belauschen eines Gesprächs, Diebstahl von Akten?), oder auch die Motive, aus denen er zum »Angeber« geworden war (Rachsucht, Karrieregründe, Gier nach Belohnung), sowie die mit dem Anzeigen verbundene Heimlichtuerei und womöglich auch der Bruch einer zugesagten Verschwiegenheit als moralisch anrüchig galten. Ein auch vor Gericht als Zeuge akzeptierter Denunziant musste eigentlich einen unbescholtenen Ruf haben und durfte offensichtlich nicht aus privatem Interesse, sondern sollte möglichst glaubwürdig vor allem um der Gerechtigkeit willen ein Vergehen anzeigen. Daneben war durchaus schon der eindeutig negativ besetzte Begriff der »Verrätherey« gebräuchlich, etwa für das Abrücken von einem vorher geleisteten Eid.
Der Soziologe Michael Schröter hat die »Wandlungen des Denunziationsbegriffs« genau rekonstruiert.6 Schröter illustriert den technisch-juristischen Sinn des alten Denunziations-Begriffs mit folgendem Fall aus dem Jahr 1804, den er der 1831 von J. D. F. Neigebaur verfassten »Geschichte der geheimen Verbindungen der neuesten Zeit« entnimmt: Einige preußische Offiziere streiten sich in einem Ausflugslokal an Pfingsten mit den Inhabern des Wirtshauses. Ein Leutnant hat einen Stuhl umgeworfen, woraufhin ihn die Wirtsfrau einen »dummen Jungen« nennt. Er fühlt sich provoziert und stößt sie zu Boden. Ihr Mann springt ihr bei und bezichtigt die Gäste der beleidigenden »Stänkerei«. Daraufhin wird er mit einem Degen bedroht und als »Hund« beschimpft. Nach der »Denunciation«, also der Anzeige der Wirtsleute, werden die Streithähne vor Gericht verhört. Der Leutnant, der den Wirt mit dem Degen bedrohte, beendet seine Aussage mit den Sätzen: »Ich glaube daher, dass nach Vorstehendem die Denuncianten nicht im geringsten berechtigt sein, eine gesetzliche Genugthuung zu verlangen, da mein Betragen erst durch ihre Grobheiten und Beleidigungen herbeigeführt worden, und bitte daher die Denuncianten mit ihrer angebrachten Denunciation gänzlich abzuweisen.« Der Leutnant führt dann eine »Gegenbeschwerde« gegen die Wirtsleute auf, das Gericht verhandelt nunmehr eine »De- und Redenunciationssache« – der Fall endet wie das Hornberger Schießen.
Das »Anzeigen« bestimmter Vergehen bei der Obrigkeit ist erst dann durchweg anrüchig, wenn diese Obrigkeit nicht als gutartig gilt oder sogar zu einem offensichtlichen Unrechtsregime gehört. Erst hier kommen die Begriffe »Verrat« und »Denunziation« (pejorativ verstanden) zur Deckung, wie es zum Beispiel das berühmte Diktum des »Deutschlandlied«-Dichters Hoffmann von Fallersleben impliziert: »Der größte Lump im ganzen Land/das ist und bleibt der Denunziant.« Hoffmann von Fallersleben gehört zu jenen libertären Patrioten des 19. Jahrhunderts, die den Kampf um die politische Einheit der deutschen Lande primär als Freiheitskampf – gegen Napoleon, gegen Zensur und andere Repressionen der preußischen oder habsburgischen Obrigkeit – verstanden haben.
Einer, der die libertären Ideale dieser ungestümen, durchaus nicht reaktionären Patrioten, etwa des berühmten Pädagogen und »Turnvaters« Friedrich Ludwig Jahn, verhöhnt und offen seine Sympathie mit den gestrigen Monarchen in Wien und Berlin bekennt, ist der Vielschreiber August Kotzebue (1761 bis 1819). Er zeugte mit drei Ehefrauen nicht weniger als 17 Kinder und schrieb 38 ernste Theaterstücke sowie 45 Lustspiele. Im Liberalismus der jungen Deutschen sah er, der eine Zeitlang dem russischen Zaren als Generalkonsul diente, eine »Brutstätte der Revolution«. 1819 wird Kotzebue von einem Jenaer Burschenschaftler und Theologiestudenten erstochen. Der Mörder soll dabei gerufen haben: »Hier, du Verräter des Vaterlands!« – 1819!
»Verräterei, als Keim aller Laster, vereinigt auch die Abscheulichkeit aller in sich«, vermerkt ein schweizerischer Publizist im Revolutionsjahr 1848. Es ist jene turbulente Zeit, in der zwei Nationalversammlungen – eine preußische in Berlin und eine reichsdeutsche in der Frankfurter Paulskirche – um erste halbwegs republikanische Verfassungen für die von Königen, Fürsten und Herzögen aller Art hierarchisch gelenkten deutschen Lande ringen. Die vielstimmigen, langwierigen Debatten der meist akademisch gebildeten Parlamentarier werden schrill und wüst begleitet von allerlei Straßen- und Barrikadenkämpfen, Truppenbewegungen, Hungerrevolten und wütenden Bürgerversammlungen zwischen Paris, Prag, Wien, Berlin, Frankfurt, München, Dresden, Karlsruhe und Offenburg. Da kommt es schon mal vor, dass badische Aufständische – überwiegend (klein-)bürgerlichen Standes – unter Anleitung des linken Anwalts Friedrich Hecker Pressefreiheit und Volksbewaffnung fordern, zur Gründung libertärer »vaterländischer Vereine« aufrufen und von Konstanz aus einen Protestmarsch mit etwa 800 bewaffneten Revoluzzern in Richtung Karlsruher Residenz unternehmen – den berühmten »Heckerzug«. Und dass sie dann von Soldaten des Bundesheeres, mehrheitlich preußischen, zusammengeschossen werden. Hecker setzt sich im Herbst des Jahres ab in die Vereinigten Staaten, er wird Farmer. Er kultiviert wild wachsende Weinreben, die der Reblaus widerstehen, und schickt Kerne der betreffenden Trauben nach Deutschland, wo die Reblaus den Winzern gerade sehr zu schaffen macht. Später befehligt er im amerikanischen Bürgerkrieg als Offizier ein Freiwilligenkorps deutscher Ausgewanderter, die für die Nordstaaten – und gegen die Sklaverei – kämpfen. Hecker hat sein badisches Vaterland verraten, um seinen sozialen und freiheitlichen Überzeugungen treu bleiben zu können. Ein Vaterlandsverräter, der Respekt verdient.
Ein gutes Jahrhundert nach dem »Heckerzug« etablierte sich auf deutschem Boden ein linkssozialistischer Staat, der sich gern auf Leute wie Hecker berief, aber dabei das libertäre Element seiner Überzeugungen unterdrückte. Dieser Staat beschäftigte den Verräter als Staatsdiener: die sogenannte Deutsche Demokratische Republik. In den letzten Jahren vor 1989 hatte sich die Staatssicherheit der DDR rund 300 000 Bürger als hauptberuflich oder nebenberuflich tätige Spitzel verpflichtet, die meisten davon als »Inoffizielle Mitarbeiter« (IM). Sie sammelten unter einem oder mehreren Decknamen vertrauliche Informationen über Arbeitskollegen, Nachbarn, sogar über Freunde und Familienmitglieder und gaben sie weiter an die »Firma«, wie das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) genannt wurde. Dabei war vorrangig gefragt, wie solidarisch der Ausgehorchte über das Regime und seine Ideologie dachte. Es handelte sich um ein absurd aufgeblähtes System der Gesinnungsschnüffelei, des willkommenen Verrats. Ohne den willkommenen Verrat bleiben diktatorische Regierungen selten lange an der Macht.
Die Verräter in diesem System sind zunächst simple Denunzianten, die auch ihnen fremde Personen an ihre Führungsoffiziere der Staatssicherheit verpfeifen. Sobald die Verratenen dem Verräter mehr oder weniger nahestehen, werden aus den schlichten Denunzianten Verräter von bisweilen dramatischer Intensität, die etliche Akteure in die moralische Selbstzerstörung geführt hat. Der Fall des Dichters Sascha Anderson ist in dieser Hinsicht besonders krass.
Der 1953 geborene Lyriker und Layouter hat von 1975 bis zum Ende der DDR 1990 – nach 1986 sogar von West-Berlin aus – über Autoren und Künstler, mit denen er im Rahmen der berühmten, als rebellisch geltenden Berliner »Prenzlauer-Berg-Szene« befreundet war, zum Teil intimste Details an die Staatssicherheit berichtet. Er war unter verschiedenen Decknamen wie »David Menzer« oder »Peters« fest verpflichteter »Inoffizieller Mitarbeiter« (IMB – das »B« steht für »Feindberührung«) des DDR-Spitzelapparates. Einige Male hat er die von ihm Bespitzelten auch noch durch Affären mit deren Ehefrauen zusätzlich betrogen und so allerlei Intimes ausgespäht; so im Fall des Liedermachers Ekkehard Maaß, bei dem er eine Weile wohnen durfte. Zu den von ihm Observierten gehören der Maler Ralf Kerbach sowie die Schriftsteller Elke Erb, Wolfgang Hilbig und Uwe Kolbe.
Mit der politisch unbequemen, originellen Malerin Cornelia Schleime, die er ebenfalls regelmäßig und gründlich für die Stasi abgeschöpft hat, war er jahrelang in einer engen Liebesbeziehung verbunden. Schleime hat darüber eindrucksvoll zornig geschrieben in dem Roman »Weit fort« (2008). Aufgedeckt wurde Andersons Stasi-Karriere im Herbst 1991: Erst durch die satirische Titulierung als »Sascha Arschloch« in Wolf Biermanns Dankrede für den Georg-Büchner-Preis; und dann in einer fünfteiligen »Spiegel«-Serie »Landschaften der Lüge« von Jürgen Fuchs. Der Autor und Psychologe Fuchs (1950 bis 1999) konnte aus echten Stasi-Akten zitieren und alle Vorwürfe gegen Anderson belegen, aus Akten, die in der Wendezeit 1989/90 von DDR-Bürgerrechtlern gesichert worden waren – viele Unterlagen hatte die Stasi selbst 1989 ja noch eilends geschreddert. Biermann hat Andersons Verstrickung als erster öffentlich angesprochen. Er wurde daraufhin von Günter Grass als Großinquisitor attackiert, auch sonst nahm die deutsche Feuilletonpresse (etwa »Die Zeit«) den Angriff des wortmächtigen Liedermachers auf einen »dadaistelnden« (Biermann) Nachwuchs-Lyriker überwiegend recht ungnädig auf, indem sie Biermann unterstellte, er übertreibe und für seine Behauptung fehlten ihm die Beweise. Als die im »Spiegel« publizierten Aktenvermerke diese Beweise – den entscheidenden teilte man mit ironischem Understatement in einer Fußnote mit – nachlieferten, hat außer einem einzigen Fernsehjournalisten niemand von den Bedenkenträgern bei Biermann Abbitte geleistet. In seiner Autobiographie »Warte nicht auf bessre Zeiten!«7 vermutet Biermann wohl zu Recht, der Grund dafür könne, neben dem »Ethos der Unschuldsvermutung«, nicht zuletzt »die Kränkung« gewesen sein, »auf einen politischen Trickbetrüger reingefallen zu sein«. Anderson war – ausgerechnet – Anfang der 1970er Jahre wegen der Verbreitung einiger Biermann-Texte auf Flugblättern vorübergehend inhaftiert worden. Wahrscheinlich hatte die Staatssicherheit bei dieser Gelegenheit seine Anwerbung eingeleitet. Anderson war als Spitzel keine kleine »Feldmaus« (Günter Kunert zu Beginn der Affäre), sondern für Stasi-Chef Mielke »ein Superspitzel«, wie Jürgen Fuchs bezeugt hat, der selbst von diesem Spitzel noch in West-Berlin bearbeitet wurde. Anderson lebt heute im Taunus als Layouter und ist verheiratet mit der Schriftstellerin Alissa Walser.
Bernhard Schlink8 urteilt, die Schärfe und Verachtung, mit der Biermann Andersons Doppelleben als Künstlerfreund und Spitzel anprangerte, habe seinerzeit »gewirkt, als stamme sie aus einer anderen Zeit, einer Zeit der tieferen Loyalitäten, tieferen Überzeugungen und größeren Leidenschaften«. Schlink: »Die große Zeit des Verrats ist vorbei«, denn vorbei sei auch die Zeit der »großen Loyalitäten«, in denen sich »unsere Identität« konstituiere und ihre »Wahrheit« zeige und bewähre. Loyalitäten würden heute – parallel zum schleichenden Vertrauensschwund gegenüber traditionellen Institutionen und Verpflichtungen – »leichter genommen« als früher. Entsprechend verliere die Ächtung des Verrats viel von ihrer alten, normativen Kraft. Letztlich beweise die Empörung über Verrat nur noch die »Sehnsucht nach der tiefen Überzeugung«, die es kaum noch gebe. Schlink verrät, indem er bei dieser Gelegenheit von der vergleichsweise harmlosen Partner-Verletzung durch den »Seitensprung« spricht, dass er die Entwicklung, die er teilweise korrekt beschreibt, letztlich nicht so schlimm findet und insofern in ihrer Bedeutung klar unterschätzt.