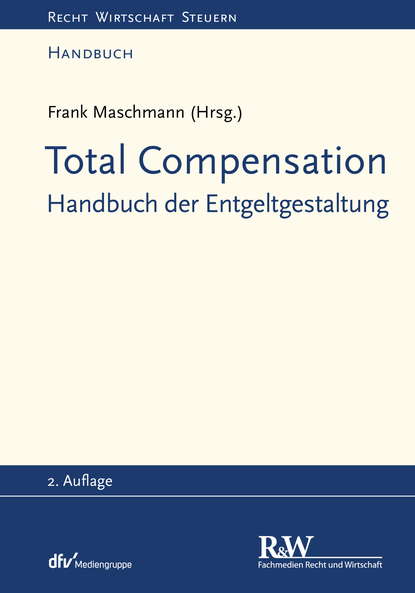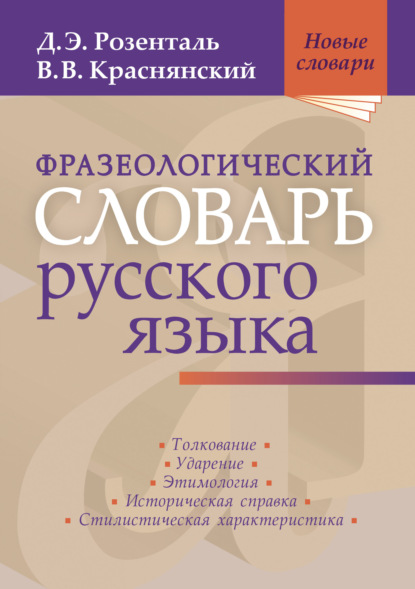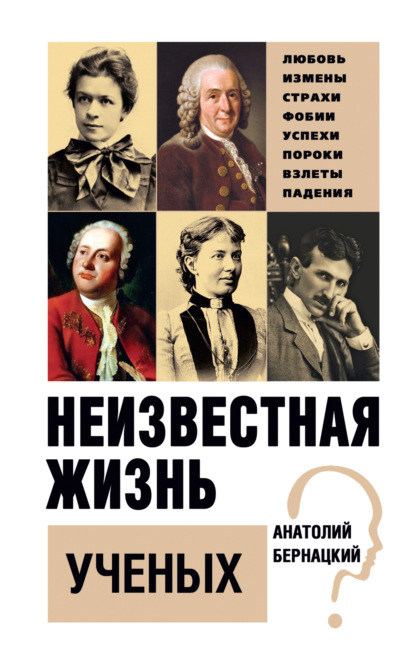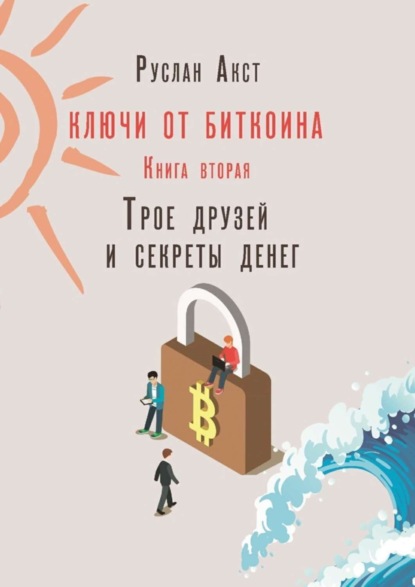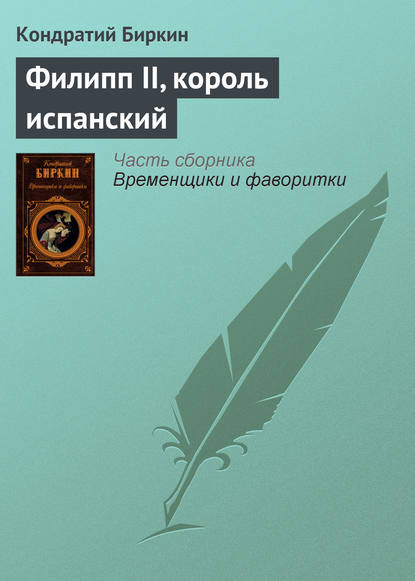Compliance-Handbuch Kartellrecht
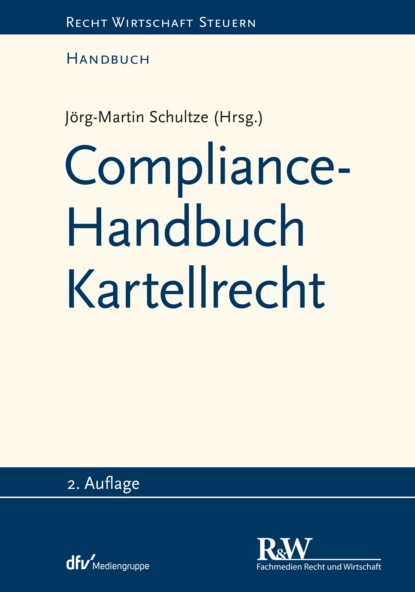
- -
- 100%
- +
Das Bundeskartellamt hat am 20.8.2012 eine Geldbuße in Höhe von EUR 8,2 Mio. gegen die TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH (TTS D), wegen eines unzulässigen vertikalen Preisbindungssystems mit Druckausübung verhängt. Nachdem das Bundeskartellamt bereits im Jahr 2008 Beschwerden von Händlern erhalten hatte, die TTS D vorwarfen, sie unter der Androhung von Repressalien zur Einhaltung von Festpreisen zu zwingen, kontaktierte das Amt zunächst das Unternehmen. Nachdem die Beschwerden anhielten, eröffnete das Bundeskartellamt 2011 ein Verfahren. Anstatt das Unternehmen auf Beweise zu durchsuchen, startete das Amt eine Vernehmungsserie von Händlern als Zeugen204 des Preisbindungssystems. Diese waren als Zeugen nun verpflichtet, wahrheitsgemäß und vollständig zur Sache auszusagen.
Das Amt ermittelte aufgrund der Zeugenaussagen, dass das Preisbindungssystem mit Druckausübung durch TTS D zumindest seit dem Jahr 2000 angewendet wurde. Von den Händlern wurde die strikte Einhaltung der „unverbindlichen Preisempfehlung“ gefordert. Nötigenfalls wurde mit Drohungen gearbeitet – die Händler mussten mit Konditionenverschlechterung (Herabsetzung bis auf 0 % Einkaufsrabatt) bzw. der Kündigung ihres Vertrags rechnen. Dies wurde von den Außendienstmitarbeitern sowie von deren Vorgesetzten stets mündlich kommuniziert, um den Nachweis zu erschweren. Teilweise wurden die Drohungen tatsächlich umgesetzt, wenn Händler die UVP nicht einhielten. Die Kontrolle der Wiederverkaufspreise wurde durch Testkäufe von TTS D selbst überprüft. Außerdem gingen die Außendienstmitarbeiter den Beschwerden „preistreuer“ Händler nach und ließen sich von abweichenden Händlern z.B. deren Rechnungsunterlagen vorlegen. Händler mussten zudem ihre Werbemaßnahmen mit dem jeweiligen Gebietsverkaufsleiter der TTS D vorher abstimmen.
179
Aus der jüngeren Vergangenheit ist insbesondere ein Bußgeldkomplex der Kommission aus 2018 geeignet, die ganze Bandbreite der „modernen Preisbindung“ aufzuzeigen.205 Die Entscheidungen dokumentieren sehr klar, dass es keine kartellrechtlich zulässige Interventionsmöglichkeit für Hersteller gegenüber Händlern gibt, um ein gewünschtes Preisniveau „zu sichern“. Dies gilt in verstärktem Maße in einem Wettbewerbsumfeld wie dem Online-Handel, in dem die Händlerschaft aufgrund der Nutzung von Algorithmen und Software besonders sensibel auf aggressive Angebote von Wettbewerbern reagiert, diese nahezu in Echtzeit beobachten und natürlich den Hersteller selbst durch Nachforderungen eigener Bezugskonditionen oder die direkte Aufforderung zur Intervention gegenüber anderen Händlern fortwährend unter Druck setzen kann. Um nicht in einen Strudel von Kartellrechtsverstößen zu geraten, sind klare Vorgaben zur richtigen Marschroute gefordert, die auch die Unternehmenskommunikation einschließen.
180
Die Kommission hat am 24.7.2018 in vier verschiedenen Verfahren die Elektronikkonzerne Asus, Denon & Marantz, Philips und Pioneer mit Gesamtbußgeldern von EUR 111 Mio. für illegale Preisbindung gegenüber ihren Händlern in verschiedenen EU Mitgliedstaaten belegt. Die Unternehmen nahmen unabhängig voneinander vertikale Preisbeschränkungen in Form von Fest- oder Mindestpreisbindungen vor, indem sie die Möglichkeiten ihrer Online-Einzelhändler beschränkten, die Einzelhandelspreise für gängige Elektronikprodukte wie Küchengeräte, Notebooks und Hi-Fi-Geräte eigenständig festzulegen. Die vier Hersteller schalteten sich besonders bei Online-Einzelhändlern ein, die ihre Produkte zu niedrigen Preisen anboten. Wenn sich diese Einzelhändler nicht an die von den Herstellern verlangten Preise hielten, sahen sie sich mit Drohungen oder Sanktionen konfrontiert, wie etwa einem Belieferungsstopp. Viele Online-Einzelhändler, auch die größten, setzen Preisalgorithmen ein, durch die ihre Einzelhandelspreise automatisch an die Preise der Wettbewerber angepasst werden. Daher wirkten sich die Beschränkungen für die Online-Einzelhändler des Niedrigpreissegments auf die gesamten Online-Preise aus. Die Hersteller konnten durch hochentwickelte Überwachungssoftware die Wiederverkaufspreisbildung im Vertriebsnetz verfolgen und im Falle von Preissenkungen rasch eingreifen. Alle vier Unternehmen arbeiteten mit der Kommission zusammen. Ihre Geldbußen wurden von der Kommission entsprechend dem Umfang dieser Zusammenarbeit um 40 % (für Asus, Denon & Marantz und Philips) bzw. 50 % (für Pioneer) ermäßigt. Asus erhielt danach eine Geldbuße von EUR 63,5 Mio., Denon & Maranz von EUR 7,7 Mio., Philips von EUR 29,8 Mio., und Pioneer von EUR 10,2 Mio.
181
Die Entscheidungen sind mit Beispielen für belastende interne und externe Unternehmenskorrespondenz gespickt, die die Preisbindungsstrategien der Hersteller dokumentieren.
1.3 Weiterverkaufsverbote
182
Ein Per-se-Verbot an den Abnehmer einer vertikalen Vereinbarung, Vertragsprodukte außerhalb des zugewiesenen Vertragsgebietes oder einer zugewiesenen Kundengruppe zu verkaufen, ist ebenfalls eine kartellrechtswidrige Kernbeschränkung. Wie bei Preisbindungen ist das Risiko von Bußgeldern bei der Vereinbarung kartellrechtswidriger Gebiets- oder Kundenbeschränkungen hoch.206 Dies gilt insbesondere, wenn der grenzüberschreitende Handel durch ein Weiterverkaufsverbot betroffen ist, da die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes zu den erklärten Zielen der Kommission gehört.207
Die Kommission verhängte bereits im Oktober 2002 gegen den japanischen Videospielhersteller Nintendo und sieben seiner offiziellen europäischen Vertriebshändler Geldbußen in Höhe von insgesamt EUR 167,8 Mio. wegen der Einschränkung des Parallelhandels.208 Unter der Anführerschaft von Nintendo hatten die Unternehmen die Absprache getroffen, die Ausfuhr von Produkten aus Niedrigpreis- in Hochpreisländer zu verhindern und so die Preisunterschiede innerhalb des EWR künstlich hochzuhalten. Zwischen den Mitgliedstaaten unterschieden sich die Preise für bestimmte Spielekonsolen zeitweise um bis zu 65 %. Im Rahmen der Absprache verhinderten die Vertriebshändler Grauexporte aus ihren jeweiligen Gebieten, d.h. Exporte über inoffizielle Vertriebswege. Einzelhändler, die Parallelexporte durchgehen ließen, wurden durch Einschränkung der Lieferungen oder Lieferboykott „bestraft“. Das Bußgeld ist das bisher höchste, das die Kommission je für eine vertikale Zuwiderhandlung verhängt hat.209
183
Ein weiteres praxisrelevantes Beispiel liefert die bereits zuvor angesprochene Bußgeldentscheidung der Kommission gegen den Elektronikkonzern Pioneer.210 Das Unternehmen hatte nicht nur die Preise für seine Produkte Händlern gegenüber gebunden, sondern auch Parallelhandel kartellrechtswidrig beschränkt. In ihrer Bußgeldentscheidung hat die Kommission zahlreiche Auszüge aus interner Originalkorrespondenz im Unternehmen veröffentlicht, die die Strategie des Unternehmens genau beschreiben. Diese Korrespondenz ist nicht nur eine erneute Ermahnung an Unternehmen, Weiterverkaufsverbote und Parallelhandelsverbote zu unterlassen, sondern belegt auch, wie fatal eine unvorsichtige interne Korrespondenz über Kartellrechtsverstöße ist.
So schreibt unter anderem ein Mitarbeiter von Pioneer France an die Obergesellschaft Pioneer Europa und die Schwestergesellschaft Pioneer Scandinavia wegen Produktlieferungen nach Frankreich (in freier Übersetzung der englischen Originalentscheidung): „Dies ist das dritte Mal, dass wir Produkte in der Rue du Commerce gefunden haben, die von [Händler R] stammen und jedes Mal stelle ich mir vor, wie viele Male dieser [Händler R] tatsächlich hier verkauft, ich nehme nicht an, dass es sich nur um 1 bis zwei Teile handelt. Nun reicht es. Ich muss wissen, was die Situation ist und natürlich welche starken Maßnahmen Pioneer Europe gegen [Händler R] einleiten wird. [...]“ Ein Mitarbeiter von Pioneer Europa schreibt daraufhin an einen Mitarbeiter von Pioneer Skandinavien: „Lieber [...], Leiten Sie sofort die erforderlichen Maßnahmen ein“. Der Mitarbeiter von Pioneer Skandinavien entschuldigt sich daraufhin beim Mitarbeiter seiner Muttergesellschaft Pioneer Europa wie folgt: „Lieber [...], ich bedauere die Umstände, die dies auf dem französischen Markt verursacht haben. Wir haben keine Intention, lokal auf diese Weise hinzuzugewinnen [...] Wir haben inzwischen die Zusage des Händlers, dies einzuhalten und er hat dies akzeptiert. Das Produkt wird nur noch durch sein eigenes Shop Netzwerk vertrieben [...] Bitte informieren Sie mich sofort, sollte es dennoch irgendwo auftauchen.“
184
Art. 4 lit. b Ziff. i der Vertikal-GVO sieht praxisrelevante Ausnahmen vom Totalverbot der Gebiets- oder Kundenkreisbeschränkung für den sog. Alleinvertrieb oder exklusiven Vertrieb211 sowie für selektive Vertriebssysteme212 vor. Diesen Ausnahmen ist gemein, dass sie wörtlich und damit eng zu verstehen sind, eine Interpretation ihrer Grenzen also stets mit hohen Risiken behaftet sind. Des Weiteren kommt das Eingreifen der Ausnahmen nur dann in Betracht, wenn die Voraussetzungen für ein exklusives bzw. selektives Vertriebssystem im Sinne der Vertikal-GVO überhaupt vorliegen.
185
In einem Alleinvertriebssystem darf der Lieferant einem Händler bzw. Abnehmer nach Art. 4 lit. b Vertikal-GVO den aktiven Verkauf, d.h. die aktive Ansprache einzelner Kunden,213 in dem Gebiet bzw. an die Kundengruppe untersagen, die sich der Lieferant selbst exklusiv vorbehalten oder die er exklusiv einem anderen Händler zugewiesen hat (sog. Exklusivgebiete oder Exklusivkundengruppen). Dadurch dürfen Kunden des Händlers jedoch nicht im Weiterverkauf beschränkt werden. Stets frei bleiben muss zudem der sog. passive Vertrieb, d.h. die Reaktion auf unaufgeforderte Kundenbestellungen, zu dem auch der Internetvertrieb mittels einer Webseite zählt. In der Praxis bedeutet dies, dass ein absoluter Gebiets- oder Kundenschutz im Alleinvertriebssystem nicht möglich ist. Versuche, diesen durchzusetzen, sind mit hohen Risiken verbunden.
186
Auch in Vertriebsverträgen neueren Datums finden sich in der Umsetzung dieser Vorgaben grobe Fehler, weil die Voraussetzungen der Vertikal-GVO missverstanden oder ignoriert werden. So wird z.B. ein aktives Weiterverkaufsverbot ausgesprochen, obgleich es innerhalb der EU überhaupt keine oder keine durchgängig exklusiv zugewiesenen Kundengruppen oder Gebiete gibt; oder es wird ein Weiterverkaufsverbot vereinbart, ohne dass in erforderlicher Weise zwischen dem aktiven, d.h. vom Vertreiber selbst veranlassten Verkauf und dem passiven Vertrieb, d.h. der Reaktion auf unveranlasste Kundenanfragen unterschieden wird. Schließlich wird der Händler nicht selten unzulässig verpflichtet, ein für ihn gültiges aktives Weiterverkaufsverbot auch an seine Abnehmer weiterzugeben.214
187
Im selektiven Vertrieb muss es dem Händler stets freistehen, innerhalb des Gebiets, für das der selektive Vertrieb gilt, alle Endkunden, ungeachtet ihres Wohnsitzes, zu beliefern. Sowohl die aktive als auch die passive Weiterverkaufsbeschränkung ist innerhalb des Systems damit eine unzulässige Kernbeschränkung. Der Händler muss zudem frei bleiben, Querlieferungen an und Querbezüge von anderen zugelassenen Händlern im System zu tätigen, auch wenn diese in anderen Ländern angesiedelt sind. Ein Weiterverkaufsverbot innerhalb des selektiven Vertriebssystems ist damit auf den Verkauf an nicht zugelassene Händler beschränkt.215
188
Wie im Falle der Preisbindung ist auch im Hinblick auf Weiterverkaufsbeschränkungen sorgfältig darauf zu achten, dass Exportbeschränkungen nicht indirekt vereinbart werden. Als indirekte Exportbeschränkungen qualifizieren u.a. die duale Preisstellung (d.h. die Vereinbarung höherer Preise für Produkte, die der Abnehmer exportiert, bzw. günstigerer Preise für vom Abnehmer im Inland vertriebene Produkte),216 die Verweigerung von Rabattgewährung für im Ausland verkaufte Produkte,217 Gewinnausgleichsverpflichtungen für Exporte an die in diesem Gebiet ansässigen Vertreiber218 oder Verweisungspflichten für Kundenanfragen von außerhalb des zugewiesenen Gebiets bzw. der zugewiesenen Kundengruppe.219 Von der Kommission als indirekte Exportbeschränkung gewertet wird auch die herstellerseitige Zusage von Garantieleistungen, die nur im Ursprungsland ihre Gültigkeit haben.220 Auch Verwendungsbeschränkungen stellen, etwa in der Form, dass der Abnehmer ein Produkt nur zur Weiterverarbeitung oder zum Eigenbedarf erwerben darf, eine unzulässige Weiterverkaufsbeschränkung dar.221
189
Angesichts von Bußgeldern nationaler Behörden außerhalb der EU, wie insbesondere der Schweiz,222 ist zudem genau zu prüfen, inwieweit Exportverbote in Nicht-EWR-Länder gegen dortiges nationales Kartellrecht verstoßen und danach ebenfalls bußgeldpflichtig sein können. Ein Verstoß gegen EU-Kartellrecht ist bei Exportverboten außerhalb des EWR nur dann anzunehmen, wenn diese Exportbeschränkungen Reimporte in den EWR verhindern.
1.4 Beschränkungen des Internetvertriebs
190
Die unzulässige Beschränkung des Internetvertriebs stellt eine weitere praxisrelevante Kernbeschränkung in einer vertikalen Vereinbarung dar, die von den Behörden, allen voran dem Bundeskartellamt, scharf sanktioniert wird. Unter kommerziellem Blickwinkel steht die (unzulässige) Beschränkung des Internetvertriebs der (unzulässigen) Preisbindung nahe, da beide Verbote aus kaufmännischer Sicht insbesondere vereinbart werden, um eine gewisse Marken- oder Preispflege zu betreiben und einer unerwünschten Verramschung insbesondere von Markenartikeln entgegenzuwirken.
191
Die Kommission hat sich bereits vor über zehn Jahren dazu entschlossen, die Freiheit des Internetvertriebs als zentrale Voraussetzung für die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes einzustufen und unzulässige Beschränkungen folglich als Kernbeschränkungen zu kategorisieren. An der wichtigen Rolle des Internetvertriebs gibt es weder juristisch noch ökonomisch noch ernsthafte Zweifel. Mittlerweile ist höchstrichterlich bestätigt, dass selbst in einem selektiven Vertriebssystem, in dem der Vertrieb nur über Händler zugelassen ist, die die zumeist strengen qualitativen und/oder quantitativen Kriterien erfüllen, kein Totalverbot der Nutzung des Internets ausgesprochen werden kann.223
192
Die Kommission erlaubt es Unternehmen in ihren Vertikal-Leitlinien zwar, Händlern gegenüber Qualitätsvorgaben für den Internetvertrieb ihrer Produkte zu machen, die umgangssprachlich zumeist als „Internetrichtlinien“ bezeichnet werden. Viele übersehen jedoch, dass diese Qualitätskriterien in ihrer inhaltlichen Reichweite „im Einklang“ mit den Kriterien zum stationären Verkauf stehen müssen, also vereinfacht gesprochen, nicht weitreichender sein dürfen als die sonstigen Verkaufsanforderungen im Ladengeschäft.224 Zu strikte Internetkriterien können also ebenfalls zu einer Kernbeschränkung führen. Die zentrale Rolle des Internetvertriebs gehen allerdings nicht so weit, als dass dem Händler jegliche Verkaufsplattformen für seine Produkte offenstehen müssten. Frei bleiben muss der Vertrieb über eine dem Händler zuzuordnende „eigene“ Webseite. Höchstrichterlich bestätigt ist inzwischen jedoch, dass ein Verbot des Online-Verkaufs über Drittplattformen keine Beschränkung des Internetvertriebs per se ist, also im Rahmen der Vertikal-GVO zulässig ausgesprochen werden kann.225 Nach richtiger Auffassung gilt dies unabhängig von der Art der Produkte, für die der Vertrieb über Drittplattformen untersagt wird. Das Bundeskartellamt vertritt in diesem Punkt wohl nach wie vor eine konservativere Auffassung und sieht die Reichweite des Grundlagenurteils des EuGH in Sachen Coty auf „Luxusprodukte“ beschränkt.226
1.5 Nicht freigestellte Beschränkungen
193
Im Hinblick auf ihre wettbewerbswidrige Wirkung werden Wettbewerbsverbote als „nicht freigestellte Beschränkungen“ gemäß Art. 5 Vertikal-GVO als weniger schwerwiegend als Kernbeschränkungen angesehen. Enthält eine vertikale Vereinbarung eine solche nicht freigestellte Klausel, ist dies in der Regel nicht bußgeldrelevant, sondern führt „nur“ zur Unwirksamkeit der betroffenen Klausel. Das Schicksal der restlichen Vereinbarung bestimmt sich nach nationalem Recht, in Deutschland also nach § 139 BGB. Im Unternehmensalltag besonders relevant ist insbesondere die Frage nach der Zulässigkeit von Wettbewerbsverboten und Bezugsverpflichtungen im Vertriebskontext.
194
Nach Art. 5 lit. a der Vertikal-GVO sind vertragliche Wettbewerbsverbote, die einem Händler auferlegt werden, nur dann automatisch vom Kartellverbot ausgenommen, wenn sie für eine Laufzeit von höchstens fünf Jahren vereinbart werden. Wettbewerbsverbote in Verträgen mit unbestimmter Laufzeit oder mit Regelungen zur automatischen Verlängerung gelten als unbefristete Wettbewerbsverbote und sind damit nicht von der Vertikal-GVO freigestellt.227
195
Die gleiche Regel gilt für Bezugsverpflichtungen, die mehr als 80 % des Bedarfs des Abnehmers an Vertragsprodukten und deren Substituten, bezogen auf seinen jährlichen Gesamtbedarf im letzten abgeschlossenen Kalenderjahr, betreffen.228 Auch diese müssen also für ihre automatische Freistellung auf maximal fünf Jahre befristet oder auf eine Abnahmepflicht von höchstens 80 % begrenzt werden.229
196
Wettbewerbsverbote des Lieferanten in Form von Alleinbelieferungsverpflichtungen unterliegen der zeitlichen Befristung des Art. 5 Vertikal-GVO dagegen nicht. Sofern die Marktanteilsschwellen der Vertikal-GVO nicht überschritten sind, können diese also auch länger vereinbart werden.
197
Nachvertragliche Wettbewerbsverbote sind regelmäßig nicht von der Vertikal-GVO freigestellt, da die sehr engen Freistellungsvoraussetzungen des Art. 5 lit. b Vertikal-GVO nur in den seltensten Fällen erfüllt sind.230
2. Informationsaustausch im Vertikal-Verhältnis
198
Auch der Informationsaustausch im Vertikal-Verhältnis kann zu kartellrechtlichen Problemen führen. Dies gilt insbesondere in der Situation des dualen Vertriebs, in der Lieferant und Abnehmer auf der Vertriebsebene miteinander im Wettbewerb stehen. Über Art. 2 Abs. 4 Vertikal-GVO ist diese Vertragskonstellation zwar nicht vom Schutzbereich der Vertikal-GVO ausgenommen. Allerdings wird von der Vertikal-GVO nur der Informationsaustausch freigestellt, der zur Durchführung der vertikalen Vereinbarung notwendig ist. In einem Liefer- bzw. Vertriebsverhältnis betrifft dies neben den Einkaufsbedingungen der Vertragsprodukte bzw. -dienstleistungen auch Informationen, die notwendig sind, um die Einhaltung der – kartellrechtskonformen – Vertragsverpflichtungen des Händlers überprüfen zu können. Da eine Verhaltenskoordinierung zwischen Anbieter und Abnehmer, die über Beschränkungen hinausgeht, die der vertikalen Vereinbarung zwischen den Parteien geschuldet sind, nicht mehr von der Vertikal-GVO freigestellt ist,231 gilt dies auch für einen Informationsaustausch, der einer Verhaltenskoordinierung zwischen Anbieter und Abnehmer auf der Vertriebsseite dient.232
199
Das Bundeskartellamt hat im Dezember 2012 zudem ein Verfahren gegen die Lufthansa gegen eine Verpflichtungszusage eingestellt, dass das Unternehmen sein Rabattprogramm gegenüber Firmenkunden abändert. Die Teilnahme am Rabattprogramm sah vor, dass Firmenkunden der Lufthansa auch Informationen zu Verkaufsdaten von Flügen übermittelten, die diese mit Wettbewerbern der Lufthansa durchgeführt hatten.233 Das Bundeskartellamt sah in dieser instiutionalisierten bzw. systematischen Nutzung von Kunden für Wettbewerberinformationen eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs und einen Verstoß gegen das Kartellverbot sowie – aufgrund der starken Stellung der Lufthansa – einen Missbrauch von Marktmacht.
200
Wie bereits unter Rn. B 137 dargestellt, ist zudem sorgfältig zu prüfen, ob das Erlangen von Wettbewerberinformationen im Vertikal-Verhältnis Teil eines Hub-and-spoke-Kartells sein könnte, bei dem das im Vertikal-Verhältnis stehende Unternehmen (d.h. der Kunde oder Lieferant) genutzt wird, um einen Informationsaustausch „über Eck“ zwischen zwei Wettbewerbern zu koordinieren.
3. Risikofaktoren Vertikal-Verstöße – Checkliste Compliance
201
Um zu einer Einschätzung zu gelangen, welche Risikofaktoren für das Unternehmen von Kartellrechtsverstößen in vertikalen Vereinbarungen ausgehen, sind die folgenden Fragen ein erster Anhaltspunkt:
Checkliste: Risikofaktoren Vertikal-Verstöße
✓ In welcher Absatzform vertreibt das Unternehmen seine Produkte?
✓ Setzt das Unternehmen selbstständige Händler ein, wenn ja, auf welcher vertraglichen Grundlage?
✓ Ist das Unternehmen neben seinen Händlern für einige Kunden oder Länder oder auch darüber hinaus selbst im Vertrieb aktiv?
✓ Gibt es Standards für Anforderungen an Vertriebsverträge? Können Vertriebsverträge ohne Prüfung durch die Rechtsabteilung/externe Berater verändert werden?
✓ Welche Bedeutung spielt der Preis beim Verkauf an den Verbraucher in der Absatzstrategie des Unternehmens?
✓ Arbeitet das Unternehmen mit unverbindlichen Verkaufspreisen (UVP)? Wenn ja, wie wird der UVP festgesetzt, wie oft wird er verändert? Gibt es verschiedene UVP für verschiedene Absatzformen?
✓ Wie wird der UVP bei Händlern vom Unternehmen thematisiert?
✓ Wird der UVP von den Händlern weitgehend eingehalten?
✓ Was passiert, wenn ein Händler dauerhaft vom UVP abweicht?
✓ Wie reagiert das Unternehmen auf Beschwerden von Händlern über die Preisstrategie anderer Händler?
✓ Weichen die Verkaufspreise von Land zu Land deutlich voneinander ab?
✓ Welche Bedeutung haben kunden- oder gebietsbezogene Weiterverkaufsbeschränkungen im Unternehmen?
✓ Gibt es Mechanismen, mit denen das Absatzverhalten von Händlern im Hinblick auf deren Preise und Weiterverkaufsverhalten überwacht wird?
✓ Setzt das Unternehmen Software zur Preisüberwachung von Händler- oder Wettbewerberpreisen ein?
✓ Gibt es im Unternehmen Versuche, Exporte oder Parallelimporte durch indirekte Maßnahmen wie z.B. länderspezifische Garantien oder Ausgleichszahlungen einzudämmen?
✓ Welche Rolle spielt der Internetvertrieb in der Absatzstrategie des Unternehmens?
✓ Gibt es eine Strategie, Internetverkäufe von Händlern zu kontrollieren? Wenn ja, wie sieht diese aus?
✓ Setzt das Unternehmen exklusive oder nicht-exklusive Händler ein?
✓ Spielen direkte Wettbewerbsverbote oder Mindestabnahmemengen in
✓ der Absatzstrategie des Unternehmens eine Rolle?
✓ Setzt das Unternehmen Kunden oder Lieferanten systematisch zur Informationsbeschaffung über Wettbewerber ein?
188 Siehe unter Rn. B 99ff. 189 Vertikal-GVO, ABl. EU 2010 L 102/1; Vertikal-Leitlinien ABl. EU 2010 C 130/1. 190 Im Hinblick auf Exportbeschränkungen hat die Pharmaindustrie hier zwar gewisse Teilsiege errungen (EuG, Urt. v. 27.9.2006, Rs. T-168/01, Slg. 2006, II-2969, Rn. 214ff. (Glaxo-SmithKline Services Unlimited/Kommission)), dem Grunde nach bestätigt durch EuGH (Urt. v. 6.10.2009, verb. Rs. C-501/06 P, 513/06 P, 515/06 P, 519/06 P, Slg. 2009, I-9291). Die praktischen Anforderungen an den Nachweis der Legalausnahme sind vom EuG aber so hoch angesetzt worden, dass dieser nur in Ausnahmefällen gelingen dürfte. 191 Ausführlich zu vertikalen Beschränkungen und dem Inhalt der Vertikal-GVO Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019. 192 Siehe dazu ausführlicher unter Rn. B 112. 193 Vertikal-Leitlinien, Rn. 18, eingehend dazu Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 294ff. 194 Vertikal-Leitlinien, Rn. 18. 195 Siehe z.B. ein gegen die französische Apothekerkammer ONP verhängtes Bußgeld in Höhe von EUR 5 Mio. wegen der Durchsetzung von Mindestpreisen auf dem französischen Markt für biometrische Analysen, Komm., Entsch. v. 8.12.2010, COMP/39.510 (ONP); Bußgeld gegen Yamaha in Höhe von EUR 2,56 Mio. wegen der Beschränkung des Handels und der Festsetzung von Weiterverkaufspreisen, Komm., Entsch. v. 16.7.2003, COMP/37.975 (Yamaha); ebenso Bußgeld gegen VW in Höhe von ca. EUR 30 Mio. wegen Verlangens von Preisdisziplin der deutschen Händler, Komm., Entsch. v. 2.10.2001, COMP/F-2/36.693 (Volkswagen), allerdings mangels Vereinbarung aufgehoben von EuG, Urt. v. 3.12.2003, Rs. T-208/01. Nach langen Jahren, in denen die Kommission den Mitgliedstaaten die Durchsetzung von vertikalen Verstößen überlassen hatte, meldete sich die Kommission zunächst mit ihrer großangelegten e-Commerce-Sektoruntersuchung und anschließend mit hohen Bußgeldern gegen verschiedene Unternehmen bei der Durchsetzung vertikaler Kartellrechtsverletzungen zurück, darunter Bußgelder in Höhe von EUR 63,52 Mio. gegen den Computerhersteller Asus, Komm., Entsch. v. 24.7.2018, AT. 40465; oder in Höhe von EUR 40 Mio. gegen den italienischen Bekleidungshersteller Guess, Komm., Entsch. v. 17.12.2018, AT. 40428. Für eine umfassenden Nachweis zur Bußgeldpraxis siehe Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 563ff. 196 BKartA, z.B. Bußgelder in Höhe von EUR 10,9 Mio. gegen Wellensteyn und P&C; in Höhe von EUR 4,4 Mio. gegen verschiedene Möbelhersteller; in Höhe von EUR 27 Mio. gegen drei Matratzenanbieter; EUR 8,2 Mio. gegen TTS Tooltechnic; EUR 2,5 Mio. gegen Garmin; EUR 4,2 Mio. gegen Phonak; EUR 11,5 Mio. gegen Ciba Vision sowie EUR 9 Mio. gegen Microsoft jeweils wegen Preisbindungen von Händlern, BKartA Fallbericht v. 8.8.2017; Pressemitteilungen v. 12.1.2017, 22.10.2015, 6.2.2015, 22.8.2014 20.8.2012, 18.6.2010, 15.10.2009, 25.9.2009 und 8.4.2009; Bußgeld in Höhe von ca. EUR 10 Mio. gegen Bayer Vital wegen Einflussnahme auf Apothekenverkaufspreise für OTC-Produkte, BKartA, Pressemitteilung v. 28.5.2008. Für einen umfassenden Nachweis der Bußgeldpraxis des Bundeskartellamtes wie auch verschiedener nationaler europäischer Kartellbehörden siehe Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 563ff. 197 Vgl. BKartA, abschließende Pressemitteilung v. 15.12.2016; zuvor Pressemitteilung v. 18.6.2015; für die einzelnen Verfahren bzw. Verfahrenskomplexe erließ das BKartA jeweils relativ aussagekräftige zusammenfassende Fallberichte, die auf der Webseite des BKartA abrufbar sind: Fallbericht v. 14.12.2016, Az. B 10 – 20/15 (Anheuser Busch InBev) zu den Beschl. v. 16.6.2015, 30.12.2015, 28.4.2016 und 2.12.2016 (nach Einspruchsrücknahme); Fallbericht v. 14.12.2016, Az. B 10 – 040/14 (Haribo) zu den Beschl. v. 19.12.2014, 2.6.2015, 16.6.2015 und 23.2.2016 (nach Einspruchsrücknahme); sowie vorausgehend Fallbericht v. 9.5.2016, Az. B 10 – 20/15 (Bier) zu den Beschl. v. 16.6.2015, 30.12.2015 und 28.4.2016, und Fallbericht v. 18.6.2015, Az. B 10 – 040/14 (Haribo) zu den Beschl. v. 19.12.2014, 2.6.2015 und 16.6.2015; zudem Fallbericht v. 18.6.2015, Az. B 10 – 041/14 (Ritter) zum Beschl. v. 19.12.2014 und Fallbericht v. 18.6.2015, Az. B10 -050/14 (Röstkaffee) zu den Beschl. v. 19.12.2014, 10.6.2015 und 16.6.2015. 198 BKartA, Hinweis zum Preisbindungsverbot im Bereich des stationären Lebensmitteleinzelhandels, Juli 2017. 199 Siehe dazu ausführlich Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 565, 589ff. Dagegen hat die belgische Kartellbehörde am 22.6.2015 einen ähnlich gelagerten Sachverhalt als Hub-and-Spoke-Kartell eingestuft und ihre Ermittlungen mit einem Bußgeld von EUR 178 Mio. gegen 18 Hersteller und Händler im Drogerie-, Parfum und Hygienesektor im Vergleichswege beendet. 200 Siehe für Nachweise zu verschiedenen Bußgeldern und Ermittlungsverfahren Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, 589ff. 201 Vertikal-Leitlinien, Rn. 48; Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 572ff. m.w.N. 202 Vertikal-Leitlinien, Rn. 48. 203 Bußgeld gegen Microsoft, BKartA, Pressemitteilung v. 8.4.2009 und Bußgeld gegen Ciba Vision, Entsch. v. 25.9.2009, Az. B 3 123/08, Rn. 53f. 204 Um Beteiligten den Zeugenstatus zu verschaffen, sichert das Bundeskartellamt ihnen entweder Nichtverfolgung zu oder schließt das Verfahren vorher gegen sie rechtskräftig ab. 205 Komm., Pressemitteilung v. 24.7.2018, sowie Entscheidungen in Sachen AT. 40465 (Asus), AT. 40469 (Denon & Marantz), AT. 40181 (Philips), AT. 40182 (Pioneer). 206 Siehe insoweit Bußgeld in Höhe von EUR 35 Mio. gegen Opel Nederlands, Komm., Entsch. v. 20.9.2000, COMP/36.653, ABl. EU 2001 L 59/1 (Opel); bestätigt vom EuGH, Urt. v. 6.4.2006, Rs. C-551/03 P, Slg. 2006, I-3173; siehe auch Bußgeld in Höhe von EUR 102 Mio. gegen VW, Komm., Entsch. v. 28.1.1998, IV/35.733, ABl. EU 1998 L 124/60 (VW), weitgehend bestätigt vom EuG, Urt. v. 6.7.2000, Rs. T-62/98, Slg. 2000, II-2707, Rn. 162ff., bestätigt durch den EuGH, Urt. v. 18.92003, Rs. C-338/00, Slg. 2003, I-9189. Auch im Hinblick auf Weiterverkaufsverbote hat sich die Kommission nach langer Abwesenheit mit einem Bußgeld gegen die spanische Hotelgruppe Melià und verschiedene Reiseveranstalter in Höhe von EUR 6 Mio. zurückgemeldet, Komm., Pressemitteilung v. 16.3.2020, AT. 40528. 207 So auch Vertikal-Leitlinien, Rn. 7. 208 Komm., Pressemitteilung v. 30.10.2013, IP/02/1584. 209 Der EuG reduzierte das gegen Nintendo verhängte Bußgeld von EUR 149 Mio. auf EUR 119 Mio., siehe Urt. v. 30.4.2009, Rs. T-13/03, Slg. 2009, II-975. 210 Komm., Entsch. v. 24.7.2018, AT. 404182, Rn. 109ff. 211 Ein exklusives Vertriebssystem oder Alleinvertriebssystem im Sinne der Vertikal-GVO setzt voraus, dass der Anbieter seine Produkte in einem bestimmten Gebiet oder an eine bestimmte Kundengruppe ausschließlich an einen Händler verkauft und dieser vor den aktiven Verkäufen anderer Händler in diesem Gebiet/dieser Kundengruppe geschützt wird. Direktverkäufe des Anbieters selbst sind dagegen weiterhin möglich, Vertikal-Leitlinien, Rn. 51ff.; eingehend dazu Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 737ff. 212 Ein selektives Vertriebssystem liegt gemäß Art. 1 lit. d Vertikal-GVO vor, wenn sich der Anbieter verpflichtet, die Vertragswaren- oder Dienstleistungen nur an Händler zu verkaufen, die anhand festgelegter qualitativer und/oder quantitativer Kriterien ausgewählt wurden, und der Händler sich verpflichtet, die betreffenden Waren/Dienstleistungen im für das System festgelegten Gebiet nur an zugelassene Händler zu verkaufen, eingehend dazu Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 759ff. 213 Vertikal-Leitlinien, Rn. 51. 214 Eingehend zu der richtigen vertraglichen Umsetzung Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 737ff. 215 Eingehend zu den Möglichkeiten der Beschränkung im selektiven Vertrieb Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 902f.; siehe auch BKartA, Fallbericht v. 6.5.2014 (WALA). 216 Komm., Entsch. v. 8.5.2001, IV/36.957/F3, ABl. EU 2001 L 301/1 (GlaxoSmithKline), jedoch teilweise aufgehoben durch EuG, Urt. v. 27.9.2006, Rs. T-168/01, Slg. 2006 II, 2969; EuGH, Urt. v. 6.10.2009, verb. Rs. C-501/06 P, 513/06 P, 515/06 P, 519/06 P, Slg. 2009, I-09291. 217 Bußgeld in Höhe von EUR 35 Mio. gegen Opel Nederlands, Komm., Entsch. v. 20.9.2000, COMP/36.653, ABl. EU 2001 L 59/1; bestätigt vom EuGH, Urt. v. 6.4.2006, Rs. C-551/03P, Slg. 2006, I-3173; siehe auch Bußgeld in Höhe von EUR 102 Mio. gegen VW, Komm., Entsch. v. 28.1.1998, Rs. IV/35.733, ABl. EU 1998 L 124/50, auf EUR 90 Mio. reduziert von EuG, Urt. v. 6.7.2000, Rs. T-62/98, Slg. 2000, II-2707, Rn. 162ff. 218 Vertikal-Leitlinien, Rn. 50 S. 4 a.E. 219 Vertikal-Leitlinien, Rn. 50 S. 3 a.E. 220 Vertikal-Leitlinien, Rn. 50 S. 5. 221 Bechtold/Denzel, WuW 2008, 1272ff. 222 Siehe Verfügung der schweizerischen Wettbewerbskommission vom 28.11.2011 gegen Nikon AG (Geldbuße in Höhe von CHF 12,5 Mio.) sowie gegen BMW AG vom 24.5.2012 (Geldbuße CHF 156 Mio.), jeweils für die Behinderung von Direkt- und Parallelimporten. 223 EuGH, Urt. v. 13.10.2011, Rs. C-439/09 (Pierre Fabre). 224 Ausführlich dazu Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 821ff. 225 EuGH, Urt. v. 6.12.2017, Rs. C-213/16 (Coty). 226 Diese Auffassung ist mit der Entscheidung des EuGH und der Dogmatik der Vertikal-GVO jedoch nicht in Einklang zu bringen. Ausführlich dazu Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 821ff. 227 Siehe dazu Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 973ff. 228 Art. 1 Abs. 1 lit. d Vertikal-GVO. 229 Eingehend zur kartellrechtskonformen Vertragsgestaltung Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 86ff. 230 Diese sehen eine Freistellung von nachvertraglichen Wettbewerbsverboten unter anderem nur vor, wenn sich diese auf die Räumlichkeiten beschränken, von denen der Händler die Vertragsprodukte verkauft hat, Art. 5 Abs. 3 lit. a–d Vertikal-GVO. 231 Wiemer, WuW 2009, 750, 757, der darauf verweist, dass die Vertikal-GVO alle beschränkenden Vereinbarungen, die ihrer Art nach horizontaler und nicht vertikaler Natur sind, vom Anwendungsbereich der Vertikal-GVO ausnimmt; weiterführend Schultze/Pautke/Wagener, Vertikal-GVO, 4. Aufl. 2019, Rn. 592ff. 232 Ausführlich dazu Wiemer, WuW, 2009, 750, 757f., der den Vorschlag macht, für die Abgrenzung zwischen (im Rahmen der vertikalen Vereinbarung) freigestelltem und außerhalb der vertikalen Vereinbarung ggf. verbotenem Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern in einer Situation des dualen Vertriebs auf das aus der alten BGH-Rspr. bekannte Kriterium des „anzuerkennenden Interesses“ abzustellen. Nach seiner Auffassung würde in einer Situation des dualen Vertriebs ein anzuerkennendes Interesse für einen Informationsaustausch zwischen Anbieter und Abnehmer nur für solche Daten gelten, die Rückschlüsse auf den Erfolg des Händlers im Markt geben bzw. die Produktionsplanung des Herstellers oder Schulungs- bzw. Unterstützungsmaßnahmen des Hersteller betreffen. 233 BKartA, Fallbericht v. 27.12.2012, Az. B9-96/09.