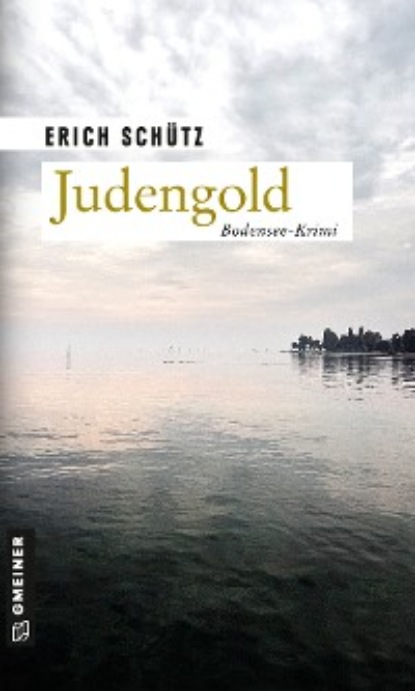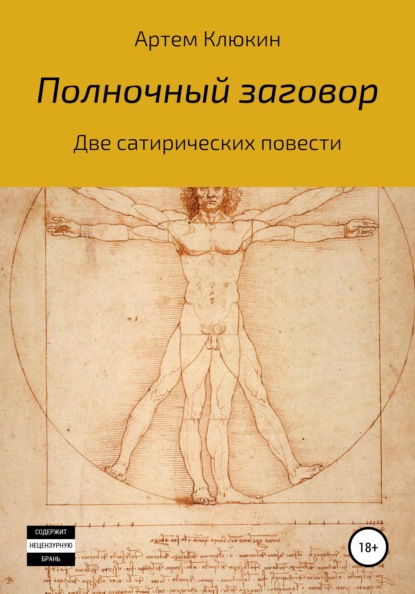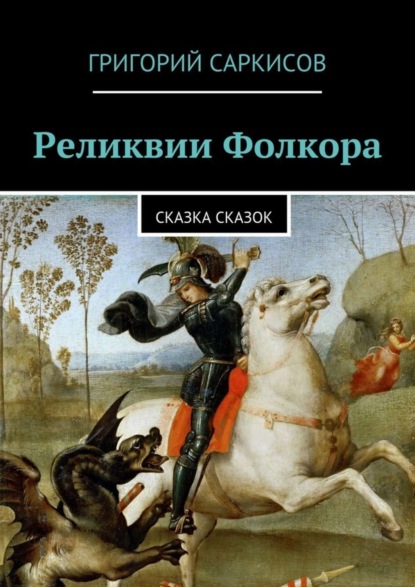- -
- 100%
- +
Er schlenderte an aufgebauten Mikrofonen vorbei bis zur Stirnseite des Saals. Dort stand eine kleine Gruppe deutscher Polizeibeamter zusammen. Wie zufällig gesellte er sich zu ihnen. Dabei hatte er seine Ohren aufgestellt wie ein Luchs auf der Jagd. »Alles Gold und Geld war bisher ordentlich in einer Schweizer Bank deponiert«, hörte er gerade noch einen Polizisten sagen, als dieser zu ihm aufschaute. Sofort unterbrach der Mann seine Ausführungen und schaute Leon auffordernd an: »Was wollen Sie, kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Guten Abend«, Leon Dold stellte sich ordentlich vor, erzählte, dass er freier Journalist sei und neu am Bodensee arbeite, dann fragte er wie nebenbei: »Warum nur haben die Burschen das Gold nicht in Zürich umgetauscht, wo doch dort ein deutlich höherer Kurswert notiert ist?«
»Die Pressekonferenz beginnt in zehn Minuten, so lange müssen Sie sich schon noch gedulden«, fertigte ihn der Polizist ab, ohne auf den Inhalt der Frage einzugehen.
Die Leitung der Konferenz unterstand dem Leiter des Zolls und dem Leiter der Polizei, jeweils zwei gewichtige Regierungsdirektoren. Doch viel Neues wussten auch sie nicht zu berichten. Dafür gab es ein dickes Lob für die schnelle Ergreifung der Täter.
Alle Fragen über etwaige Hintermänner, woher das Geld stammte, wohin es gebracht werden sollte, beschieden die Herren mit der Formel: ›Laufende Ermittlungen‹.
Leon hatte während der gesamten Konferenz die Polizisten im Hintergrund beobachtet. Er hatte genau registriert, wie sie alle auf einen Mann schielten, als der Einsatzleiter für die schnelle Ergreifung der Täter dankte. Der vermeintliche Polizist war auffallend gekleidet. Er sah wie ein Jägersmann, nicht wie ein Polizist aus. Auch sein ansehnlicher Bauchumfang lies eher vermuten, dass der Mann Rehrücken schmorte, als dass er Verbrecher jagte. Er wirkte nach außen sehr gelassen und abgebrüht, trotz der lobenden Worte seiner Vorgesetzten. Aus seinen Augen blitzte kein bisschen Stolz, eher Schalk, als der Einsatzleiter ihm ausdrücklich für die schnelle Ergreifung der Täter dankte. Die Lobesworte schienen diesem Mann eher peinlich zu sein. Ungeschickt steckte er die Hände seiner kurzen Arme in die weit ausgebeulten Taschen seiner alten, etwas vergammelten Kampfhose, die offensichtlich schon mehrere Schlachten erlebt hatte und wohl auch nie richtig gereinigt worden war.
Leon Dold ging nach dem Ende der Konferenz schnurstracks auf ihn zu. Neben diesem Beamten konnte auch er in seinem Outfit bestehen. Leon zählte in seinem Gewerbe nicht zu der Dressman-Fraktion. Da waren die Kollegen Moderatoren und Reporter im On immer besser gekleidet. Sie hatten in den Wintertagen immer einen schicken Trenchcoat oder gelackte Lederjacken für ihre Aufsager dabei. Die ganz Seriösen seiner Zunft banden sich sogar vor jedem Sätzchen vor der Kamera eine Krawatte um. Leon dagegen war zwar nur in Jeans erschienen und mit einem Pulli, doch neben dem Kommissar sah er nun doch außerordentlich gut gekleidet aus. »Gratuliere, Sie also haben die beiden Burschen gefasst.«
Horst Sibold lächelte. »Die Fragezeit ist, glaube ich, beendet«, wich er aus.
»Offiziell ja«, schmunzelte Leon, »aber ich habe auch keine Frage gehört, Ihr Chef hat Sie doch schon als den erfolgreichen Jagdführer vorgestellt, und Ihr Outfit lässt ja auch darauf schließen, dass Sie die Verfolgung der Täter selbst übernommen hatten.«
»Kommen Sie von C&A oder was wollen Sie von mir?«, reagierte Sibold kühl, »es ist doch alles gesagt.«
»Vielleicht für Sie, heute! Aber irgendwann werden auch Sie auf die Frage stoßen, die mir bisher noch niemand beantworten konnte.«
»Und die wäre?« Horst Sibold wurde nun doch zugänglicher, und Leon hatte das Gefühl, dass dieser untypische Beamte vielleicht sein richtiger Ansprechpartner sein könnte: »Warum schmuggelt jemand Gold aus der Schweiz nach Deutschland, wo der Kurs in der Schweiz deutlich höher notiert ist als hier?«
»Eine interessante Frage«, brummte der Kommissar plötzlich hellhörig und bat Leon: »Geben Sie mir Ihre Karte.«
Schnell griff Leon in seine Tasche, kramte ein selbst gebasteltes Visitenkärtchen hervor und setzte nach: »Verraten Sie mir Ihren Namen?«
»Der ist kein Staatsgeheimnis«, lachte Horst Sibold jetzt offensichtlich kollegialer gestimmt und gab Leon ebenfalls eine Visitenkarte, auf die er seine Handynummer notierte. »Die gebe ich nicht jedem, schließlich will man auch als Polizist manchmal seine Ruhe.«
Leon las die Visitenkarte und pfiff durch die Zähne. »Oho, Kriminalhauptkommissar. Ihre Dienstkleidung hätte Sie eher der reitenden Jägergruppe zugeordnet.«
»Tarnen und Täuschen ist unser Job«, lachte Horst Sibold jetzt doch noch zum Scherzen aufgelegt. Leon wurde aus dem schmuddelig wirkenden Kommissar nicht schlau. Doch eine Recherche in unbekannten Teichen war mühevolle Kleinarbeit. Leon war froh, einen ersten Fisch am Haken zu haben, wenn er auch noch nicht wusste, wie er diesen waidmännisch verkleideten Beamten einzuschätzen hatte.
Vielleicht konnte er über ihn doch noch etwas aus der Geschichte herausholen.
*
Leon trat vor das Hauptzollamt und sah, wie die Nachrichtenredakteure ihre Neuigkeiten von der Pressekonferenz hektisch absetzten. Fernsehkollegen schnitten in ihren Übertragungswagen Reporterbeiträge für die Spätnachrichten, andere versuchten weiter, Fachleute und Pressesprecher der Polizei vor ihre Mikrofone zu zerren.
Die Hörfunkkollegen saßen in ihren Reportagewagen und gaben den verschiedensten Nachrichtensendungen ihrer Anstalten Interviews.
Schneller ihre Arbeit erledigt hatten die Kollegen der Tageszeitungen. Sie hatten schon während der Pressekonferenz ihre Meldungen und Reportagen in ihre Laptops getippt und sie dann, per Knopfdruck via Handyleitungen, direkt in die Redaktionen verschickt.
Eine kleine Gruppe der schreibenden Zunft stand jetzt zusammen. Leon gesellte sich zu ihr. Er erhoffte sich einige Hintergrundinformationen, die die Lokalredakteure vor Ort meist besaßen.
Als er bei der Gruppe ankam, schauten ihn die Kollegen nur kurz an, dann redete ihr offensichtlicher Wortführer engagiert weiter: »Das lohnt sich alles nicht mehr. Ich bin jetzt dann den ganzen Tag unterwegs, von heute Morgen um 10 Uhr Pressekonferenz beim OB bis jetzt, spät am Abend. Denkste, ich bekomme deshalb einen höheren Tagessatz?«
»Sei froh, dass du noch mit einem festen Tagessatz rechnen kannst. Unser Verleger hat die Tagessätze gestrichen. Er bezahlt jetzt nur noch nach Zeilen und Artikel. Gleichzeitig hat er aber auch perfide festgelegt, dass kein Artikel länger als 50 Zeilen lang sein darf, da dem Leser mehr nicht zuzumuten ist.«
»Deshalb warst du heute mit deinem Text so schnell fertig«, frotzelte der Wortführer.
»Ja«, grämte sich der Kollege, »aber ich stehe jetzt auch noch hier, das ändert doch am Zeitaufwand gar nichts.«
Leon drehte ab. Er wollte sich den Abend nicht verderben lassen. Natürlich hatten sie alle recht. Der eine bekam zu wenig, der andere noch weniger, aber er konnte diesen Einsatz bisher gar nicht abrechnen, wer sollte ihm ein Honorar dafür anweisen? Er musste zuerst die Story verkaufen, wenn er überhaupt jemanden dafür interessieren konnte. Denn dafür musste er erst mal seinen eigenen journalistischen Zugang finden. Die Nachricht selbst verkauften die Platzhirsche, die ihm jetzt das Ohr volljammern wollten.
*
Leon fuhr von Singen nach Überlingen über Radolfzell. Ein Ortsschild lockte ihn nach Moos. Die Höri-Gemeinde neben Radolfzell war für ihn als Feinschmecker immer einen Abstecher wert. Zwei gute Restaurants hatte er dort auf seiner Liste stehen. Das Restaurant Gottfried oder, direkt daneben, der Grüne Baum. Eines der beiden Lokale war immer geöffnet, gleichgültig also, welches heute Ruhetag hatte. In den beiden Restaurants kochten zwei Brüder um die Wette. Beide waren angetan von der französischen Küche. Und Leon hatte Lust auf eine Bodensee-Bouillabaisse.
Er fuhr auf den Parkplatz, den die beiden Gourmets brüderlich teilten, und sah, dass im Grünen Baum Licht brannte. Also war es entschieden; Hubert, der jüngere Bruder, würde Leon heute verwöhnen. Hubert war ein Unikat, sein Mooser Fischtopf eine Köstlichkeit. Leon hatte ihn erst einmal gegessen. Der Mann machte eine Rouille, da konnten die Franzosen noch etwas lernen. Wobei Hubert Neidhart solche überschwänglichen Komplimente eher kleinredete. Denn sein Vorbild für sein Gasthaus auf der Höri war nach wie vor die typische französische Dorfgaststätte. In solchen Gasthäusern hatte er seine Lehr- und Wanderjahre verbracht, und diese Küche hatte ihn geprägt.
Leon parkte und stieg aus. Plötzlich wurde er unschlüssig. Er sah in sein Portemonnaie und zählte 25 Euro. Das musste genügen, für die Bodensee-Bouillabaisse und ein Glas Wein. Trotzdem überkam ihn ein schlechtes Gewissen. Nicht wegen des Geldes. Er dachte an Lena. Das letzte Mal war er mit ihr hier, sie hatte ihn mit den beiden kochenden Brüdern bekannt gemacht. Ihr hatte er den Tipp zu verdanken. Kurz hielt er inne, blieb stehen, im gleichen Moment klingelte sein Handy. Unschlüssig griff Leon in die Tasche, zog das kleine Ding heraus und sah auf das Display.
Verdammt! Er fühlte sich ertappt. Lena versuchte ihn gerade in diesem Augenblick, als er mit sich kämpfte, zu erreichen. Was sollte er jetzt tun?
Beherzt nahm er das Gespräch an: »Ich fahre gerade zu einer Pressekonferenz«, log er schnell. Er hatte einfach geredet, er wusste nichts anderes zu sagen. Während er sich aber reden hörte, schämte er sich auch schon für seine Lüge. Doch er konnte Lena nicht einfach die Wahrheit sagen, er hatte nun mal keine Lust, sie zu sehen, er musste heute Abend schließlich noch seine Steuer auf die Reihe bringen, beschwichtigte er sich selbst.
Auf der anderen Seite wusste er, dass es gerade heute Lena beschissen ging. Denn kurz nachdem er seine Wohnung am See bezogen hatte, attestierten die Ärzte bei ihr Krebs. Zuerst hatte sie nur Schmerzen im Unterleib. Dann ging alles plötzlich sehr schnell. Diagnose: Tumor am Gebärmutterhals.
Er und Lena wurden gemeinsam in einen Strudel von Angst und Schrecken geschleudert. Leon hatte sofort im Internet recherchiert: Die zweithäufigste Krebsart bei Frauen; 230.000 Tote jährlich weltweit; Überlebenschance immerhin 70 Prozent, dank des heutigen medizinischen Wissensstands.
Lena wurde operiert, der Tumor entfernt. Zurzeit musste sie eine dreimonatige Chemotherapie über sich ergehen lassen. Er selbst konnte nichts tun, das war sein Problem. Er konnte ihr nicht helfen. Er war machtlos, konnte nur danebenstehen, sah ihr zu, sah ihr Leiden, ihre Schmerzen, ihre Übelkeiten und das ganze Elend. Es war zum Verzweifeln, auch für ihn.
Am Anfang stand er liebevoll zu ihr. Er war in fast jeder freien Minute mit ihr zusammen. Doch mit der Zeit wurde dieses Aushalten zum Höllentrip.
Vor acht Wochen hatte Lena mit ihrer Chemotherapie begonnen. Seither war alles von Grund auf anders. Besonders in den Tagen nach der Infusion. Da war sie niedergeschlagen und sah völlig mitgenommen aus. Und heute hatte sie erst ihren vierten Termin gehabt, sechs Infusionstermine standen noch an. Leon hatte das Gefühl, jetzt schon am Ende zu sein, gleichzeitig wusste er, dass er eben feige gelogen hatte. Doch einen Weg zurück sah er nicht.
Lena bedauerte seine Absage, gab ihm aber auf ihre verständnisvolle Art zu verstehen, dass sein Job und der Pressetermin natürlich Vorrang hatten. Sie hatte schon von der Schießerei am Zoll in Wiechs am Randen und der Festnahme der Täter in Singen im Radio gehört.
Leon stöhnte, er fühlte sich nach der Absolution noch beschissener, flüsterte ihr trotzdem ein paar aufmunternde Worte ins Telefon und legte schnell auf. Gleichzeitig kam er sich so mies vor, wie es vermutlich Lena gerade ging.
Der Mooser Fischtopf mit den Bodenseefischen Hecht, Zander und Kretzer sowie der sagenumwobenen Rouille ließen ihn schnell wieder an seine Bodenseeliebe glauben. Er schrieb Lena eine aufmunternde SMS, verdrängte für den Rest des Abends sein schlechtes Gewissen und bestellte noch ein zweites Glas Wein. Der Riesling vom Hohentwieler Elisabethenberg des Weinguts Vollmayer schenkte ihm eine angenehme Säure und die Sicherheit, dass seine Entscheidung, an den Bodensee zu ziehen, auf jeden Fall gut war.
Kapitel 4
›Strahlender Apriltag voller Wunder und Blüten. Mit klarblauem Himmel erwachte der 1. April 1944‹, schrieb der Schaffhauser Bürger Erwin Nägeli in sein Tagebuch. Es waren die Zeiten, in denen die Schweizer ihre Neutralität genossen. Denn auf der anderen Seite der Grenze erschallte Tag für Tag der hässliche Sirenenton des Bombenalarms. Die Schaffhauser sahen von ihrem Marktplatz aus jeden Tag die Staffeln von Hunderten silbern glänzenden Flugzeugen mit deren tödlichen Frachten am nördlichen Horizont. Sie hörten das ferne Grollen der Explosionen und das Hacken der Bordwaffen. Waldshut, Blumberg, Singen – die deutschen Städte rund um ihre Heimat standen in Flammen. Doch im vermeintlich sicheren Schaffhausen ging alles seinen Gang. Die Friedenstaube im Rundbogen des Herrenackerviertels gurrte.
Doch um 11 Uhr desselben Tages sollte Erwin Nägeli tot sein und sich Schaffhausen mitten im Krieg befinden.
*
Zwei Tage zuvor war Joseph Stehle als Schaffner der Deutschen Reichsbahn wieder einmal über die Grenze von Singen nach Schaffhausen gefahren. Er hatte nur einen kurzen fahrplanmäßigen Aufenthalt und wollte diesen nutzen, um sein beachtliches Kapital, das er längst auf mehrere amerikanische Banken verteilt hatte, nach Argentinien zu transferieren. Er hatte gehört, dass seit Kriegseintritt der Amerikaner der Kapitalfluss auch aus der Schweiz nach Amerika streng überwacht wurde. Mehrere Milliarden waren schon über den großen Teich überwiesen worden. Kapital, das zum Teil vor den Nazis geschützt werden sollte, aber auch, so vermutete die US-Regierung, Nazigeld selbst.
*
Joseph Stehle hatte es nicht weit vom Bahnhof zu seiner Bank. Er drückte rasch die Klinke der Banktür und wollte eintreten. Doch gleichzeitig mit ihm drängte sich ein anderer vermeintlicher Kunde in den Geschäftsraum.
Der kleine Kassierer hinter dem Panzerglas schaute interessiert auf. Stehle achtete nicht weiter auf den zweiten Mann, schloss die Tür und ging zielstrebig auf den Kassierer zu. Barsch forderte er ihn auf: »Ich muss Direktor Wohl, den Junior, reden, schnell!«
Der Kassierer nickte untertänig und drückte auf einen Klingelknopf, der vor ihm in die Tresen montiert war. Dann blickte er auf den Mann neben Stehle, doch dieser sagte kein Wort.
»Mein Herr«, forderte der Kassierer ihn auf, seinen Wunsch zu formulieren, und schaute ihn direkt an.
Der Fremde aber blieb stumm. Er schien nur Augen für Stehle zu haben und beobachtete diesen unverhohlen.
Jetzt erst fiel der Mann auch Stehle selbst auf. Er war sehr jung, sicherlich keine 30 Jahre alt. Er hatte blondes, kurz geschorenes Haar, sodass die Haarspitzen sich kaum legen konnten. Sie standen, wie bei einer umgedrehten Bürste, auffallend steil nach oben. Sein Gesicht wirkte, trotz seines jugendlichen Aussehens, streng. Der Anzug, den er trug, schien teuer, sein Trenchcoat war salopp.
Die beiden Männer musterten sich kurz und stechend.
Stehle wurde unsicher.
Der Fremde lächelte lässig.
»Mein Herr, bitte, was kann ich für Sie tun?«, intonierte der Kassierer erneut mit ungeduldiger Stimme.
»Sie?«, lächelte der Mann den Kassierer an, »Sie, nichts!«
Der Kassierer wandte sich verunsichert zu Stehle.
Dieser zuckte ratlos die Achseln.
Schließlich regte sich der Fremde doch und sagte mit deutlich hörbarem englischen Akzent: »Ich warte mit Herrn Stehle auf Ihren Bankdirektor.«
Plötzlich witterte Joseph Stehle Gefahr. Woher kannte der Mann seinen Namen? Der Kassierer hatte ihn nicht damit angesprochen. Was wollte er von ihm? Er blickte ihn scharf an.
Der Fremde reagierte gelassen: »Ich hoffe, Sie haben Zeit.«
»Nein, keine Minute!«
»Ich weiß, Ihr Zug, Sie müssen zurück nach Deutschland. Aber Sie werden sich ein bisschen Zeit nehmen müssen«, antwortete der Mann selbstsicher.
Stehle schluckte. Er wusste nicht, was er dem fremden Mann antworten sollte, zu selbstbewusst stand dieser neben ihm.
Der Kassierer spitzte seine Ohren. Endlich, schien er zu denken, endlich brach jemand die Arroganz dieses überheblichen Schaffners.
Noch bevor Stehle sich fangen konnte, öffnete ein hagerer, großer Mann mit akkurat kurz rasiertem Oberlippenbart die Tür zu dem Besprechungszimmer neben der Kasse und nickte Stehle auffordernd zu.
Dieser wollte sich aus der unangenehmen Situation retten, setzte zu einem stürmischen Lauf an, hielt dann plötzlich nach zwei Schritten wieder inne und schaute unsicher zu dem Bürstenhaarschnitt im Trenchcoat zurück.
Doch dieser stand schon fast wieder auf seiner Höhe, lächelte ihm aufmunternd zu und ging zielgerade weiter an ihm vorbei auf den vermeintlichen Bankdirektor zu: »Grüezi, Herr Wohl«, sagte er und reichte dem verdutzten Bankchef unverfroren seine Hand. »John Carrington is my name. Aber lassen Sie uns alle zusammen drinnen weiter sprechen«, lud er die beiden überraschten Herren in das Besprechungszimmer ein, aus dem der Bankdirektor gerade getreten war.
Joseph Stehle setzte seinen begonnenen Sturmlauf fort und hetzte ebenfalls in den Besprechungsraum hinterher. Kaum drinnen, drehte er sich sofort um und stellte sich vor den fremden Eindringling. »Es reicht, wer sind Sie? Was wollen Sie? Woher kennen Sie meinen Namen?«
John Carrington lachte belustigt: »Reiche Männer sind schnell bekannt. Und Sie sind verdammt reich – für einen Schaffner sogar ungewöhnlich reich.«
Der jugendlich wirkende Bankdirektor vergewisserte sich mit einem geübten Blick, dass keine weiteren Kunden in der Filiale zu Zeugen des Schauspiels geworden waren, und schloss schnell die Tür. »Was wollen Sie?«, blaffte nun auch er den fremden Mann an.
»Ich bin ein Agent der US-Finanzpolizei«, stellte John Carrington sich vor, »und wir haben ein paar Fragen an Sie und Ihren Kunden Stehle, oder soll ich sagen Ihren Komplizen?«
Das war das Stichwort für einen Auftritt des Bankdirektors. Oswald Wohl, Schweizer Staatsbürger und Eigner der Privatbank Wohl & Brüder, setzte zu einer Lehrstunde zum Thema Schweizer Bankgeheimnis an: »Sie wissen wohl nicht, wo Sie sich hier befinden?«, raunzte er in Richtung des vermeintlichen amerikanischen Agenten, »Sie sind hier auf neutralem Boden der Schweizer Eidgenossenschaft, und hier gilt nur das Schweizer Recht, und zwar nach dem Bankengesetz von 1934. Wir sind dem Geheimnisschutz verpflichtet, und niemand wird hier zu keiner Zeit in diesen Räumen irgendetwas sagen oder erzählen über Bankgeschäfte gegenüber Dritten, ob gegenüber dem Staat, dessen Organen wie der Polizei oder wem auch immer. Schon gar nicht gegenüber der«, dabei lächelte er nun milde, »der US-Finanzpolizei!«
Nach dieser Tirade holte Oswald Wohl tief Luft und rüstete zur zweiten Runde. Er piekste mit dem Zeigefinger dem ungebetenen Besucher auf die Brust: »Im Übrigen, Herr Amerikaner«, referierte er ereifernd weiter, »im Übrigen werden Sie uns hier nicht zu einer Straftat drängen können, denn wenn ich Ihnen, und dann noch einem Amerikaner, auch nur ein Sterbenswörtchen von den Geschäften irgendeines Kunden erzählen würde, würde ich mich nach Schweizer Recht strafbar machen. Nach Schweizer Recht!«, betonte er laut, »und nur das zählt hier, verstanden?«
John Carrington hatte alle Ausführungen des Bankdirektors mit einem müden Lächeln quittiert. Der Finger auf seiner Brust aber störte ihn offensichtlich. Er schlug ihn energisch weg. »Hören wir auf, Versteck zu spielen!« Der Amerikaner legte sein freundliches Lächeln ab und wurde eiskalt. »Treiben Sie Geschäfte mit den Nazis in Ihrer Schweiz, wie Sie wollen, aber nicht mit unseren Banken«, jetzt lachte er hämisch, »und wenn, dann behalten Sie das schmutzige Geld bei sich, aber dummerweise liegt es nun bei uns in unseren Staaten, und da gelten unsere Gesetze, die Gesetze des US-Finanzministeriums.«
Während er sprach, legte Carrington einige Überweisungsbelege und Kontoauszüge auf den Tisch, die bewiesen, dass die Schaffhauser Bank Wohl & Brüder größere Summen auf verschiedene kleinere amerikanische Banken verschoben hatte. Und auf manchen Überweisungen fand sich auch der Name Joseph Stehle.
Carrington zeigte darauf. »Wir gehen davon aus, dass es sich bei diesen Beträgen um Nazikapital handelt.«
Joseph Stehle prustete. »Wie kommen Sie denn auf diese Schnapsidee?«
»Die deutsche Reichsbank hat zu genau jenem Zeitpunkt ihr Konto in New York aufgelöst, als aus der Schweiz plötzlich erstaunliche Überweisungsaufträge an uns einsetzten. Wir haben daraufhin alle Kapitalflüsse zu unseren US-Banken überprüft. Insgesamt stellten wir fest, dass seit Herbst 1940 von mehreren kleinen Schweizer Banken zusammengerechnet Milliardenbeträge zu uns flossen, mit jeweils sehr fraglichen Absendern. Herr Stehle, einer davon sind Sie! Ein Eisenbahnschaffner der Deutschen Reichsbahn mit einem Einkommen von 275 Mark monatlich hat bei uns auf mehreren Konten Millionenbeträge liegen. Heil Hitler!«
»Das ist nicht mein Geld, ich bin nur der Verwalter dieser Beträge. Im Übrigen wüsste ich nicht, seit wann die amerikanische Polizei in der neutralen Schweiz ermitteln dürfte.« Stehle war es heiß geworden. Er erkannte in diesem fremden Mann eine Gefahr, die er nicht so leicht loswerden würde. Pah, ein amerikanischer Finanzpolizist, das sollte glauben, wer mochte. Polizist? Der Mann roch für ihn nach amerikanischer Mafia.
»Herr Stehle, verlassen Sie sich darauf, ich werde Sie bald als amerikanischer Offizier in Deutschland vernehmen. Machen Sie sich nichts vor, es ist eine Frage der Zeit, dann sitzen alle Nazis wie Sie in ihren eigenen Gefängnissen. Überlegen Sie es sich gut, wir bieten Ihnen eine Zusammenarbeit an.«
»Meine Herren, bitte«, der Bankdirektor, ganz Schweizer Diplomat, suchte ein Ende der Konfrontation, er wollte Zeit gewinnen. Die neue Situation war ihm nicht geheuer. »Herr Carrington, oder wie immer Sie heißen mögen. Ich denke, wir gehen jetzt erst mal den rechtlich ordentlichen Weg. Sie benötigen eine Legitimation, geben schriftlich bei meiner Bank Ihr Ansinnen kund, und dann werden wir uns bei Ihnen oder Ihrer Dienststelle melden. So verkehren doch zivilisierte Menschen auch in Amerika miteinander, oder nicht?«
»Oh my god«, lachte der ungebetene Besucher. »Wo, glauben Sie, leben Sie? Wir haben Krieg in Europa. Wir werden die Nazis ausrotten, und meine Behörde sorgt dafür, dass kein Dollar eines Nazis in die falsche Tasche gelangt. Egal, ob diese Brut ihr Geld auf deutschen, Schweizer oder amerikanischen Banken versteckt hält.«
»Da kann ich Sie beruhigen.« Joseph Stehle witterte die Chance, sich als Nazigegner zu präsentieren. »Kein Pfennig der Beträge, die ich nach Amerika überwiesen habe, stammt von Nazis. Im Gegenteil: Ich habe das Geld von Verfolgten der Nazis zum Schutz vor den Nazis gerettet.«
»Sorry, Mister, Sie haben zurzeit gar nichts gerettet. Wir werden darüber noch befinden, zurzeit sind Ihre Konten gesperrt.«
»Das widerspricht den staatsvertraglichen Abmachungen«, ereiferte sich jetzt wieder der Bankdirektor.
John Carrington lachte: »Sie scheinen mich wirklich nicht verstehen zu wollen, aber ich bin sicher, Herr Stehle«, sagte er zu dem deutschen Schaffner gewandt, »Sie werden mich noch verstehen.« Jovial klopfte er Stehle auf die Schulter und sagte: »Sie wollten ja hier noch etwas erledigen, und soviel ich weiß, geht Ihr Zug in wenigen Minuten zurück nach Deutschland.« Süffisant verabschiedete er sich von den beiden: »Ein Zug ohne Schaffner? Ich denke, da würden selbst Sie Ärger mit der Gestapo bekommen.«
Schon im Türrahmen stehend, drehte sich Carrington noch einmal zu dem Bankdirektor um: »Einige der Summen, die Sie der New-York-City-Bank übereignet haben, weisen keinen weiteren Eigentümer auf als nur Ihre eigene Bank. Deshalb habe ich Sie Komplize genannt. Gewehrt gegen meine Unterstellung haben Sie sich nicht.«
Bevor der Bankdirektor antworten konnte, war Carrington aus dem Raum marschiert.
Stehle blieb, blass geworden, mit Oswald Wohl zurück. »Wir haben noch nicht verloren.«