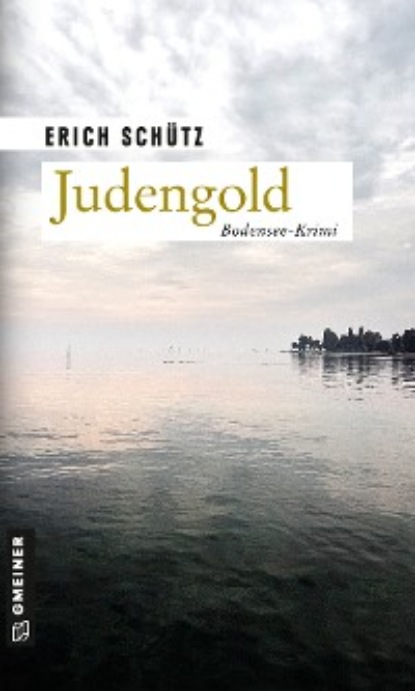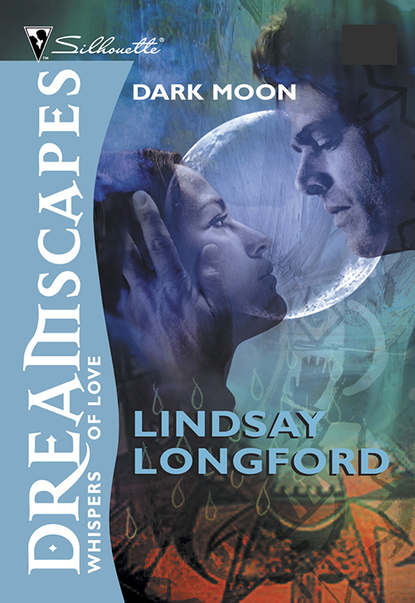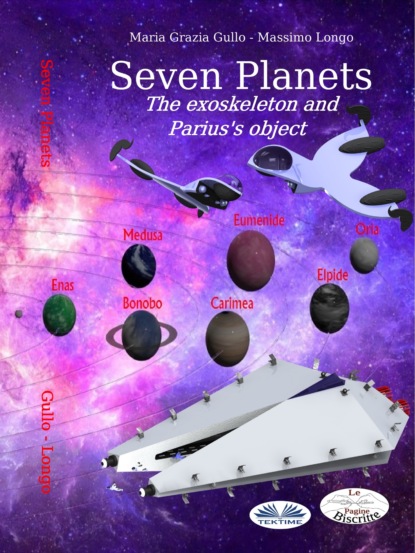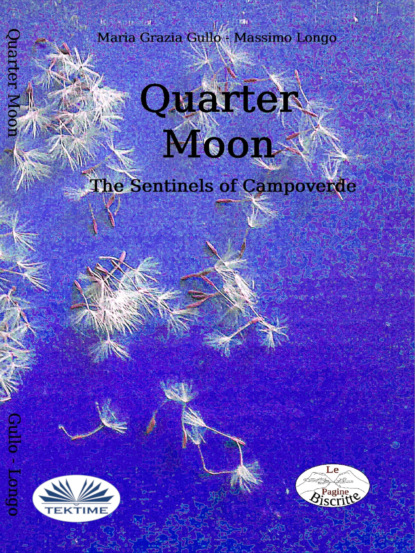- -
- 100%
- +
Der Bankdirektor lachte herb auf: »Wir nicht, aber ihr Deutschen schon. Aber bleib gelassen, Joseph, der kann uns nichts nachweisen. Was wolltest du eigentlich?«
»Zu spät«, ärgerte sich Stehle, »zu spät, Oswald. Ich wollte dich bitten, unser Geld nach Argentinien zu transferieren. Argentinien soll sicher sein, du hörst ja, die Amis drehen wegen des Kriegs völlig durch.«
»Quatsch! Mach dir da mal keine Sorgen, wir sind hier in der Schweiz, und die Amis wissen, wie man Geschäfte macht. Da hatte ich bisher vor einem Einmarsch von eurer Wehrmacht mehr Angst. Stell dir vor, die SS hätte uns den Arsch aufgerissen, dann wärst du gleich weg gewesen. Deshalb bin ich auch froh, wenn der ganze Spuk nun bald ein Ende hat. Lange wird sich Hitler nicht mehr halten können.«
Joseph Stehles Augen flackerten. »Hör auf, so zu reden. Du siehst ja, wohin das führt, wenn die Amis hier das Sagen haben, dann gute Nacht!« Joseph Stehle schnappte nach Luft, drehte sich um und rannte aus dem Besprechungszimmer: »Mein Zug«, japste er nur noch und lief los.
*
Zwei Tage später, am 1. April, kurz vor 11 Uhr, tauchten zwei Staffeln viermotoriger Liberta-Bomber über dem Kohlfirstwald vor Schaffhausen auf. Zwölf Flugzeuge waren in dem ersten Geschwader formiert, über 20 Bomber flogen in der zweiten Staffel.
Es war ein Samstag, Markttag in Schaffhausen. Aus der Innenstadt konnte man die Flugzeuge deutlicher sehen als sonst. Doch wer sollte schon auf die täglichen Bombenflüge der Amerikaner achten. Ihre tödliche Fracht warfen sie auf der anderen Seite der Grenze, in Deutschland, ab.
Aber heute, da schien irgendetwas anders zu sein. Die kleinen Flieger kamen immer näher an die Munotstadt heran. Und dann: Punkt 11 Uhr krachte es plötzlich inmitten der eigenen Stadt. 236 Brandbomben und 130 Sprengbomben donnerten auf Schaffhausen. Nach 40 Sekunden war alles vorbei: 40 Tote und 270 Verletzte lagen in den Trümmern der Schweizer Stadt Schaffhausen.
Die Amerikaner entschuldigten sich später für den Angriff. Es sei ein Versehen gewesen, begründete die US-Armee die Bombardierung. Als Grund gab sie schlechte Sichtverhältnisse an.
Doch am 1. April 1944 hatte sich über ganz Europa ein blauer Himmel gezeigt. Die Sonne hatte an jenem Tag von Aufgang 7.45 bis Untergang 18.30 Uhr geschienen.
*
Joseph Stehle hatte die Bombardierung beobachtet. Er stand in sicherer Entfernung auf deutschem Boden. Vor ihm lag eine tote Sau in einer hölzernen Wanne. Er hatte gerade Harz über ihre hellbraunen Borsten geschüttet und heißes Wasser darübergegossen. Gemeinsam mit Ferdinand Alber, dem Gutsbauer auf dem Randen, schabten sie der Sau die Borsten von der Schwarte.
Ferdinand Alber hielt inne: »Die wollen ganz Europa. Die bombardieren alles kurz und klein.« Dabei zeigte er auf die US-Bomber, die gefährlich nah über den Hegaubergen kreisten.
»Die haben es nicht anders verdient«, höhnte Stehle und deutete mit seinem Kopf Richtung Schaffhausen, wo die ersten dunklen Rauchsäulen aufstiegen. »Immer schön neutral, nur nie Farbe bekennen. Wir hätten schon gleich nach unserer Ostmark«, damit meinte er Österreich, »auch die Schweiz heim ins Reich holen müssen.«
Ferdinand Alber verzichtete auf eine Antwort. Er warf seinen Borstenschaber weg und rannte in einen nahen Schopf. Die kleinen, silbernen Flugzeuge wurden immer größer und hielten direkten Kurs auf seinen Hof. Alber hatte Angst vor einem Abwurf oder Maschinengewehrbeschuss aus der Luft.
Stehle lachte und schabte unbeirrt weiter die Borsten der Sau. Er hatte diese Woche dienstfrei. Er musste immer drei Wochen am Stück arbeiten, dann meist rund um die Uhr, dafür durfte er danach eine Woche am Stück zu Hause bleiben. Doch Joseph Stehle legte sich in den freien Wochen nicht auf die faule Haut, sondern metzgerte.
Bevor er zur Deutschen Reichsbahn kam, hatte er in der Schweiz das Metzgerhandwerk erlernt. Als Hausmetzger wurde er heute von den Bauern rund um Singen engagiert, die meisten deutschen Metzger waren längst an der Front.
Joseph Stehle war von Geburt an Schweizer Staatsbürger. Er war in Thayngen, einem kleinen Grenzort zwischen Singen und Schaffhausen, geboren. Nach der Volksschule ging er mit 14 Jahren in Schaffhausen in die Lehre. Mit 17 Jahren, 1933, begann er in Singen in der Schweizer Firma Maggi zu arbeiten. Dort lernte er seine deutsche Frau kennen. Sein Schwiegervater holte ihn zur Bahn. Schon zuvor, noch in der Schweiz, hatte er zu ›hitlere‹ begonnen. Mit dem Eintritt in die NSDAP wurde er Schaffner bei der Deutschen Reichsbahn, diese Stelle hatte er der Partei zu verdanken. Das wusste Stehle, und dafür war er auch immer bemüht, ein ordentliches Parteimitglied zu sein.
Es war in den Kriegsjahren genau zugeordnet, welcher Bauer wie viel Vieh schlachten durfte. Im Gäu war bekannt: Wer Joseph Stehle engagierte, der musste saubere Papiere haben. Krumme Geschäfte, das hieß Schwarzschlachtungen, machte dieser Mann nicht.
So kannte man Joseph Stehle: ein aufrechter Mann, überzeugter Nazi, ehrlich und gradlinig.
Ferdinand Alber hatte deshalb den Schaffner als Metzger engagiert. Er selbst war nicht in der Partei und musste aufpassen, nicht angeschwärzt zu werden. Mit Joseph Stehle als Hausmetzger hatte man die Denunzianten auf seiner Seite.
Ferdinand Alber war wieder aus dem Schopf gekommen und sah der Staffel kritisch nach. Dann schaute er Stehle an und schluckte. Nein, dachte er, diesem Mann darf ich meine Gedanken nicht anvertrauen. Für sich aber beschloss er, baldmöglichst dieses überdimensionale Hakenkreuz an seinem geliebten Hohentwiel, das die Nazis der Maggi-Stadt dort hingemalt hatten, zu überstreichen. Schließlich, so dachte er: Man musste den Fliegern doch nicht schon von Weitem zeigen, wo Nazis wohnten, das provozierte doch nur deren Bombenabwürfe. Natürlich dachte er dabei auch an sich und seine Familie und seinen prächtigen Hof.
Joseph Stehle hatte ihn von der Seite beobachtet. Er schien seine Gedanken zu erraten und riet ihm fast drohend: »Alber, sei du froh, dass du auf deinem Hof bleiben durftest, während andere an der Front ihren Kopf hinhalten. Benimm dich wie ein deutscher Mann. Glaub standhaft an unseren Endsieg, und jetzt hol das Tor, dann können wir die Sau hochziehen.«
Die Schwarte des Schweins war glatt rasiert. Das Tier lag schlachtbereit in der Wanne, die Halsschlagader war geöffnet. Die beiden Männer stellten einen stabilen Rahmen über den Zuber. Vom Oberbalken hingen je zwei Enden eines Seils herunter. Stehle band an jedes Ende eine Hinterhaxe des Schweins. Dann zogen sie gemeinsam das Seil über die Winde. Kopfüber hing das Schwein in der Wanne. Blut rann noch immer aus dem tiefen Schnitt der Halsschlagader.
Fränzle, der Sohn des Gutsbauern, hielt mit der linken Hand eine Schüssel unter den Kopf des Tieres und fing das restliche Blut auf. Mit der rechten Hand rührte er in der roten, warmen Flüssigkeit, damit das Blut nicht klumpte.
»Fränzle, du wirsch mol en rächte Kerle«, lobte ihn der Metzger, »dir mach ich nachher eine extra Blutwurscht.«
Fränzle hörte das Lob gerne, gerade von diesem Mann, vor dem die Erwachsenen einen Heidenrespekt hatten, warum auch immer. Zu ihm, und auch zu den anderen Kindern, war er immer nett. Eine Extrawurst für ihn allein, das hätte ihm sein Vater nie gegeben. Und er wusste, danach bekam er von diesem Metzger auch noch ein Stück vom Apfelkuchen dazu. Seine Mutter musste immer zum Schlachttag einen großen Kuchen für den Metzger backen. Denn Joseph Stehle aß, wenn alle sich über die Wurstsuppe und die frischen Würste hermachten, am liebsten süßen Kuchen. Und wenn Stehle ihm dann ein Stück von dem Kuchen abgab, dann konnten seine Eltern diesem Mann nicht widersprechen.
›Stalin‹ nannten die Erwachsenen Stehle hinter dessen Rücken. Das musste ein ganz besonderes Schimpfwort sein. Die großen Leute sahen sich dabei verstohlen an. Fränzle schmunzelte dann mit den Alten, fragte sich aber, was dieser kinderfreundliche Metzger mit diesem bösen Mann in Russland gemein hatte, der Krieg gegen sie führte.
*
»Well, Stalin, du wirst nicht mehr lange leben, wenn du nicht dein Geld uns überlässt!«
Joseph Stehle lag blutverschmiert auf dem Rücken. Ihn hatte es mit seinem ganzen Körpergewicht auf die Schotterstraße geschlagen. Das rechte Knie tat ihm höllisch weh, er schmeckte Blut, und zu allem hin stand ihm dieser amerikanische Agent mit dem Absatz auf der Gurgel. Er konnte sich kaum bewegen, nicht einmal seine Blessuren betasten. Er lag hilflos wie ein Marienkäfer auf dem Rücken.
Er war vom Randen mit seinem Fahrrad weggefahren. Es war schon dunkel gewesen. Links und rechts an seine Lenkstange hatte er zwei Eimer mit Wurstsuppe gehängt. Die Suppe hatten die Albers ihm aus einem großen Kessel abgefüllt, dazu noch jeweils zwei Blut- und zwei Leberwürste beigegeben. Er hatte sich auf die strahlenden Augen seiner Frau gefreut und vor allem auf Medi, seine kleine Tochter. Das würde morgen ein Sonntagsessen geben. Schlachtplatte!
Plötzlich hatte es gekracht, sein Rad hatte abrupt gestoppt und ihn abgeworfen, wie ein störrischer Esel seinen Reiter. Er war mit dem Kopf voraus über die Lenkstange zu Boden gefallen. Sein Gesicht war auf die Schottersteine geknallt, er hatte sich noch in der Wucht des Falls auf den Rücken gedreht, aber schon war der Stiefel hart und rücksichtslos auf seinen Hals getreten.
Joseph Stehle hatte im Flug an alle gedacht, an alle, die ihm Böses wollten. Vor allem an Luise Levy und Katharina oder anonyme Mitwisser, die doch von einem der beiden Weiber informiert worden waren.
Auf dem Boden gelandet, öffnete er sofort die Augen und erkannte im Gegenlicht des Mondes, über den ledernen Stiefeln, diesen Bürstenhaarschnitt. Gleichzeitig hörte er die Stimme mit diesem englischen Akzent: »Good evening, Mister Stehle«, lachte John Carrington, »Glück für Sie, dass Sie heute nicht in Schaffhausen waren. Sonst hätten wir uns jetzt vielleicht gar nicht mehr treffen können.«
Stehle hechelte. Er bekam kaum Luft. Er roch das Fett der Lederstiefel, wollte antworten, schluckte Blut, versuchte, sich freizustrampeln.
Carrington lachte und drückte seinen Stiefel tiefer in den Hals des unter ihm liegenden Stehle.
Der fasste an den Stiefel, wollte ihn wegdrehen.
Carrington verstärkte erbarmungslos den Druck auf den Gurgelknopf.
Stehle musste würgen, bekam keine Luft mehr und legte schnell, als Zeichen seiner Unterwerfung, beide Arme weit von sich, flach auf den Boden.
»Okay«, klang die Stimme des Amerikaners versöhnlich, und gleichzeitig löste er den Druck seines Stiefels leicht.
Stehle konnte wieder Luft in die Lunge einziehen.
Carrington wartete geduldig, bis der Angegriffene sich erholt hatte. Dann legte er los: »Ich weiß nicht, ob dein Komplize Wohl die Bomben überlebt hat. Vielleicht ja, vielleicht nein. Spielt aber keine große Rolle, es sollte eine Warnung für dich sein.«
Carrington hielt inne, zog eine Zigarette aus seinem Trenchcoat und zündete sie an. Die Flamme züngelte in der Dunkelheit, er inhalierte den Rauch tief und ließ dann das noch brennende Streichholz achtlos auf Stehle fallen. Er unterstrich damit seine Furchtlosigkeit und Überlegenheit.
Mit ruhiger Stimme fuhr er fort: »Stalin, hör zu: Es ist keine Frage mehr, dass ihr Deutschen den Krieg verloren habt. Die Frage ist nur, wer ihn gewinnt. Wir oder Stalin.« Dann lachte er auf: »Ihr Deutschen habt ja doch Humor. Dass sie dich Stalin nennen, ist wirklich lustig. Gerade du, der du doch Stalin hasst. Aber es stimmt. Freundlich gesagt, bist du sehr gradlinig, korrekt und kompromisslos, wie deine Kollegen dich kennen. Aber wir beide wissen, du hast ganz andere Gemeinsamkeiten mit ihm: Du bist skrupellos und gehst über Leichen, genau wie Stalin.«
Stehle wollte etwas erwidern, aber seine Worte gingen über ein Gurgeln nicht hinaus, Carrington hatte den Stiefeldruck schnell wieder erhöht.
Er fand sichtbaren Gefallen an seiner Siegerpose. Er inhalierte nochmals tief den Rauch der Zigarette, blies ihn kräftig aus der Lunge und kam dann zu seinem Anliegen: »Wir denken an morgen. Der Sieg über die Nazis ist entschieden. Aber wir sind mit den Russen im Wettlauf, wer von uns zuerst Berlin erreicht. Wir wollen Hitler erledigen, aber wir wollen keine Rote Armee auf deutschem Boden. Wir müssen schon heute für die Zeit nach Hitler sorgen. Eure Armee hält an der Ostfront die Russen nicht mehr auf. Stalin ist auf dem Vormarsch, wir bekommen täglich neue Meldungen von den Russen. Weißt du, was das heißt?«
Joseph Stehle hatte endlich eine einigermaßen erträgliche Lage gefunden. Er hatte seinen Gurgelknopf unter der drückenden Sohle etwas auf die Seite drehen können. Angestrengt schielte er zu seinem Peiniger hoch.
Carrington zog erneut an der Zigarette und schnippte sie dann weit weg, während er den Rauch energisch aus den Lungenflügeln blies.
Dann schaute er wieder zu Stehle hinunter, nahm den Fuß vom Hals des fragwürdigen Millionärs und kniete sich neben ihn. Er fasste ihn am Kragen und zog dessen Kopf zu sich hoch. »Es gibt für dich nur eine Chance«, seine Stimme wurde jetzt leise, fast komplizenhaft redete er auf ihn ein, »du schließt dich uns an. Wir sind ein kleiner Kreis, der weiß, dass unser Feind nicht Hitler ist, sondern Stalin. Wir wissen, dass Hitler geopfert werden muss, darauf wartet die Weltöffentlichkeit. Aber halte unsere Regierung nicht für blöd. Der Präsident weiß, wer langfristig unsere Verbündeten sind. Deshalb wollen wir mit dir einig werden. Wir werden dein Geld freigeben, ohne dass sich in Zukunft irgendwelche Spuren mehr verfolgen lassen, woher das Geld überhaupt kam. Aber den Großteil des Geldes, das ohnehin nicht dir gehört, benötigen wir für den Aufbau unserer Organisation nach dem Krieg hier in Europa.«
In Stehles Kopf pochte es. Er drehte das Gesicht zur Seite und spuckte Blut. Seine Lippen waren aufgeplatzt, jetzt schwollen sie an. Er bekam kein Wort heraus.
John Carrington legte Stehles Kopf sachte auf den Schotter zurück. »Ich sage dir, wie es weitergeht«, fuhr er fort, »du wirst deinen Bankdirektor überzeugen, dass er nur mit uns einen Teil seines und deines Kapitals in den Vereinigten Staaten retten kann. Mach ihm klar, dass wir seine Bank in Schutt und Asche legen, wenn er unsere Anweisungen nicht befolgt. Wir haben alle Mittel und Wege, euch beide zu vernichten oder euch am Leben zu lassen. Ihr werdet von uns hören.«
Joseph Stehle kam nicht dazu, auch nur ein Wort zu erwidern. Es schien Carrington keinen Deut zu interessieren, was er noch vorzubringen gehabt hätte. Carrington stellte ihn vor die Entscheidung, vor die jeder Straßenräuber sein Opfer stellt: Geld oder Leben?
Dann verschwand er in der Dunkelheit.
*
Joseph Stehle kam nur langsam wieder zu sich. Er tastete sein rechtes Bein ab und versuchte, vorsichtig aufzustehen. Dann humpelte er zu seinem Fahrrad, suchte seine beiden Eimer, tastete den dunklen Boden nach seinen vier Würsten ab und fluchte leise vor sich hin.
Im Vorderrad waren vier Speichen gebrochen. Carrington hatte ihm offensichtlich einfach einen Stock ins Rad gesteckt. Das erklärte auch seinen Abwurf über den Fahrradlenker. Die Wurstsuppen waren aus den Eimern gelaufen und im Erdreich versickert. Wenigstens lagen die vier Würste aber noch auf dem Boden.
Töchterchen Mechthilde weinte, als sie ihren Vater im Flur stehen sah.
Dafür lachte sie schon am nächsten Tag wieder, als auf dem Sauerkraut mit Salzkartoffeln zwei Leber- und zwei Blutwürste vor sich hin dampften: »Papa, du bist der Beste«, küsste sie ihn auf seine verwundeten Lippen.
Joseph Stehle drückte sein Kreuz durch und strahlte. Wenn seine kleine Tochter zu ihm aufsah, dann war die Welt für ihn in Ordnung.
*
Wenige Wochen später begannen die Alliierten, gezielt das deutsche Verkehrsnetz zu bombardieren. Trotzdem fuhren noch immer die Züge über die Grenze von Singen nach Schaffhausen. Joseph Stehle wollte die Gelegenheit bei einer seiner nächsten Fahrten nach Schaffhausen nutzen, um nach seinem Komplizen Oswald Wohl zu sehen und zu bilanzieren, wie viel seines Kapitals noch beweglich war.
Sein Zug lief in Schaffhausen um 8.10 Uhr ein und musste planmäßig um 11.30 Uhr zur Rückfahrt bereitstehen. Die Lok mit ihren drei Waggons sollte auf Gleis drei einfach stehen bleiben, denn der größte Teil des normalen Zugverkehrs stand kurz vor dem Erliegen. Nur noch einzelne Verbindungen gab es von Schaffhausen nach Singen, und nur noch wenige Verbindungen weiter bis nach Zürich. Die Verbindungen nach Basel, über die deutschen Städte Tiengen und Waldshut, waren eingeschränkt worden.
Joseph Stehle eilte gleich nach der Einfahrt in den Bahnhof Schaffhausen in sein Dienstabteil und zog seine Uniform aus. Es war nicht mehr die Zeit, in der man sich auf Schweizer Straßen gerne als Deutscher zu erkennen gab. Leger, in Zivil gekleidet, schlenderte er Richtung Bankhaus Wohl & Brüder.
Das Bankhaus hatte den Angriff der US-Bomber heil überstanden. Trotzdem beschlich Stehle ein flaues Gefühl, als er das schmale Haus in der Schaffhauser Innenstadt betrachtete. Er roch den Stiefel Carringtons in seiner Nase und griff unwillkürlich nach seinen gerade verheilten Wunden im Gesicht. Kurz verharrte sein Schritt, unsicher schaute er sich um.
»Mach doch keis Büro uuf«, drohte plötzlich eine Stimme hinter ihm, und Stehle spürte einen stumpfen Gegenstand in seinem Kreuz. »Chum, gang wiiter«, forderte ihn die Stimme auf und schob ihn über die Straße in das Bankhaus.
Der Schalterraum wirkte auf Stehle noch düsterer als sonst. Dann sah er, dass das einzige Fenster des Raumes mit Zeitungspapier zugeklebt war. Der Mann hinter ihm verschloss die Ladentür. »Chunnsch druus?«, fragte er ihn und forderte ihn auf: »Hei gang wiiter, du kennscht doch de Wäg.«
Der Kassenraum war verwaist. Stehle sah, dass die Nebentür in das Besprechungszimmer offen stand. Aus dem Zimmer hörte er Stimmen und sah im Gegenlicht in der Luft Rauchschwaden stehen. Er roch Zigarettenqualm und erinnerte sich an den amerikanischen Agenten. Der Mann, der ganz offensichtlich vor der Bank auf ihn gewartet hatte, schob ihn in den Raum.
»Grüezi«, lachte ihn in einem schrecklichen, nachgeäfften Schweizerenglischdeutsch John Carrington an, »welcome in our Club!«
Stehle fluchte innerlich. Wie konnte er so blauäugig schon wieder diesem Mann in die Fänge laufen.
»Es war eine Frage der Zeit, des korrekten Fahrplanes der Deutschen Reichsbahn und eures Dienstplans«, beantwortete Carrington Stehles unausgesprochene Frage, »wir mussten uns wiederbegegnen.«
Stehle blieb wie angewurzelt unter dem Türrahmen stehen. In dem Besprechungsraum saßen neben Carrington noch drei weitere, ihm unbekannte Männer, und Oswald Wohl. Über dem Besprechungstisch strahlte eine Leuchtröhre, da auch in diesem Raum die Fenster verhängt waren. Auf dem Tisch lag eine Unzahl von Papieren. Stehle erkannte, dass es sich um Kontoauszüge handeln musste, die Runde hatte ihn offensichtlich erwartet.
»Ja«, lachte Carrington, »alles Ihre Konten, gratuliere, was für ein erfolgreicher Schaffner Sie doch sind.«
Stehle wurde blass. Wie viele Ängste und bange Minuten hatte er durchgestanden, um dieses Kapital anzuhäufen. Selbst zum Mörder war er geworden und zum Verräter. Er dachte an Luise Levy und vor allem an Katharina. Und nun sollte alles umsonst gewesen sein? Er blickte Hilfe suchend zu Wohl.
»Mir sind die Hände gebunden, Joseph. Lass uns in Ruhe darüber reden«, flüsterte der.
»Woher wissen Sie, welches meine Konten sind«, fragte Stehle barsch, »und mit welchem Recht sitzen Sie hier?«
»Stalin«, begann Carrington einen längeren Monolog, »Sie haben die Chance, die Machtverhältnisse von morgen schon heute zu akzeptieren. Sie können mit uns zusammenarbeiten und uns nach dem Ende des Krieges mit Ihrem Geld helfen, eine sinnvolle Verteidigung gegen das kommunistische Bollwerk und die Rote Armee aufzubauen. Ihr Geld ist verloren, wenn Sie sich gegen uns stellen. Sie können unser Freund werden, wenn Sie mit uns nach vorne schauen. Wir, das sind die neuen Machthaber in Europa. Vergessen Sie Ihren Traum von einem Vierten Reich. Wir alle müssen gemeinsam gegen nur eine Gefahr kämpfen, gegen die Rote Armee. Stalin wird sich nicht mit Berlin zufriedengeben, er will bis zum Rhein, oder vielleicht sogar bis zum Atlantik. Deshalb sitzen hier am Tisch auch Freunde des britischen Geheimdienstes MI 5 und ein offizieller Vertreter der Schweizer Bankenaufsicht, der aber auch ein Mitglied des Schweizer Geheimdienstes P 26 ist. Glauben Sie mir, ohne uns ist Ihr Geld futsch. Mit uns können Sie nach dem Ende des Krieges noch gewinnen.«
Oswald Wohl nickte. Stehle war klar, dass er ohne seinen jungen Bankchef nie mehr an sein Geld gelangen konnte. Sollte es stimmen, dass der dünne, schmallippige Herr neben Wohl von der Bankenaufsicht war, dann verstand er, dass sie auch seinen Komplizen in der Zange hatten. Schließlich hatte dessen Bank in den vergangenen Jahren sehr viel namenloses ausländisches Kapital zunächst ein- und dann ausgeführt. Millionen Reichsmark und auch Gold und Silber ohne Nachweis einer Quelle. Daraus konnte man ihm jederzeit einen Strick drehen. Und auch ihm selbst, einem Schmuggler aus Deutschland, drohten in der Schweiz empfindliche Strafen, gleichgültig, woher das Geld stammte.
Joseph Stehle erkannte seine verfahrene Situation, es blieb ihm kein anderer Ausweg, als sich vorerst auf das Vorhaben der Herren einzulassen. »Sie diktieren die Bedingungen«, kapitulierte er, »sagen Sie mir aber, was mir bleibt.«
*
Wenige Wochen später hatten die Angriffe der Alliierten auf Singen zugenommen. Im Oktober 1944 kam es zu einem Tagesangriff mit zwölf Bombern der amerikanischen Luftwaffe. Am Weihnachtstag, im Jahre 1944, überflogen 18 Bomber Singen und warfen 90 Sprengbomben auf die Hohentwielstadt, mit Gewichten bis zu 500 Kilogramm. Dabei wurden auch Brücken und Gleisanlagen schwer beschädigt. Die Zugverbindung in die Schweiz war jetzt vollständig abgebrochen. Für Joseph Stehle gab es keine Möglichkeit mehr, sich um sein Kapital in der Schweiz zu kümmern. Er verfluchte jeden Tag John Carrington und hoffte auf das Schweizer Bankengesetz.
*
In den letzten Kriegstagen bekam Joseph Stehle noch einmal Besuch. In der Hohentwielstadt herrschte das reinste Chaos. Die Bevölkerung flüchtete tagsüber aus der Stadt in die Wälder, aus Angst vor neuen Bombardierungen. Der stellvertretende Bürgermeister wollte die Stadt den heranrückenden Franzosen kampflos übergeben. Doch SS-Offiziere aus der nahe gelegenen Radolfzeller Kaserne zwangen den Volkssturm, die Stellung zu halten.
Joseph Stehle hatte den ganzen Tag über bei Räumungsarbeiten in der Innenstadt geholfen. Er war übermüdet und wollte sich ins Bett legen. Da hörte er ein leises Klopfen an der Haustür. In Socken, um seine Frau und Tochter nicht zu wecken, schlich er in den Flur. Er wollte gerade die Tür öffnen, da griff eine starke Hand von hinten um seinen Kopf und verschloss ihm den Mund. Der Griff war sehr stark, Widerstand erschien ihm zwecklos.
»Keine Angst«, flüsterte eine männliche Stimme, »ich muss mit Ihnen sprechen.«
Der Mann hatte seinen Griff gelöst und stand nun vor ihm. Er war groß, schlank und wirkte durchtrainiert. Trotz der Kälte hatte er nur einen Pullover übergestreift, der war allerdings aus einem warmen, feinen Gewebe. Seine Militärhose steckte in leichten, weichen Stiefeln, wie sie Stehle schon bei Carrington gesehen hatte. Unter dem Pullover, am Gürtel der Hose, ragte ein Messer hervor, das der Mann aber offensichtlich nicht ziehen wollte.
Dies beruhigte Stehle etwas, trotzdem war er verunsichert. Er schlurfte irritiert an dem Mann vorbei in die Küche. Der Fremde folgte ihm.
Leise, in einem süddeutsch-schweizerischen Dialekt, redete er auf Stehle ein: »Ich soll Sie grüßen von Freunden, wir machen uns große Sorgen um Ihre Stadt.«
Stehle wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Er hatte den ganzen Tag mit dem Volkssturm und Bürgern versucht, die ärgsten Bomberschäden zu räumen. Er hatte Tote und Verwundete geborgen und in ausgebombten Häusern für Schlafplätze gesorgt. Noch immer hatte er den Gestank des Feuers der Brandbomben in seiner Nase.
»Wir wissen, dass Ihr Bürgermeisterstellvertreter ein einsichtiger Mann ist. Sprechen Sie ihn morgen an. Achten Sie darauf, dass Sie niemand hören kann, und dann kommen Sie morgen Abend mit ihm um 23 Uhr in das Gasthaus Frohsinn.«