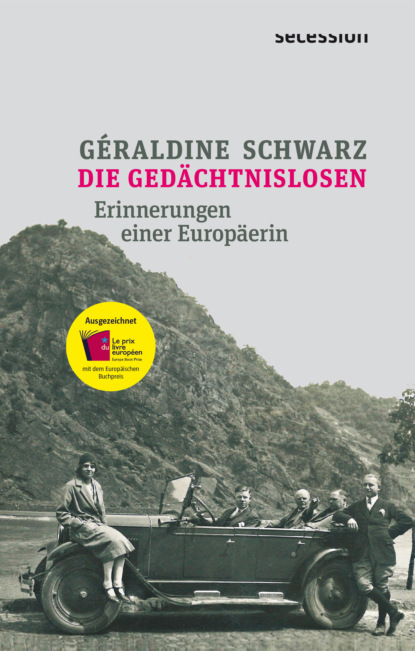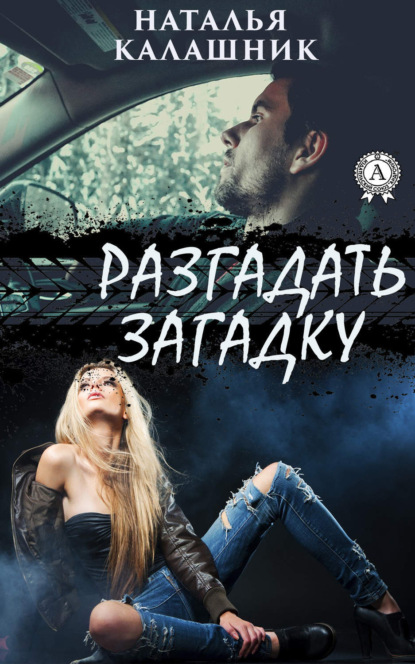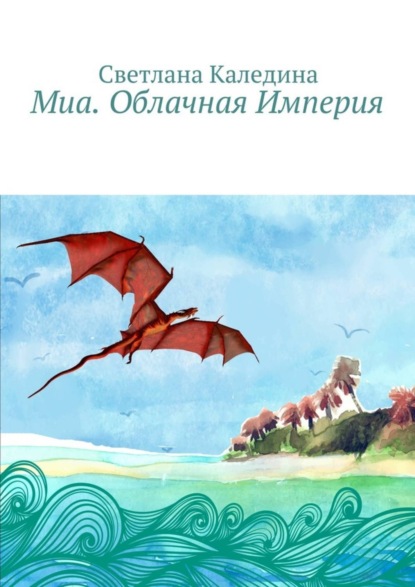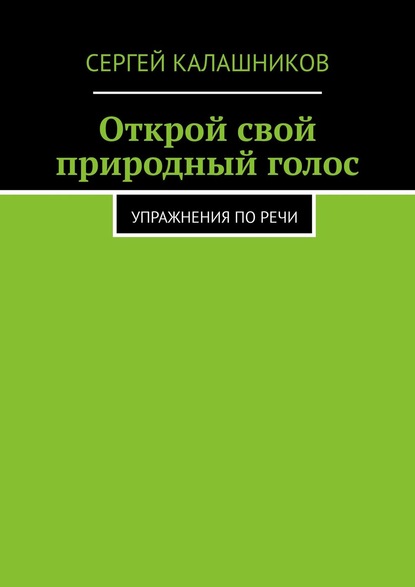- -
- 100%
- +
In der sowjetischen Zone, zu der die fünf östlichsten Länder zählten – Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie der Osten Berlins –, gingen die Besatzungsbehörden rigoros an die Entnazifizierung heran. Allerdings zielte die Verfolgung nicht nur auf Nazis, sondern auch auf alle »Unerwünschten«, die man loswerden wollte, sogenannte »Klassenfeinde«, darunter vor allem ehemalige Junker, Großgrundbesitzer und die Wirtschaftselite sowie nicht zuletzt Sozialdemokraten und andere Kritiker der Besatzungsmacht, die versuchte, ein Staatssystem nach sowjetischem Vorbild zu installieren. Die Nazis dieser Zone hatten mehr zu befürchten als in den drei anderen Zonen, auch weil sie sich gegenüber den Sowjets nicht rechtfertigen konnten, ihre Mitgliedskarte aus Opposition zum Bolschewismus angenommen zu haben – ein Argument, das im Westen immerhin ein gewisses Gewicht besaß. Für eine Verhaftung reichte oft der Verdacht. Einige zogen es vor, aus dem Osten zu fliehen, vor allem, weil dort die Haftbedingungen besonders entsetzlich waren. Die Sowjets hatten Zehntausende mutmaßliche Nazis und »Unerwünschte« in den ehemaligen Konzentrationslagern des Dritten Reiches interniert, in denen gut 12.000 Häftlinge ums Leben kamen. Weitere Zehntausende wurden in die Sowjetunion deportiert, von denen viele in den dortigen Lagern ums Leben kamen.
Im März 1948 hatten die Sowjets bereits circa 520.000 Angestellte, darunter viele ehemalige Mitglieder der NSDAP, aus dem öffentlichen Dienst entlassen, insbesondere in der Verwaltung und der Justiz, deren Personal es möglichst schnell mit »loyalen« Kommunisten zu ersetzen galt. In weniger als einem Jahr waren den kommunistischen Organisationen nahestehende neue Richter und Staatsanwälte »ausgebildet« worden, die dann auch 1950 im Namen der eben erst gegründeten noch ganz jungen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) eine Serie an Schnellverfahren leiteten: die Waldheimer Prozesse. Innerhalb von zwei Monaten erschienen etwa 3.400 Beschuldigte, ohne dass es irgendwelche Zeugen gegeben hätte und meist auch ohne juristischen Beistand vor diesen unerfahrenen Richtern und Staatsanwälten, die meist in weniger als 30 Minuten ihre Entscheidung fällten, wobei die Urteile bereits im Vorhinein festgelegt worden waren, ohne dass zwischen Mitläufern, Belasteten und Feinden des kommunistischen Regimes unterschieden worden wäre. Diese Schauprozesse hatten vor allem den Zweck, die Internierung Tausender in den Speziallagern nachträglich zu legitimieren. 3.324 Angeklagte wurden verurteilt, über die Hälfte von ihnen erhielt Haftstrafen von 15 bis 25 Jahren, 24 wurden hingerichtet. Damit betrachtete die DDR die Entnazifizierung als abgeschlossen, leugnete fortan ihre historische Verantwortung für die Verbrechen des Dritten Reiches und sah sich selbst nicht länger als Erbin dieser dunklen Vergangenheit.
Die deutsche Bevölkerung lehnte den Entnazifierungsprozess ab, den sie als unerträgliche Demütigung empfand, als Siegerjustiz. Dagegen befürwortete sie mehrheitlich – zumindest gleich nach dem Krieg – die Prozesse gegen die ranghöchsten Vertreter des Dritten Reiches.
Im November 1945 wurde in Nürnberg auf Initiative der Amerikaner ein Prozess gegen 24 Hauptkriegsverbrecher des Dritten Reiches vor einem internationalen Militärtribunal unter der Befehlsgewalt der vier Besatzungsmächte eröffnet. »Die Idee, den Krieg und alle mit ihm verbundenen Grausamkeiten nicht mehr als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern als Verbrechen zu behandeln, für das Politiker und führende Militärs wie für jedes andere Verbrechen auch zur Rechenschaft gezogen werden können«, war völlig neu, analysiert der Jurist Thomas Darnstädt in seinem Buch Menschheitsverbrechen vor Gericht 1945. Die großen Richtlinien des Verfahrens waren zuvor in Washington unter Aufsicht des Richters Robert H. Jackson entwickelt worden. Die Sowjets, die ihrerseits fürchteten, aufgrund der Übergriffe der Roten Armee und des 1939 mit Hitler vereinbarten Nichtangriffspakts selbst beschuldigt zu werden, verlangten, dass die internationale Strafgerichtsbarkeit von Nürnberg ausschließlich für Angeklagte der Achsenmächte Geltung haben sollte. Richter Jackson weigerte sich: »Wir sind nicht bereit, eine Vorschrift im Hinblick auf strafrechtliches Verhalten gegenüber anderen festzulegen, wenn wir nicht bereit wären, sie auch gegen uns anwenden zu lassen.« Die Briten, deren heftige und mörderischen Bombardements gegen die deutsche Zivilbevölkerung sie in eine heikle Position gebracht hatten, handelten einen Kompromiss aus: Die Strafnormen sollten auf jedweden Staat zutreffen, die Kompetenzen des Nürnberger Tribunals sich aber auf die Verbrechen der Nationalsozialisten begrenzen. Mehr als 2.000 Helfer wurden eingesetzt, um den Prozess vorzubereiten und zumindest einen Teil der kilometerlangen Akten zu erforschen, die ein ultrabürokratisches System hinterlassen hatte.
Ein Jahr nach der Eröffnung des Nürnberger Prozesses fiel der Urteilsspruch: Zwölf der Angeklagten wurden zum Tode durch den Strang verurteilt, unter ihnen die Nummer zwei im Reich, Hermann Göring, der Reichsminister des Auswärtigen, Joachim von Ribbentrop, der letzte Chef des machtvollen Reichssicherheitshauptamts, Ernst Kaltenbrunner, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm Keitel, der Gründer der antisemitischen Wochenzeitung Der Stürmer, Julius Streicher, und der ehemalige Ideologe der Partei und Leiter des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete, Alfred Rosenberg; drei, unter ihnen der Stellvertreter Hitlers, Rudolf Heß, wurden zu lebenslanger Haft verurteilt und zwei weitere, Albert Speer, Architekt und Reichsminister für Bewaffnung und Munition, sowie Baldur von Schirach, Chef der Hitlerjugend, zu 20 Jahren Haft. Vier Organisationen – die NSDAP, die Gestapo, die SS und der SD (Sicherheitsdienst des Reichsführers SS) – wurden als »verbrecherische Organisationen« eingestuft. Die Richter entschieden aber gegen die Forderung der Anklage, auch den Generalstab und das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) miteinzubeziehen.
Dieser Prozess bewies den Willen der Alliierten, insbesondere der Amerikaner, die Nazi-Verbrechen nicht ungestraft zu lassen. Nach Robert H. Jackson ermöglichte er, eine »neue Weltordnung durch das Recht« zu bestimmen und ein Verbrechen neuer Qualität zu definieren: das Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kurzfristig zeitigte er aber nicht die erwünschten Effekte, weder auf internationaler Ebene noch in Deutschland. Richter Jackson hatte die Anklage wegen des »Verbrechens gegen den Frieden« und des »Komplotts« in den Vordergrund gestellt – entsprechend der Vorstellung, dass »eine Gangsterbande sich des Staates bemächtigt« habe, wie er an seinen Präsidenten Harry S. Truman schrieb. Diese Sichtweise gab einer Legende Nahrung, die in der Folge lange allen Widerlegungsversuchen standhielt: der These, dass die Verbrechen der Nazis das Ergebnis eines geheimen, von einer kleinen Gruppe von Anführern um Hitler herum entwickelten Plans gewesen seien, die ihre Befehle an Untergebene weitergeleitet habe, von denen wiederum nur wenige gewusst haben, dass sie einem kriminellen Regime dienten. Ein weiteres Problem, auf das einige Juristen im Verlaufe des Prozesses aufmerksam machten, ergab sich daraus, dass hier Sieger Besiegte verurteilten und der beschränkte Auftrag des Gerichts die Kriegsverbrechen der Alliierten ungesühnt ließ: die Kollaboration von Vichy-Frankreich, die massiven Bombardierungen der deutschen Zivilbevölkerung durch Amerikaner und Briten, die von der Roten Armee in den Ostgebieten des Reichs begangenen Grausamkeiten, die von den Amerikanern über Japan abgeworfenen Atombomben.
Eines der großen Versäumnisse des Prozesses aber bestand darin, die Einzigartigkeit des Genozids an den Juden vernachlässigt zu haben, da es den Straftatbestand des Völkermords damals noch nicht gab. »Selbst im Angesicht der unvergleichlichen Verbrechen der Nazis war ein Tabu des überkommenen Völkerrechts noch immer nicht zu knacken: keine Einmischung in die ›inneren Angelegenheiten‹ eines souveränen Staates«, die Verbrechen gegen die deutschen Juden aber wurden als solche eingeschätzt, urteilt Thomas Darnstädt. Zudem waren kurz nach dem Krieg viele Geschehnisse noch nicht wirklich bekannt. So war zum Beispiel das Protokoll der Wannseekonferenz, bei der im Januar 1942 die detaillierte Organisation des Holocaust an den Juden koordiniert wurde, damals noch nicht als Beweismittel bearbeitet worden.
Im weiteren Verlauf von Nürnberg mussten in insgesamt zwölf Nachfolgeprozessen zwischen 1946 und 1949 über 185 hochrangige Mediziner, Juristen, Industrielle, SS- und Polizeiführer, Militärs, Beamte und Diplomaten vor US-Militärgerichten erscheinen. Zum Tode verurteilt wurden 24 Angeklagte, davon wurden 13 Urteile vollstreckt, 20 erhielten lebenslange und 98 teilweise langjährige Freiheitsstrafen. Gleichzeitig bewegte die angesichts der aus den Konzentrationslagern stammenden Bilder empörte amerikanische Öffentlichkeit die USA ZU der Eröffnung der sogenannten Dachauer Prozesse innerhalb des Konzentrationslagers Dachau, hauptsächlich gegen das Personal der sechs in der amerikanischen Zone gelegenen Lager. Circa 1.600 Angeklagte wurden verurteilt, 268 der insgesamt 426 verhängten Todesurteile wurden vollstreckt.
Insgesamt wurden in den drei westlichen Zonen bis Ende 1949 rund 10.000 NS -Täter gerichtlich verurteilt, von denen wiederum 806 die Todesstrafe erhielten. Angesichts der vorgegebenen Zeit offenbart diese Bilanz eine gewisse Effizienz, insbesondere auf Seiten der Amerikaner. Allerdings gelang es vielen von jenen, die angesichts ihrer Verantwortung für die Verbrechen des Dritten Reiches fraglos verdient hätten, aus der Gesellschaft ausgeschlossen und ins Gefängnis gesperrt zu werden, durch die Maschen des von den Alliierten zu weit gespannten Netzes zu rutschen. Es genügte, sich als Mitläufer auszugeben, indem man einige Papiere fälschte und vermeintliche Entlastungszeugen schmierte, deren Glaubwürdigkeit von den alliierten Behörden nur selten zu überprüfen war, teils weil sie von der schieren Flut der Verfahren überwältigt waren, teils weil ihr Ansporn nachzulassen begann.
Aber auch ganz andere Interessen warfen erste Schatten auf die Intentionen der Alliierten: Während man sich gern damit brüstete, die deutsche Wirtschaft wieder auf die Beine stellen zu wollen, zogen die Besatzer, allen voran die Amerikaner, aus ihrer Machtposition Nutzen, um technologisches Know-how zu stehlen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts waren die spektakulären Leistungen deutscher Wissenschaftler von der Welt neidvoll wahrgenommen worden. Zwischen 1900 und 1945 waren 38 Nobelpreise an Deutsche verliehen worden. Im gleichen Zeitraum hatte Frankreich 16 erhalten, Großbritannien 23 und die Vereinigten Staaten 18. Die Niederlage des Reiches war für diese Länder die Gelegenheit, sich fehlendes technisches Wissen anzueignen, was gerade im Kontext des Kalten Krieges noch an Brisanz gewann.
So wurden im Rahmen der amerikanischen Operation Paperclip massenhaft Wissenschaftler aus Deutschland herausgeschleust. Dies geschah heimlich, um zu verhindern, dass diejenigen, die mit dem Nazi-Regime kollaboriert hatten – wie etwa Wernher von Braun, der Vater der V2, Mitglied der NSDAP und der SS –, in die Hände der internationalen Gerichtsbarkeit fielen. Es ist zum Teil dem Vorsprung dieser Experten auf dem Gebiet der chemischen Waffen, der Raumfahrt, der ballistischen Raketen und der Düsenflugzeuge geschuldet, dass die Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges ihre technologische Überlegenheit ausspielen konnten. Auch auf anderen, zivilen Gebieten wurden zahlreiche Innovationen gestohlen, von Elektronenmikroskopen über Kosmetikartikel und Textilmaschinen bis zu Tonbandgeräten, Insektiziden und sogar Schlittschuhschleifer- sowie Papierservietten-Maschinen. Das Vereinigte Königreich tat sich gleichfalls keinen Zwang an, sich an Patenten und Technologien zu bereichern. Der amerikanische Historiker John Gimbel schätzt, dass die Briten und in noch größerem Umfang die Amerikaner auf diese Weise Deutschland ein intellektuelles Vermögen im damaligen Wert von zehn Milliarden US-Dollar entwendet hätten, was heute in etwa 100 Milliarden US-Dollar entspricht.
Die Franzosen waren in dieser Hinsicht weitaus weniger engagiert. Im Gegensatz zu den anderen Alliierten glaubten die Behörden nicht, dass es möglich war, deutsche Technologien aus ihren jeweiligen Kontexten herauszulösen und im eigenen Land zu integrieren. Aber das Militär und die Luftfahrtindustrie haben den Wert dieser kostbaren Kenntnisse und Erfahrungen erkannt und ließen mehrere Hundert Wissenschaftler nach Frankreich kommen, insbesondere jene, die an der Vz-Rakete gearbeitet hatten. Jetzt wurden sie bei der Konstruktion der Düsentriebwerke von Jagdflugzeugen, des ersten Airbus, der ersten französischen Raketen und des ersten Helikopters der späteren Firma Eurocopter, heute Airbus Helicopters, eingesetzt. Auch war ihr Beitrag bei der Entwicklung von U-Booten, Torpedos, Radarsystemen, Granaten und Panzermotoren erheblich und erlaubte Frankreich ein paar beachtliche Durchbrüche zu erzielen. Die Sowjets setzten Tausende deutscher Experten mitsamt ihren Familien in Züge, um sie auch gegen ihren Willen nach Russland zu verschleppen – unter ihnen etwa der Assistent von Wernher von Braun, Helmut Gröttrup. Diese waren anfangs daran beteiligt, das Raketenprogramm Stalins auf den Weg zu bringen und damit zumindest indirekt auch am Start der Sputnik in der UdSSR im Oktober 1957, dem ersten künstlichen Erdsatelliten.
Diese und ähnliche Interessenkonflikte beschädigten den Ruf der Alliierten, aber sie sollten nicht vergessen lassen, dass sie das Verdienst haben, Kriegsverbrecher und NS-Funktionäre bestraft und der Bevölkerung ein erstes Verständnis der Schändlichkeit des Dritten Reiches bewusst gemacht zu haben. So sagt die 1936 geborene Schwester meines Vaters, sie habe seit ihrer Jugend gewusst, dass »die Nazis Verbrechen begannen haben«, dass »dies in der Schule und selbst in den Medien erwähnt« worden sei, in welchen sie Fotos der Konzentrationslager gesehen habe. Ich war erstaunt darüber, da mein Vater, der 1943 zur Welt gekommen ist, mir gegenüber immer nur von einem vollständigen Gedächtnisschwund nach dem Krieg gesprochen hat. Dann wurde mir klar, dass Ingrid zu einer Zeit die Schule besucht hatte, als die Amerikaner in Mannheim versuchten, die Deutschen »umzuerziehen«, wohingegen zu jener Zeit, da mein Vater zur Schule ging, die Episode der Entnazifizierung bereits beendet war.
1948 wurden die drei westlichen Zonen fusioniert, um einen neuen Staat, die Bundesrepublik Deutschland, zu gründen. Die Alliierten kamen darin überein, auch Westdeutschland vom Marshallplan profitieren zu lassen, ein Kreditprogramm, mit dem der Wiederaufbau zahlreicher westeuropäischer Staaten finanziert werden sollte. Mein Vater sagt noch heute, dass »Deutschland Glück gehabt hat, mit dieser Nachsicht behandelt worden zu sein, bedenkt man die Verbrechen, die es begangen hatte«. Es hat alles in allem vom Kalten Krieg profitiert.
Ende der Vierzigerjahre zogen sich die Alliierten von der ungeheuren Herausforderung der Entnazifizierung zurück, für die es ihnen letztlich an Wissen über die Komplexität des Nazi-Regimes mangelte. Ohnehin konnte niemand von außen diese Aufgabe anstelle der Deutschen bewältigen. Es lag an ihnen selbst, ihre Geisteshaltung zu ändern und ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Es gab gute Gründe, diesbezüglich pessimistisch zu sein.

2Deutschland im »Jahre Null«
NACH DEM KRIEG ging es in der Familie meines Vaters nie um Politik, Diskussionen am Tisch waren eher selten: Die Kinder durften nur sprechen, wenn man ihnen ausdrücklich das Wort erteilte, und taten sie es doch, mussten sie damit rechnen, die Hucke vollzubekommen, da Karl eine autoritäre Vorstellung von Vaterschaft besaß.
In der apokalyptischen Atmosphäre Nachkriegsdeutschlands hatte nicht die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Priorität, es ging vielmehr darum, so schnell wie möglich ein neues Leben aufzubauen und zu organisieren. Die Familie Schwarz lebte in einer Dreizimmerwohnung in der ersten Etage eines kleinen Mietshauses, das 1902 vom Vater meiner Großmutter errichtet worden war, einem Tischler, der es 1935 seiner Tochter hinterlassen hatte, da sie die einzige Überlebende seiner neun Kinder war. Die Chamissostraße war hart von den alliierten Bombenangriffen getroffen worden, doch wie durch ein Wunder hatte das dort gelegene Wohnhaus das Schlimmste überstanden, während die Gebäude der gegenüberliegenden Straßenseite zu einer Ruinenwüste zertrümmert worden waren. Diese urbane Entstellung empfanden einige dennoch als Glück: »Das war für uns Kinder ein Terrain unglaublicher Abenteuer, wir konnten laufen, springen, klettern, uns verstecken und haufenweise Schätze entdecken«, erinnert sich mein Vater.
Während des gesamten Krieges waren Mannheim und seine Nachbarstadt Ludwigshafen, beide am Zusammenfluss von Rhein und Neckar gelegen, häufiger als jede andere Stadt dieser Gegend Ziel der Angriffe – insgesamt 304 –, was ihrer Infrastruktur als Hafenstädte, ihren industriellen Zentren für Maschinenbau und Elektronik sowie ihrer chemischen und pharmazeutischen Produktion geschuldet war. In Wirklichkeit aber hatten die Briten, gemessen an der Anzahl ihrer Luftangriffe, insbesondere die Wohngebiete ins Visier genommen, die am dichtesten besiedelt waren. Mannheim schien ihnen bestens geeignet gewesen zu sein, um eine Bombardierungstechnik zu testen, die man Carpet bombing oder Flächenbombardement nannte und deren Zweck, wie es der Name besagt, darin bestand, eine urbane Fläche so weit zu schleifen, bis sie einem Teppich glich. Die Stadt schien für dieses Experiment aufgrund der Einteilung ihres Zentrums in Karrees wie geschaffen, da diese eine genaue Auswertung der Explosionsfolgen mithilfe von Luftaufnahmen ermöglichte. Zum Glück meiner Großeltern lag ihr Mietshaus vom Stadtzentrum leicht abgelegen. Einige der Bomben hatten jedoch eine so große Sprengwirkung, dass ihre Detonationen Wohngebiete im Umkreis von mehreren Kilometern beschädigen konnten – Schäden, die mein Großvater nach und nach peinlich genau den deutschen Obrigkeiten vorlegte, um entsprechende Wiedergutmachung zu erhalten.
Mein Vater und ich sind die Akten durchgegangen, die Opa sein ganzes Leben lang sorgsam im Keller aufbewahrt hatte, als hätte er noch Jahre nach Kriegsende befürchtet, es käme einer, der seine erlittenen Verluste leugnen und von ihm verlangen würde, die Abgeltungen zurückzuzahlen. Nach jedem Angriff kamen die Behörden, um die Schäden für eine Wiedergutmachung festzustellen, die häufig erst viel später ausbezahlt wurde: »Durch Luftdruckeinwirkung infolge Bombeneinschlags bei dem Fliegerangriff vom 5./6.8.41 wurde auf oben bezeichnetem Grundstück Gebäudeschaden verursacht. Es entstand Dach- u. Glasschaden. Wände und Decken sind gerissen. Der Schaden wurde dem Grunde nach durch das Augenscheinprotokoll des städt. Hochbauamtes vom 4.11.1941 der Höhe nach durch die vorgelegten, von Architekt Anke geprüften und bestätigten Handwerkerrechnungen mit zusammen RM 4841,83 nachgewiesen. Außerdem wurden dem Geschädigten Ersatzleistungen in Natur in Höhe von RM 340,67 gewährt. Die Entscheidung ergeht kostenfrei.« Dieser Brief der Feststellungsbehörde des Oberbürgermeisters ist auf den 15. Mai 1943 datiert, das heißt fast zwei Jahre nach dem Schaden, vor allem aber inmitten des Zusammenbruchs, in dem sich das Dritte Reich bereits befand, und ich finde es ziemlich faszinierend, dass aller chaotischen Zustände zum Trotz die deutsche Bürokratie weiterhin mit einer solchen Präzision funktionierte.
Der verheerendste Angriff war jener in der Nacht vom 5. auf den 6. September 1943. In nur wenigen Stunden warf eine Flotte von 605 Maschinen der Royal Air Force 150 Minen, 2.000 Sprengbomben, 350.000 Brandbomben sowie 5.000 mit weißem Phosphor bestückte Bomben ab. Die Stadtbewohner flüchteten sich in die etwa 52 großräumigen Bunkeranlagen, die mehr als 130.000 Personen Schutz boten. Es ist dieser Infrastruktur zu verdanken, dass die Anzahl der zivilen Opfer der Bombardements auf etwa 1.700 Tote in Mannheim beschränkt blieb, verhältnismäßig wenige also, bedenkt man die Massivität der Angriffe. Als am 6. September die Bewohner wie Zombies aus ihren unterirdischen Verstecken hervorkletterten, war das Stadtzentrum nur mehr Schutt und Asche, brennende Ruinen. Der gesamte Komplex der Gesellschaft für Mineralölprodukte meines Großvaters, dessen Lage sich in unmittelbarer Nähe zum Hafen befand, war ausgebrannt. Das Gebäude auf der Chamissostraße hatte ebenfalls Schaden genommen, der im Keller eingerichtete und den Einwohnern als Schutzraum dienende Bunker jedoch hatte standgehalten. Seine Grundfesten existieren im Übrigen heute noch – große, in die Decke eingezogene Stahlbalken sowie eine hermetisch verschließbare Panzertür, die so unglaublich schwer ist, dass ich sie als kleines Kind gar nicht allein öffnen konnte, wollte ich aus dem Keller Marmelade holen. Es war meine Tante Ingrid, die mir Jahre später erklärte, dass mit Beginn des Krieges die NSDAP Männer geschickt hatte, um den Keller in einen Privatbunker umzubauen, was ein Privileg gegenüber all jenen war, die in den öffentlichen Bunkern Schutz suchen mussten.
Zum Zeitpunkt des Angriffs vom September hatte meine Oma, wie viele andere Frauen und Kinder, die vor den immer häufigeren Bombardierungen Schutz gesucht hatten, Mannheim bereits mit der sechsjährigen Ingrid und meinem eben erst geborenen Vater verlassen. »Er war ein krankes Kind, er hatte Bronchitis und wollte einfach nicht aufhören zu husten«, berichtet meine Tante. »Der Doktor hatte zu uns gesagt: ›Bei all dem Staub aus den Ruinen sollten Sie die Stadt besser meiden!‹« Ihr erstes Ziel war dann der Odenwald, eine hübsche, hügelige Landschaft direkt hinter Mannheim. »Wir lebten bei zwei alten Fräuleins, die bald schon die Nase voll hatten von dem schreienden Baby. Also hatten sie zu meiner Mutter gesagt: ›Lydia, du musst woandershin, das ist uns zu viel.‹« Ihr Weg führte sie weiter nach Franken zu den Eltern von Karl Schwarz. »Das waren arme Bauern, die schon drei Kinder ernähren mussten. Wir lebten auf engstem Raum miteinander, und da es gar nicht genug Teller gab für alle, steckten wir unsere Löffel einfach direkt in einen mitten auf den Tisch gestellten Kessel, ich fand das ulkig.« Davon weitaus weniger amüsiert war allerdings Oma, die es nicht mehr ertrug, sich noch länger aufzudrängen, und die bald schon dem Bürgermeister des kleinen Marktfleckens damit drohen sollte, »Dummheiten zu begehen«, falls er nicht schnellstmöglich eine Unterkunft für sie finden sollte. »Ich hatte sie begleitet, und sie sagte zu ihm so etwas Furchtbares wie: ›Ich hänge mich auf oder werfe mich mit meinen Kindern in den Fluss‹«, erinnert sich meine Tante. Ein Bauer bot ihnen ein Zimmer an, im Gegenzug dafür musste meine Großmutter bei jedem Wetter hart auf den Feldern arbeiten und Tag für Tag die Kühe melken.
Ich habe Fotos aus dieser Zeit des Exils gefunden, das sich über zwei Jahre erstrecken sollte. Ingrid mit ihren beiden blonden Zöpfen, leichtfüßig wie eine Gazelle in den grünen Hügeln, und mein Vater, sein hellblond leuchtendes Haar wie eine Mähne über seinem Puppengesicht tragend, wie er mühsam vor einem Gänsegehege herumkraxelt und strahlend offen lacht. Manchmal ist auch Opa auf diesen Negativen zu sehen, er kam sie jedoch selten in dieser Zeitspanne besuchen.
Als 1939 der Krieg ausbrach, war Karl Schwarz 36 Jahre alt, wurde aber nicht einberufen, was neben seinem Alter vielleicht auch daran lag, dass die Kriegsanstrengungen des Reiches zunächst noch nicht so vieler Männer bedurften, nachdem die Wehrmacht ihre Schlachten in Polen, Skandinavien, den Beneluxländern und im Juni 1940 schließlich auch in Frankreich per Blitzsieg entschieden hatte. Der Auftakt zum Unternehmen Barbarossa am 22. Juni 1941 jedoch, das über drei Millionen Soldaten der Achsenmächte in den Ansturm auf die Sowjetunion entlang einer Front warf, die sich von der Ostsee bis hin zu den Karpaten zog – eine in der Militärgeschichte noch nie da gewesene Ausdehnung –, veränderte die Ausgangslage: Je tiefer das Dritte Reich in diesem soldatenfressenden Krieg stecken blieb, desto geringer wurde die Chance, dem Leidensweg an der Ostfront zu entkommen.
Karl, ein Lebemann, der keinerlei Lust verspürte, in den eisigen Steppen Russlands den kleinen Soldaten des Nazi-Regimes zu spielen, musste sich von nun an geschickt anstellen, wollte er sich drücken. Seine Parteimitgliedschaft in der NSDAP als Trumpf allein stach nicht mehr. Er musste höhere Instanzen von der unbedingten Notwendigkeit seiner Anwesenheit in Mannheim überzeugen und ihnen klarmachen, dass er seine Geschäfte weiterhin betreiben musste. Werde seine Kundschaft der Mineralölprodukte beraubt, so mochte er argumentiert haben, bestünde die Gefahr, dass sie ihren Beitrag zur deutschen Wirtschaft nicht mehr leisten könne. Bedenkt man die sehr bescheidene Größe seiner Gesellschaft, sowie die Drosselung seiner Produktion während des Krieges und andererseits den dringlichen Mangel an Männern für die Front, muss Karl Schwarz ein außergewöhnliches Überzeugungstalent an den Tag gelegt haben, um von der Verpflichtung zum Dienst in der Wehrmacht freigestellt worden zu sein. Gut möglich, dass er bereits in ebendiesem Augenblick den Einfall hatte, die Wehrmacht zu seinem Kunden zu machen, indem er zweifelsohne einen für Letztere vorteilhaften Preis anbot. So machte er sich der Wirtschaft des Reiches nützlich.