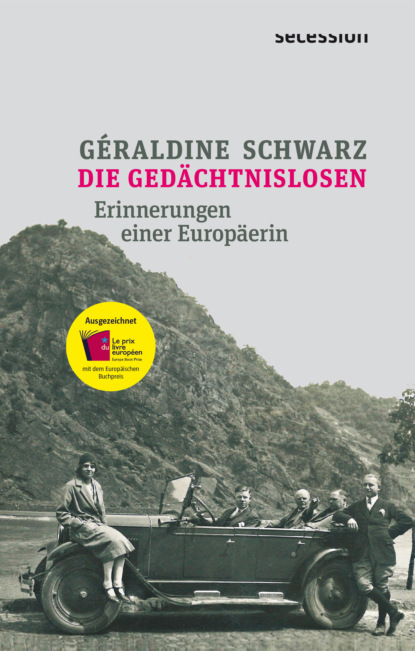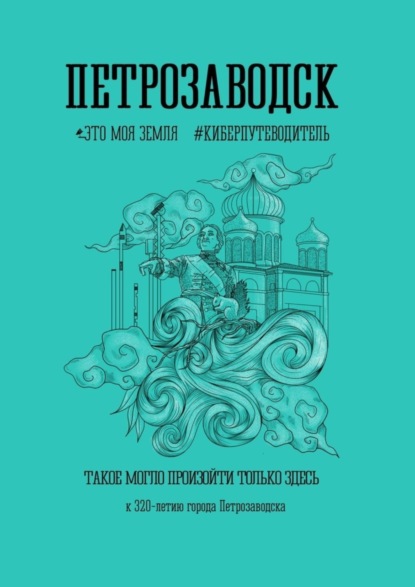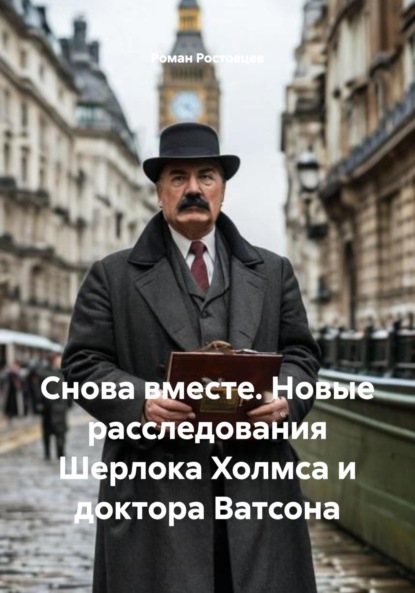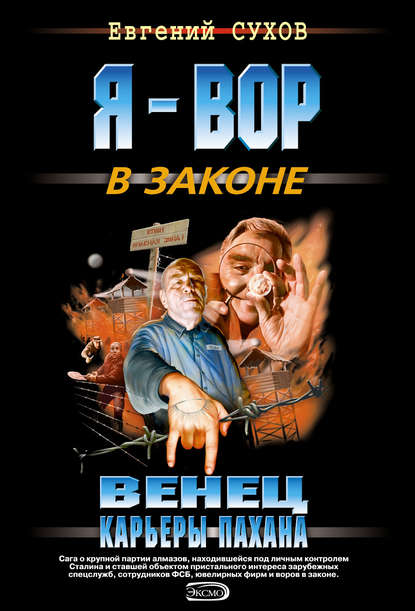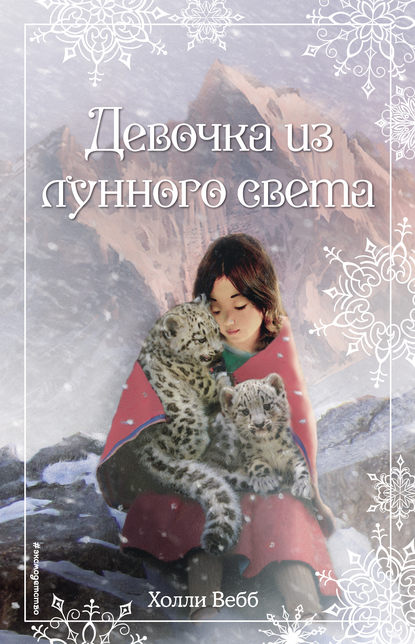- -
- 100%
- +
Ich muss ihm zumindest ein gewisses Talent zugestehen, das es ihm erspart hat, einer kriminellen Bande megalomaner und suizidaler Nazis als Kanonenfutter zu dienen. Vor Kurzem jedoch, als mein Vater und ich die im Keller gehorteten Ordner durchgingen, schien der Hintergrund von Opas Freistellung plötzlich unter einem anderen Licht auf. In einem auf den 4. März 1946 datierten Brief klagt sein Geschäftspartner der Schwarz & Co. Mineralölgesellschaft, Max Schmidt1, meinen Großvater an, die Nazi-Obrigkeiten darüber informiert zu haben, dass er, Schmidt, kein Mitglied der NSDAP war, und er damit allein die Absicht verfolgt habe, dass Schmidt an seiner statt zur Armee eingezogen würde. »Ihr damaliger Vorwurf, dass Sie mich wegen meiner Nichtzugehörigkeit zur Partei haftbar machen sollten, ist kein Fantasiegebilde, sondern leider Tatsache gewesen, genau wie Ihre sonstigen Aussagen, die Sie heute nicht mehr wahrhaben wollen. Im Übrigen drehten Sie bisher den Wind stets so, wie es für Ihre eigenen Zwecke günstig war, während ich Ihrerseits nur als das notwendige geldgebende und auftragsbringende Übel angesehen wurde.« Und er fügt hinzu: »Ich bin ja nicht freiwillig Soldat geworden. Durch meine Einziehung zur Wehrmacht wurde Ihnen ja erst die Möglichkeit gegeben, für den Betrieb unabkömmlich gestellt zu werden.«
Bei den Behörden muss mein Großvater geahnt haben, dass, sollte denn überhaupt eine Chance bestanden haben, der Wehrmacht mit der Begründung entkommen zu können, die Firma benötige einen Geschäftsführer, diese dann nur für ihn oder seinen Partner gegolten hätte, keinesfalls aber für beide zugleich. Und gut möglich, dass er eben in diesem Moment und ganz nebenbei hatte durchsickern lassen, dass sein Partner Max Schmidt kein Parteimitglied war.
Vom Frühling 1943 an lebte Karl allein, da Frau und Kinder inzwischen aufs Land gezogen waren. Die Abende müssen ein wenig traurig gewesen sein in dem halb leeren Gebäude auf der Chamissostraße, dessen Einwohner entweder aus der Stadt verbannt oder aber an der Front dem Tod und der Kälte trotzten, abgesehen von drei oder vier Seelen, die in dieser gespenstischen Kulisse diverser Wohnungen zusammenlebten, in deren Decken, Böden und Wänden Risse klafften und deren zerborstene Fenster mithilfe großer Kartonstücke abgedichtet worden waren. Um ein wenig Aufmunterung zu erfahren, begab sich mein Großvater in das Kabarett Eulenspiegel, auf der Langen Rötterstraße, einer kleinen Seitenstraße. Viele Kabaretts, Varietéhäuser und Theater des Dritten Reiches hatten bis zum 1. September 1944 ihren Betrieb fortgeführt, als schließlich Propagandaminister Joseph Goebbels deren Schließung anordnete. Bis dahin waren viele Künstler vom Armeedienst befreit, da ihre Rolle im Wesentlichen darin gesehen wurde, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung von den allgegenwärtigen Schreckensszenarien, in die Hitler sie zu stürzen im Begriffe war, abzulenken.
Das Etablissement existiert nicht mehr, aber ich habe in den Papieren meines Großvaters ein Blatt gefunden, dessen Briefkopf in hübscher roter Kalligrafie den Schriftzug »Eulenspiegel – Parodistisches Kabarett« trägt. Am unteren Seitenrand sind Auszüge positiver Pressestimmen wiedergegeben. Aus Saarbrücken: »Selten wird Kunst in dieser pikanten Form serviert. Mit klassischem und volkstümlichem Gesang paart sich ein schalkhafter Humor, durchweht von sprühendem Geist. Das Ganze als Eulenspiegelparodie war, man kann es nicht anders bezeichnen, eine Glanzleistung.« Aus Mannheim: »Die Eulenspiegel gewannen schnell Sympathie, denn sie zeigten Originalität, Geist und – welch seltene Wohltat – Niveau.« Auf halber Höhe des auf den 2. Februar 1948 datierten Briefes steht geschrieben: »Wir bestätigen hiermit, dass Herr Karl Schwarz zu unserer Gruppe gehört«, und unten auf der Seite bezeugt dies die Unterschrift des Leiters des Kabaretts, Theo Lustfeld2. Welches Motiv sich auch immer hinter diesem Dokument verbergen mag, das zweifellos als Alibi gedient haben musste, um meinen Großvater nach dem Krieg von möglichen Unregelmäßigkeiten reinzuwaschen, so verweist es doch darauf, dass Karl das Etablissement häufiger aufgesucht haben muss, um ein solch heimliches Einverständnis erlangt haben zu können. Tatsächlich hatte er vor allem mit einer Dame verkehrt, einer Künstlerin, die zugleich die Ehefrau des Chefs war, Frau Lustfeld, und sich dem Paar so sehr angenähert, dass er nach der Zerstörung seiner Firma im September 1943 sein Büro und seine Lagerhalle gleich neben ihrer Wohnung in einer an den Randgebieten von Mannheim gelegenen Ziegelei einrichtete, wo er dann auch bis zum Ende des Krieges wohnte. Und da es kaum vorstellbar ist, dass der Ehemann von der intimen Nähe, die seine Frau an ihren neuen gemeinsamen Freund band, keinen Wind bekommen hatte, hält mein Vater es für durchaus wahrscheinlich, dass sie eine Art Ménage-à-trois führten, die bis zum Tode meines Großvaters halten sollte. Als Oma begriff, dass die Lustfelds, die sich während ihrer Abwesenheit so rührend um ihren Ehemann gekümmert hatten, mehr als nur Freunde waren, stürzte sie dies in einen Schmerz, von dem sie sich nie mehr wirklich erholen sollte. Glücklicherweise hat sie diese unangenehme Entdeckung erst sehr viel später gemacht und nicht schon nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 bei ihrer Rückkehr mit den Kindern nach Mannheim. Ein anderer Schock erwartete sie dort bereits: Die Stadt, in der sie das Licht der Welt erblickt hatte, war zur Hälfte verschwunden.
Mannheim war im Südwesten Deutschlands eine der am meisten zerstörten Städte; 70 Prozent des Zentrums und 50 Prozent der restlichen Stadt lagen in Trümmern. Es hatte den desaströsen Luftangriff vom September 1943 gegeben und zahlreiche weitere, und schließlich flogen die Bomber der Royal Air Force am 2. März 1945 noch ein letztes Mal los, obwohl das Ende des Krieges bereits absehbar war, und entzündeten einen Feuersturm, der den Rest der historischen Altstadt mit sich davontrug. Ende März hatten die Mannheimer bei der Ankunft der Amerikaner die Waffen gestreckt und waren auf diese Weise, ohne es zu wissen, dem Schlimmsten überhaupt entkommen, denn ein amerikanischer Geheimplan sah vor, über mehreren Städten nukleare Sprengbomben niedergehen zu lassen, sollten die Deutschen Widerstand leisten – Mannheim und Ludwigshafen zählten zu den möglichen Zielen.
Falls Oma mit dem Zug angekommen sein sollte, so hat sie neben dem Bahnhof das große Barockschloss, von dessen 500 Zimmern ein einziges unberührt geblieben war, an allen Ecken und Enden durchlöchert gesehen. Um zur Chamissostraße zu gelangen, hat sie die alten großen Einkaufsstraßen überqueren müssen, die einst von prächtig erleuchteten Kaufhäusern gesäumt gewesen waren, vor Leben nur so wimmelnd und jeglichen Überfluss zur Schau stellend – Magnete, in die man aus der ganzen Region herbeigeströmt war, um Einkäufe zu erledigen. Karstadt und die ehemaligen jüdischen, nun aber arisierten Kaufhäuser Kander, Gebrüder Rothschild, Hermann Schmoller & Co waren zum Großteil wie Kartenhäuser unter den Bomben zusammengesackt. Von den Cafés, die im Sommer stets ihre schönen Terrassen geöffnet hatten, um den Damen Sahnetorten und Kaffee zu servieren, war keine einzige Spur mehr verblieben, abgesehen vielleicht von einigen aus ihren Firmenschildern herausgerissenen Buchstaben oder auch den Scherben des Geschirrs, das den Namen des Caféhauses trug und nun als Splitter aus den Trümmerbergen herausragte, die sich an den Gehsteigkanten auftürmten, um den Weg freizugeben. Ganze Straßenzüge waren verschwunden, verwandelt in großflächige, schemenhafte Terrains, auf denen hier und da die Karkassen von Gebäuden und die körperlosen Fassaden fortbestanden, aufgestellt wie Theaterkulissen im Nichts. Ich stelle mir Oma vor, wie sie, eine äußerst gläubige Protestantin, die altvertraute Silhouette einer Kirche mit ihren Blicken sucht und an deren Stelle nichts als das nackte Skelett eines Kirchenschiffs vorfindet und ein vor der klaffenden Öffnung eines Glockenturms schief hängendes Kreuz.
Wie viele Deutsche haben wohl, meinen Großeltern gleich, ihre Geburtsstadt derart entstellt gesehen, die Identität eines Lebens? Hamburg war in ein Feuermeer verwandelt worden, das bis zu 40.000 Menschen das Leben kostete und die Hälfte aller Wohnungen zerstörte, Dresden, Meisterwerk des Barocks, war nach einem Bombensturm, der circa 25.000 Einwohner tötete, zu einer Geisterstadt geworden. Hannover, Kassel, Nürnberg, Magdeburg, Mainz, Frankfurt waren zu 70 Prozent verschwunden, während das gesamte Ensemble im Industriebecken an Rhein und Ruhr – Köln, Düsseldorf, Essen, Dortmund – unter den Bomben zusammengebrochen war. Einige Gemeinden wie Düren, Wesel oder Paderborn waren sogar zu mehr als 96 Prozent verschwunden. Summa summarum verlor jede fünfte Familie ihr Zuhause. Die Zahlen schwanken, aber vermutlich starben während der Luftangriffe etwa 300.000 bis 400.000 Menschen, so der Historiker Dietmar Süß. Mindestens ebenso viele erlitten lebenslange Folgeschäden und Millionen weitere waren traumatisiert.
Am 14. Februar 1942 hatte London über eine Anweisung dem Oberkommandierenden des Bomber Command der Royal Air Force, Arthur Harris, mitgeteilt, dass er seine Streitkräfte ohne jede Beschränkung einzusetzen habe, die Operationen sollten » on the morale of the enemy civil population and in particular the industrial workers « fokusiert werden, sprich auf Wohngebiete. Arthur Harris erhielt den Spitznamen Bomber Harris. Bevor ich dieses Buch zu schreiben begann, war mir dieser Held der Briten nicht bekannt, und ich muss, als ich in London studierte, wohl zigmal an seiner 1992 enthüllten Statue vorübergegangen sein, ohne ihr jemals meine Aufmerksamkeit geschenkt zu haben. Seit die Erinnerungsarbeit jedoch für mich zur Obsession geworden ist, jage ich ihr in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen nach, wo immer ich mich aufhalte. Für gewöhnlich widme ich mich ihr ganz allein, denn den Tag mit Toten zu verbringen trifft nicht gerade aller Welt Geschmack. So nutzte ich auch einen Blitzbesuch in London, um mir die Statue anzusehen, auf der Arthur Harris vor der St. Clement Danes Church thront. Dieses Mal las ich das Epitaph: »Im Gedenken an einen exzellenten Befehlshaber und die mutigen Besatzungen der Bombergeschwader, von denen über 55.000 ihr Leben für die Freiheit ließen. Die Nation schuldet jedem von ihnen unermesslichen Dank.«
Die Bombardierung der Zivilbevölkerung hatte zum Ziel, die Moral der Deutschen und ihre Unterstützung für Hitlers Krieg zu brechen, Historiker sind sich heute aber einig, dass sie nicht dazu beigetragen hat, den Krieg zu verkürzen. Diese Angriffe, ursprünglich als Vergeltung für die zerstörerischen Luftangriffe der Deutschen auf Coventry, auf London und auch auf Rotterdam gedacht, wandelten sich im weiteren Verlauf zu mordsüchtiger Rache. In den letzten Monaten des Krieges bombardierten die Briten und Amerikaner Deutschland beinahe täglich, obwohl die Niederlage des Reiches längst klar war.
Abgesehen von der Masse der zivilen Todesopfer führten diese Verheerungen dazu, dass Deutschland ganze Teile seiner kulturellen und historischen Identität verlor. Sieht man sich Bilder von Mannheim, Berlin oder Köln vor dem Krieg an, so wird einem ein vollkommen anderes Land präsentiert. Doch auch wenn die Alliierten Verbrechen begangen haben, die primäre Verantwortung für diese Gewaltspirale fällt zweifellos dem Dritten Reich zu, denn hätte es den Krieg in Europa nicht vom Zaun gebrochen, Deutschland hätte niemals auf diese Weise gelitten und wäre nicht in solchem Maße verunstaltet worden. Das allergrößte Leid aber brachten nicht die Bomben über die Deutschen, sondern der mörderische Wahn des Führers, der auf den Schlachtfeldern mehr als fünf Millionen deutschen Soldaten das Leben kostete.
Meine Großeltern waren von diesem Blutbad nicht direkt betroffen. Doch unzählige jener, die ihnen nahestanden, hatten den Tod eines der Ihren in diesem Krieg zu beweinen, den Hitler weiterzuführen sich in den Kopf gesetzt hatte, obwohl mehrere Generäle ihm geraten hatten, sich doch zurückzuziehen. Der Mann von Karls Schwester Heidi, ein Offizier der Wehrmacht und glühender Nationalsozialist, war an der Ostfront gestorben, so wie mindestens 3,5 Millionen andere deutsche Soldaten auch, die die Weigerung ihres Führers, angesichts der evidenten Überlegenheit der Sowjets in den letzten Kriegsjahren einen Rückzieher zu machen, mit ihrem Leben bezahlt hatten. Nachdem sein Plan, die UdSSR in den wenigen Monaten des Sommers 1941 zu erobern, misslungen war, trieb Hitler seine Männer an, ihren Vormarsch bei eisigem Winter ohne jegliche Ausrüstung gegen die Kälte bis vor die Tore Moskaus fortzusetzen. Trotz Temperaturen von minus 50 Grad Celsius und ohne Handschuhe geschweige denn Mäntel, erteilte er ihnen den Befehl, um jeden Preis anzugreifen und ihre Position zu halten. »Wir wussten nicht, wo sich die Front befand. Wir knieten oder lagen im Schnee. Die Knie froren uns am Boden fest«, schrieb ein Wehrmachtssoldat in seinen Aufzeichnungen. Unfähig, Gräben in das harte Eis zu ziehen, um darin Schutz zu finden, starben die deutschen Soldaten wie die Fliegen, erschossen von russischen Kugeln oder erledigt von Kälte und Hunger. Ein Jahr später, der Warnhinweise seiner Generäle über den katastrophalen Zustand der Truppen zum Trotz, zwang der Führer die ausgemergelten Soldaten noch einmal zum Angriff, diesmal gegen Stalingrad – eine Offensive ohne jegliche Aussicht auf Erfolg, die darauf hinauslief, seine Männer in den sicheren Tod zu schicken. Die rund 220.000 Soldaten der 6. Armee wurden eingekesselt, sie trugen nichts als dünne Kleidung und litten unter beißendem Hunger. Nur etwa 6.000 kehrten in ihre Heimat zurück.
In Nordafrika, einem weiteren Kriegsschauplatz, fiel die Opferbilanz für die Deutschen mit einigen Zehntausend Toten vergleichsweise niedrig aus, da Erwin Rommel, der als »Wüstenfuchs« gefeierte General, der die Offensive des Afrikakorps gegen die Briten leitete, den Mut besessen hatte, Hitler zumindest einmal nicht zu gehorchen. Bei der Schlacht von El Alamein hatte der Führer trotz der offensichtlichen logistischen Unmöglichkeit, den Feind zurückzudrängen, einen seiner gefürchteten Durchhaltebefehle gegeben: »Ihrer Truppe können Sie keinen anderen Weg zeigen als den zum Siege oder zum Tode.« Rommel, der seinem Chef gegenüber stets äußerst loyal gewesen war, wies jedoch alle beweglichen Einheiten an, sich zurück- und nach Westen abzuziehen. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944, die den Niedergang des Reiches bestätigte, redete Rommel dem Führer zu, den Krieg doch zu beenden; er provozierte damit aber nur den Zorn eines Tyrannen, der von seinem maßlosen Machtstreben verblendet war. Wenig später wurde ihm unterstellt, er habe an einem fehlgeschlagenen Putsch der Offiziere gegen das Nazi-Regime teilgenommen. Erwin Rommel, dessen Kühnheit und Triumphe Deutschland jubeln und den Feind zittern ließen, erhielt den Befehl, sich umzubringen – und führte ihn auch aus.
Ähnlich wie er versuchte am Ende des Krieges eine wachsende Zahl von Generälen, Hitler zur Vernunft zu bringen, aber der Führer beharrte unerschütterlich auf seiner Position und konnte sich dabei auch auf die anhaltende und nicht nachvollziehbare Unterstützung eines Teils des Oberkommandos stützen. Wenige Monate vor der Kapitulation, obgleich alle Hoffnung bereits verloren war, fiel den Anführern der Nazis in ihrem selbstmörderischen Wahn nichts Besseres ein, als den Kreis der potenziellen Opfer noch einmal zu erweitern, indem sie auch noch die wenigen, die als Kanonenfutter verblieben waren, einziehen ließen. Vor allem Jungen im Alter von 16 oder 17 Jahren und Männer über 45 Jahre bildeten den »Volkssturm«, der kaum bewaffnet die Städte verteidigen sollte, die längst nicht mehr zu verteidigen waren. Sie wurden skrupellos in den Tod geschickt, um das selbstherrliche Bild des Deutschen, das der Eitelkeit des Führers entsprach, bis zum Äußersten zu pflegen: entweder vollständiger Sieg oder totale Niederlage.
Die Deutschen, die jene letzten Kriegsmonate durchlebten, erinnern sich an diese wie an eine Apokalypse. Das Land fiel in sich zusammen, brannte, explodierte, schrie, zerbrach und ging in einem Danteschen Inferno unter. Wie ein Löwe im Käfig umherirrend, versank Adolf Hitler in der bedrückenden Atmosphäre seines Bunkers unter der Berliner Reichskanzlei in einem trotzigen, selbstzerstörerischen Wahn und zog der Kapitulation den Untergang vor, in den er sein eigenes Volk zu stürzen trachtete, welches sich der nationalsozialistischen Revolution als »unwürdig« erwiesen hatte. Am 30. April schoss er sich, nachdem er seinen Hund getötet hatte, eine Kugel in den Kopf, und Eva Braun, seine Partnerin, die kurz vor seinem Tod zu heiraten er endlich eingewilligt hatte, vergiftete sich mit Zyankali. Am 1. Mai dann war es an seinem Propagandaminister, Joseph Goebbels, einem fanatischen Antisemiten, und seiner Frau Magda, einer besessenen Anhängerin des Nationalsozialismus, Zyankali zu schlucken, nachdem sie es zuvor ihren sechs Kindern verabreicht hatten, die in Propagandafilmen als hellblonde Engel dafür hatten herhalten müssen, die Deutschen innerlich zu rühren.
Selbstmord verbreitete sich in dem Augenblick, da die Ankunft der Roten Armee unausweichlich erschien, wie eine Epidemie. Pastoren, vor allem in Berlin, waren wegen des Ansturms Gläubiger beunruhigt, die sie aufsuchten, um ihnen anzuvertrauen, dass sie stets eine Ampulle Zyankali bei sich trugen. Die Anzahl der Berliner, die sich in den letzten Kriegswochen das Leben nahmen, lag wahrscheinlich bei mehr als 10.000. In Demmin, einer kleinen, in Vorpommern gelegenen Stadt mit etwa 15.000 Einwohnern, die am 30. April von der Roten Armee erobert worden war, nahmen sich zwischen 500 und 1.000 Personen das Leben, darunter nicht wenige Frauen, die zuvor ihre eigenen Kinder umgebracht hatten. Andere Städte erlitten ein ähnliches Schicksal. Meine Tante erinnert sich an die Verzweiflung ihrer Mutter: »Die Amerikaner waren bereits im Lande und meine Mutter rief noch immer aus: ›Wir werden den Krieg nicht verlieren! Der Führer wird gewinnen! Wenn wir den Krieg verlieren, bringe ich mich um!‹«
Dass Oma nicht zur Tat schritt, mag daran gelegen haben, dass ihr Schicksal im Vergleich zu anderen nicht ganz so furchtbar war. Nachdem sie das zu Ruinen zerfallene Stadtzentrum Mannheims durchquert hatte, muss ihr beim Anblick des noch stehenden Familienhauses ein schweres Gewicht vom Herzen gefallen sein. Aber um überleben zu können, reichte die eigene Bleibe nicht aus, erst recht nicht, wenn sie überall durchlöchert war. Ganze Wände, ein Stück der Bedachung und ein Teil der Treppe waren weggerissen und sämtliche Fenster in tausend Scherben zerborsten. Nach und nach kehrten die Mieter vom Land zurück, um sich wieder in ihren Wohnungen niederzulassen. Aber sie mussten diese mit jenen teilen, die alles verloren hatten. In Mannheim waren von etwa 86.700 Wohnungen nur 14.600 nicht von den Bomben getroffen worden. Angesichts der drückenden Wohnungsnot war bestimmt worden, dass mindestens acht Personen sich eine Wohnung der Größe wie im Gebäude auf der Chamissostraße teilen mussten, wobei jede etwa 90 Quadratmeter umfasste. Opa entkam der Reglementierung, da er vorgegeben hatte, sein Bruder Willy würde mit seiner Familie unter seinem Dach wohnen. Allerdings erinnert sich meine Tante, dass ihre Eltern regelmäßig Familienmitglieder, die in Not geraten waren, aufnahmen und sie selbst im Wohnzimmer hinter einem großen Laken schlafen musste, das als Vorhang diente. Im Erdgeschoss fand sich hingegen ein alter, allein lebender Junggeselle mit einer ganzen Flüchtlingsfamilie wieder. »Wir nannten die Flüchtlinge Rucksackdeutsche, wir konnten nur ahnen, dass sie einen wirklichen Albtraum hinter sich hatten«, sagt Ingrid.
Die 12 bis 14 Millionen Vertriebenen aus dem Osten, denen die Heimat entrissen worden war, in der sie sich seit Generationen verwurzelt fühlten, gehörten zweifellos zu den am schwersten betroffenen deutschen Zivilisten. Insbesondere die aus den deutschen Ostgebieten waren unter furchtbaren Bedingungen vor der Ankunft der Roten Armee geflohen, die aufgebracht vom Anblick der von der Wehrmacht während ihres Rückzugs niedergebrannten Dörfer und vom Tod von Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen einen nicht gerade geringen Tatendrang verspürt haben dürfte. Mehr als 1,4 Millionen deutsche Frauen wurden vergewaltigt und Hunderttausende Männer in die Gulags gesteckt und zur Zwangsarbeit verdammt.
In der Tschechoslowakei ging es weniger blutig zu, doch der erzwungene Fortzug von drei Millionen Deutschen war ebenfalls sehr schmerzhaft verlaufen. Im österreichisch-ungarischen Kaiserreich waren die Sudetendeutschen in Böhmen und Mähren im Norden des Landes zu Wohlstand gelangt. Aber ihre Situation verschlechterte sich nach der Zerschlagung des Kaiserreichs im Jahr 1918, als ein neuer unabhängiger tschechoslowakischer Staat seine deutschsprachige Minderheit zu diskriminieren begann.
Die Notwendigkeit beschwörend, seinen »Blutsbrüdern« zu Hilfe eilen zu müssen, annektierte Hitler das Sudetenland im Oktober 1938 unter den Bravorufen einer überwiegenden Mehrheit der örtlichen Bevölkerung, die erst gar keine Zeit verlor, nun ihrerseits die Tschechen zu diskriminieren und aus der Region zu vertreiben. Nach der Niederlage des Reiches wechselte die Rache wieder die Seiten, und nun war es an den Deutschen, auf die Straße gesetzt und wie Aussätzige verjagt zu werden, wobei Tausende vor Erschöpfung starben oder ermordet wurden. Der tschechoslowakische Präsident Edvard Beneš ordnete per Dekret an, dass sämtliche Güter der Deutschen »beschlagnahmt«, sprich gestohlen werden sollten. 2002 verurteilte der tschechische Präsident Václav Havel diese Vertreibungen öffentlich.
Der Empfang dieser Flüchtlinge in Westdeutschland war nicht besonders herzlich, schließlich hatte man mit den Wohnungslosen aus der eigenen Region schon genug zu tun. Empathie findet sich selten in Kraft gesetzt, wenn alle Welt leidet. So hatten meine Großeltern zwar Mieter, aber diese konnten nur wenig Miete zahlen. Die Schäden der Angriffe vom September 1943, die sowohl das Gebäude als auch Opas Fabrik getroffen hatten, waren noch immer nicht ausgeglichen worden. Mein Großvater verbrachte ganze Tage damit, bei den Behörden vorstellig zu werden. Glücklicherweise hatte er vor dem großen Bombardement ein vollständiges Inventar seiner Güter erstellt, das ich im Keller in Mannheim gefunden habe.
Bei der Lektüre dieser Liste, die jedes einzelne Kleidungsstück, das gesamte Mobiliar, jedes einzelne Zubehör, das meine Großeltern besaßen, aufzählt, fand ich mich in jener Kulisse wieder, in der Oma gelebt hatte, als ich noch ganz klein war, und von der ich gedacht hatte, mich nur noch vage an sie erinnern zu können: Nach ihrem Tod – ich war sechs Jahre alt – hatte mein Vater die Wohnung vollkommen umgestaltet. Nicht ohne einen Kloß im Hals zu spüren, sah ich vor mir deutlich das Zimmer meiner Großmutter wiedererstehen, in dem sich schwere dunkle Holzmöbel befanden, ein Bild, das eine idyllische germanische Landschaft darstellte, ein für die Größe des Zimmers viel zu massives Bett und über diesem ein beeindruckendes Kruzifix, vor dem Lydia jeden Abend gebetet hatte. Die Wohnung bestand aus einem Salon, einer großen Küche, in der Oma ganze Tage damit verbrachte, Gebäck auf Blechen so groß wie ihr Ofen für die sonntäglichen Runden zu Kaffee und Kuchen zu backen, sowie einem Herrenzimmer, in welchem man in Sesseln, die einer Art-déco-Bibliothek und einem dazu passenden Schreibtisch gegenüberstanden, sitzend Pfeife und Zigarre rauchen durfte, wenn die Finanzen es erlaubten, allerdings nur unter Männern. Eine andere Liste, die ich fand, ist auf den Tag nach den Verwüstungen durch die Bombardements im September 1943 datiert und verzeichnet die Verluste. Wie detailliert Opa den Schaden notierte – er gibt dabei auch »einen Kanarienvogel samt Käfig« an, »eine Türklinke«, »leere Flaschen« und »leere Obstkisten« –, liefert einen Eindruck von der angespannten finanziellen Situation meiner Großeltern während dieser Zeit.
Sehr schnell war es Karl Schwarz gelungen, eine weitaus effizientere Lösung zu finden, als auf die Schadensersatzleistungen des Staates zu warten, um die Lebensbedingungen seiner Familie zu verbessern. Zwar hatten die Alliierten ihn der Kontrolle seiner Gesellschaft enthoben, aber sie wussten nicht, dass er in einer Ziegelei außerhalb der Stadt noch über ein ganzes Lager an Öl- und Petroleumfässern verfügte. In jenen Zeiten des Mangels glichen diese Reserven purem Gold auf dem Schwarzmarkt, von wo mein Großvater die unglaublichsten Schätze mit nach Hause schleppte: Lagen an Eierkartons, die er im Gartenhäuschen im Hof unterbrachte, Hunderte von Äpfeln, die im kühlen Keller frisch gehalten wurden, ganze Schinken, die im Badezimmer von der Decke hingen, und sogar – unerhörter Luxus in diesen entbehrungsreichen Zeiten – Knallkörper und Sekt zu Silvester. Karl war der Einzige im Viertel, der ein Auto besaß und davon profitierte, »dass immer ausreichend Platz zum Parken vorhanden war«, wie mein Vater belustigt erzählt. In der Nachbarschaft galt die Familie Schwarz als außergewöhnlich gut situiert, wohingegen andere Jungen in der Schule mit leerem Magen und in Schuhen mit löchrigen Sohlen erschienen. »Man war ein wenig neidisch auf uns«, sagt meine Tante, die ihrem Vater stets dankbar gewesen ist, »sich für seine Familie so durchgebissen zu haben«.