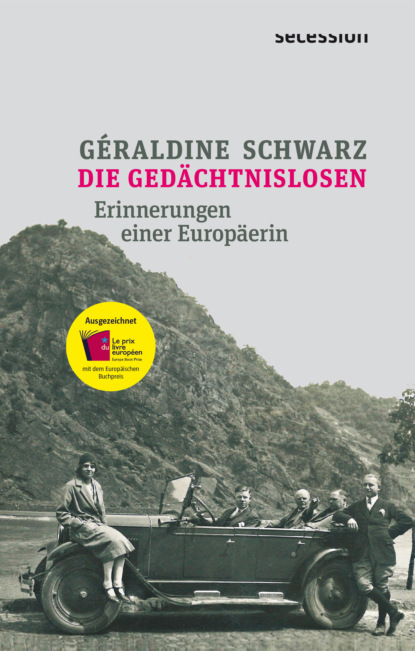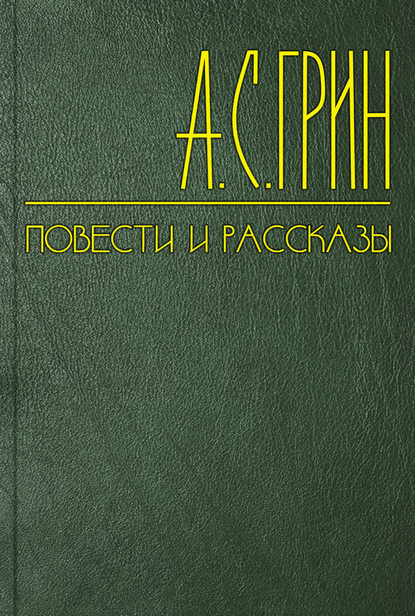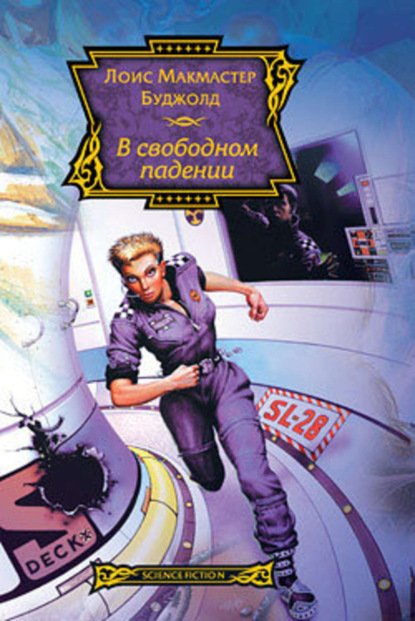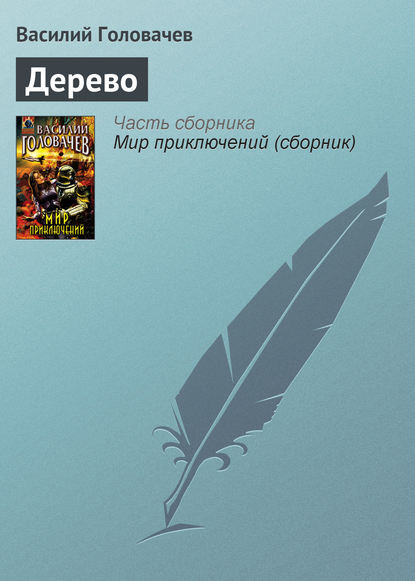- -
- 100%
- +
Ihre ganze Jugend lang verfolgte Lotte die rapide Verelendung der jüdischen Lebenswelt. Sie erinnert sich deutlich: »In meiner Klasse gab es fünf Jüdinnen, und auch wenn wir kein ausgeprägtes politisches Bewusstsein hatten, so verstanden wir doch, dass die Situation für uns schlimmer war, wir sprachen nur unter uns darüber. Unsere Mütter hatten sich verändert, sie waren besorgt, wir mussten unmittelbar nach der Schule nach Hause kommen, durften mit niemandem sprechen.« Eines Tages erklärten die Eltern ihr, dass sie keine deutsche Schule mehr besuchen dürfe und in eine jüdische Anstalt umgeschult werden müsse. »Der Lehrer war sehr nett, er entschuldigte sich gegenüber unseren Eltern und schlug sogar vor, abends Nachhilfestunden zu geben, sollten wir sie benötigen.«
Trotz dieser Verfolgung hatten 1936 nur 1.425 der insgesamt 6.400 Juden aus Mannheim die Stadt verlassen, während sich auf nationaler Ebene von der Gemeinde mit mehr als 500.000 Juden etwa 150.000 ins Exil begeben hatten. Vermutlich waren es jene, die schon am meisten gelitten hatten, da sie politisch engagiert waren, ihren Beamtenposten verloren hatten oder ihr Geschäft bankrottgegangen war. Paradoxerweise sollten sie dem Schicksal später dafür danken, die ersten Opfer gewesen zu sein, was sie zur rechtzeitigen Abreise motiviert hatte.
Weil es den Löbmanns mehr schlecht als recht gelang, ihre Geschäfte fortzuführen, war zu emigrieren für sie lange keine Option, so wie wohl für die meisten Juden in Deutschland, und sei es auch nur, weil es bedeutet hätte, das eigene Vermögen den Nazis zu überlassen. Wie so häufig im Dritten Reich war der Umgang mit Juden von einem tiefen Widerspruch geprägt. Auf der einen Seite wollten die Nationalsozialisten ihnen das Leben möglichst unerträglich machen, um sie zur Auswanderung zu bewegen. Auf der anderen Seite aber stellten die Behörden ihrem Fortzug unüberwindbare Schwierigkeiten in den Weg. So stieg die Steuer auf Devisentransfers aus Deutschland heraus bis 1934 auf 20 Prozent und bis 1939 auf einen mehr als abschreckenden Satz von 96 Prozent. Hinzu kam die Reichsfluchtsteuer: Ab einer Summe von 50.000 Reichsmark mussten die Emigranten dem Regime 25 Prozent ihres Gesamtvermögens und Einkommens abtreten. Ganz zu schweigen von dem Verwaltungslabyrinth, das es zu durchlaufen galt, wollte man legal auswandern.
Im Grunde aber lag das wesentliche Motiv der Abneigung der Juden gegen eine Auswanderung darin, dass sie gar keine Lust hatten, ihre Heimat zu verlassen, um sich in einem Land wie Palästina niederzulassen, einer Halbwüste mit kargem Klima und einer Kultur, die ihnen unendlich fremd war. Denn sie liebten Deutschland zutiefst.
Wie konnten sich die Löbmanns und die vielen anderen nur weiterhin einem Land verbunden fühlen, das sie dergestalt misshandelte, und warum haben sie nicht erkannt, wie ernst die Lage bereits für sie war?
In Wirklichkeit war die Gefahr für eine Unternehmerfamilie wie die Löbmanns gar nicht so deutlich lesbar, da zunächst keine nationalen Gesetze gegen jüdische Unternehmen erlassen wurden, was die Illusion aufrechtzuerhalten half, dass es Juden trotz allem möglich war, wirtschaftlich im Dritten Reich zu existieren und zu überleben. Und dies nur umso mehr, als sich zur Abfederung der Auswirkungen der Boykottbewegung eine ökonomische Parallelwelt herausgebildet hatte, die ausschließlich aus jüdischen Unternehmern, Händlern und Kunden bestand.
Hinzu kam Selbstverblendung. Lotte Kramer, deren Vater »ununterbrochen wiederholte, dass er nicht fortgehen wollte«, erklärte mir, der Wille ihrer Familie dazubleiben, sei so stark gewesen, dass jedes kleine Zeichen von Solidarität innerhalb der deutschen Gesellschaft genügt habe, um sie zu beruhigen. »In der Schule hatte ich eine nicht jüdische Freundin. Als die Juden die Schule verlassen mussten, sagte deren Mutter zu meiner: ›Ich will, dass unsere Töchter Freundinnen bleiben.‹ Es war dann meine Mutter, die sie davon überzeugen musste, dass dies zu gefährlich war. Aber diese Reaktionen schenkten neues Vertrauen.«
Man teilte positive Erlebnisse miteinander, etwa jenes von einem Pärchen, das der Polizei dummes Zeug erzählt hatte, um seine bedrohten Nachbarn zu decken, oder das vom kleinen, anonymen Koffer voller Medikamente, den eine gute Seele vor der Haustür einer jüdischen Familie abgestellt hatte, deren Kinder krank waren. »Meine Eltern hatten sehr enge nicht jüdische Freunde, Greta und Bertold, die abends, als sich die Lage bereits verschlechtert hatte, heimlich zu uns kamen, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei, und uns dabei Sachen brachten, die zu besorgen für uns kaum mehr möglich war. Sie gingen ein ziemlich hohes Risiko ein.« Die Tragik dabei aber war, dass diese Herzensseelen mit ihrer gut gemeinten Hilfe, ohne es zu wissen, die Gemeinde noch ermutigten, weiterhin das Beste zu erhoffen, obwohl es zu dieser Zeit noch möglich gewesen wäre, der Falle zu entkommen, von der niemand ahnen konnte, wie tödlich sie sein sollte.
Ich habe über die Solidaritätsbekundungen nachgedacht, die den Löbmanns das Herz erwärmt haben mussten, und ich glaube, es war vor allem die Treue zumindest eines Teils ihrer Kundschaft. Ich habe eine mehrseitige Liste gefunden, die Opa mit der Firma übernommen hatte. Dieser lange Parademarsch an Namen erzählt von einem anderen Deutschland, von jenen Menschen nämlich, die ihre Loyalität nicht aufgekündigt hatten.
Lotte Kramer liefert mir noch eine andere Erklärung für deren Illusion: »Wir hatten das Gefühl einer gewissen Normalität, denn innerhalb der jüdischen Gemeinschaft ging das Leben weiter. Vielleicht war die Ausgrenzung auf dem Land und in den Dörfern schneller spürbar gewesen, aber in großen Städten wie Mainz und Mannheim konnte man die Verbote leichthin vergessen, da alles intern gelebt wurde. Es gab die jüdische Schule, den jüdischen Sportklub, Tanzkurse, Feste, Konzerte und viele Freunde … Und es gab die Synagoge, sie spielte eine wichtige Rolle im Zusammenhalt der Gemeinschaft. Die Löbmanns, sie gingen regelmäßig zur Synagoge.«
Die kleinen, mir von Lotte gelieferten Hinweise waren entscheidende Teile des Puzzles, die mir gefehlt hatten, um zu begreifen, warum die Löbmanns und mit ihnen die große Mehrheit der Juden bis zur letzten Minute geglaubt hatten, in ihrem Land weiterhin eine erträgliche Existenz führen zu können und dass ihr Heimatland wieder zur Besinnung kommen und endlich aufhören würde, Juden zu verstoßen, die den Wissenschaften, der Philosophie, der Literatur, den Künsten und der Wirtschaft unzählige Talente geschenkt hatten, ohne die Deutschland niemals auf so vielen Gebieten solch strahlende Erfolge hätte feiern können. Am Ende hatten sie sich eher mit dieser erniedrigenden Behandlung abgefunden, als den Exodus zu wählen.
Darum musste die Familie Löbmann alle Hoffnung aufgegeben haben, als sie sich schließlich doch entschied fortzugehen. Von 1936 an begann das Regime, das bis dahin einer »Entjudung« der Wirtschaft keine Priorität gegeben hatte, das Ruder herumzureißen. Die Arbeitslosigkeit war stark zurückgegangen, die Wirtschaftskrise überwunden, von nun an galt die Arisierung jüdischer Güter als vorrangiges Ziel. 1938 erließ Berlin immer mehr Sonderregelungen für jüdische Unternehmen, mit denen deren Inhaber, die ihre Firmen bislang nicht verkauft hatten, gezwungen werden sollten, diese an »Arier« zu übertragen. Für die Firma Siegmund Löbmann & Co. lag der erste Schlag in der drastischen Senkung der den Juden bewilligten Einkaufsquoten von Werkstoffen, was sich auf den Handel mit Erdölprodukten fatal auswirkte. Dann wurden sie gezwungen, in einem Verzeichnis detaillierte Angaben über die Gesamtheit ihrer Besitztümer einzutragen: von Immobilien über Betriebsvermögen, Versicherungen, Wertpapiere, Bargeld, Schmuck, Kunst bis hin zu ihrem vollständigen Haushalt. Eine weitere Verordnung verlangte schließlich, dass alle jüdischen Firmen als solche erkennbar waren. Gleichzeitig verschärften die Nationalsozialisten die politische Verfolgung der jüdischen Gemeinde: Polizeirazzien, willkürliche Internierungen, Zerstörungen von Kultstätten. Diese alarmierende Entwicklung dürfte es gewesen sein, die Siegmund und Julius überzeugte, sich von ihrer Firma zu trennen, um mit dem Verkaufserlös ihre Auswanderung zu finanzieren. Aber sie waren nicht die Einzigen, Zehntausende Juden boten 1938 ihre Unternehmen gleichzeitig zur Übernahme feil, womit ein erdrückendes Überangebot entstand. Unter diesen Bedingungen war klar, wen der Markt begünstigte.
Die Aussicht, ein gutes Geschäft machen zu können, hat möglicherweise die Entscheidung von Karl Schwarz beeinflusst, die Ölfirma Nitag zu verlassen, bei der er immerhin die sichere Stelle eines Generalbevollmächtigten innehatte, ein ordentliches Gehalt verdiente und ausreichend Respekt genoss, um 1935 innerhalb der Firma zum Delegierten der nationalsozialistischen Deutschen Arbeitsfront befördert zu werden. Es war übrigens auch das Jahr, in dem er in die NSDAP eintrat, vielleicht weil die Parteimitgliedschaft eine Bedingung seiner Beförderung war. Unwahrscheinlich ist, dass er sich aus Begeisterung der Partei anschloss. Denn Opa war ein Hedonist, ein Lebemann, für den die sadomasochistischen Kraftmeiereien der Macht, mit denen sich die Nationalsozialisten hervortaten, wenig Anziehung besaßen. Deren blinder Gehorsam entsprach mitnichten seinem unabhängigen Geist, der seinen Freiraum beanspruchte. Er liebte es, allein in den Bergen, die Freiburg überragen, Ski zu fahren und an den Seen zu campen, wo er seiner Leidenschaft für die Freikörperkultur frönen konnte, einer Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland gegründet worden war. Bei Nitag dürften die Unterordnung unter seinen Chef, der die Regeln vorgab, die Routine des Angestellten und die Erwartung einer Beförderung als einzige jährliche Aufregung auf ihm gelastet haben. Er wird wohl von Unabhängigkeit geträumt und sich vorgestellt haben, dass er sich bei seiner Pfiffigkeit und seinem Kommunikationsgeschick auf eigene Beine stellen kann – und dies nur umso mehr, als er in seiner Jugend gelernt hatte, in einem Labor Petroleum und Paraffin herzustellen. Er hat das Zeugnis dieser Ausbildung aufbewahrt, auf dem präzisiert wird: »Wir waren während dieser Zeit mit der Führung, Fleiß und Betragen des Herrn Schwarz stets zufrieden.«
Vielleicht hätte mein Großvater es trotzdem nicht gewagt, allein in See zu stechen, wenn sein Kollege Max Schmidt ihm nicht eines Tages seine eigene Verachtung gegenüber diesem folgsamen Leben gestanden hätte. Ich stelle mir vor, wie die beiden ihren Abgang gleich einer Flucht aus der Gefangenschaft vorbereiteten, nach getaner Arbeit bei einem Glas Bier zum Feierabend. Und tatsächlich hatte das Vorhaben etwas von einem Komplott, da Karl und Max sich nicht nur vornahmen, zu zweit ein Konkurrenzunternehmen zu gründen, wenn auch ein sehr viel kleineres, sondern auch noch sieben ihrer Kollegen abzuwerben und deren Kundschaft gleich mit. Die Gelegenheiten, welche die zu Schleuderpreisen angebotenen jüdischen Firmen boten, dürften diese konspirative Atmosphäre nur noch verdichtet haben, denn mein Großvater war kein glühender Antisemit, er muss sich der Schande bewusst gewesen sein, die es bedeutete, aus der Not der Juden Profit zu schlagen.
Die beiden Komplizen suchten wahrscheinlich das Register der Firmen auf, die noch zu arisieren waren, etwa ein Drittel der insgesamt 1.600 jüdischen Unternehmen, die es in Mannheim gegeben hatte. Die anderen waren entweder bereits verkauft oder aber nach ihrem Bankrott liquidiert worden.
Wie mag der Seelenzustand, mit dem Karl und Max die Löbmanns trafen, zu beschreiben sein? Verlegenheit? Schuldgefühl? Oder war es die Arroganz derer, die sich in der Position des Mächtigeren wissen? Ich weiß es nicht, aber ich verfüge über einen Hinweis: Karl und Max haben 10.353 Reichsmark für die Firma bezahlt, also »nur« circa 1.100 Reichsmark weniger als der ursprünglich festgelegte Preis. Im Wissen, dass dieser den Erwartungen der NS-Obrigkeiten angepasst sein musste, um deren Einwilligung zum Handel zu erhalten, war es vielleicht ein Anflug von Mitgefühl, der es den beiden verbat, das Ganze noch weiter zu treiben. Sicher ist, dass es weitaus schlimmere Profiteure als meinen Großvater bei diesen Gaunereien gab, unerbittliche Aasgeier, welche die einerseits wachsenden Schwierigkeiten für jüdische Unternehmer, einen Käufer zu finden, und andererseits ihre bedrückende Not, genug Geld für den Wegzug und die Gründung einer neuen Existenz im Ausland zusammenzubringen, aufs Erbärmlichste ausreizten. Durch Großzügigkeit zeichnete sich Karl Schwarz jedoch auch nicht gerade aus, da er widerspruchslos die von den Nazis festgelegte Regelung zur Preisfindung anwendete: Nur der materielle Wert einer jüdischen Firma sollte berücksichtigt werden, für ihren immateriellen Wert aber sollte es keinen Pfennig geben. Damit wurde genau das ausgespart, was sie häufig am wertvollsten machte: die vielen Jahre, in denen man sich einen guten Ruf aufgebaut und also einen festen Kundenstamm gewonnen hatte, um eine Dienstleistung, ein Produkt, eine Marke zu verbessern, eine Formel zu entwickeln oder Patente zu sichern.
Nach dem Verkauf begleitete Julius Löbmann über mehrere Monate meinen Großvater für 400 Reichsmark auf dessen Geschäftsreisen, um ihn der Kundschaft der Firma vorzustellen – womit eben genau jener Wert realisiert wurde, den Karl Schwarz und Max Schmidt nicht bezahlt hatten. Ich denke, dass das Einvernehmen zwischen Karl und Julius verhältnismäßig »gut« gewesen sein muss, sonst wäre es wohl kaum zu diesen gemeinsamen Reisen gekommen, und dies erst recht, als es von nun an Juden verboten war, sich auf Geschäftsreise zu begeben. Unterkünfte und Restaurants, die sie über Jahre hinweg als Kunden empfangen hatten, verkündeten nun in ihren Schaufenstern: »Juden unerwünscht.« Ihre Lage verschlechterte sich zusehends. Berufsverbote häuften sich. Sie erhielten von Amts wegen einen zweiten Vornamen in ihre Personalpapiere gedruckt, damit man sie besser unterscheiden konnte: Sara für Frauen, Israel für Männer. Und schließlich wurde in ihre Pässe ein großes J gedruckt.
Während dieser Reisen muss Opa wegen Julius eine ganze Reihe von Leuten angelogen haben, Straßenpolizisten etwa, Hotelbesitzer oder auch Restaurantbetreiber … Dieses Risiko gemeinsam getragen zu haben, dürfte sie einander nähergebracht haben. Das aber sollte mit den Novemberpogromen 1938 ein Ende finden.
Am 9. November 1938 waren Julius und Opa zusammen im Schwarzwald auf Geschäftsreise, in einer idyllischen Kulisse aus Hügeln und Tannenwäldern. Als sie im Laufe des 10. November nach Mannheim zurückkehrten, hatte der antisemitische Hass eine weitere Gewaltschwelle überschritten. Ein brutaler Pogrom war quer durch das Reich von Mitgliedern der NSDAP, der SA und der Hitlerjugend angefacht worden, wobei Hitler »ausdrücklich seine Zustimmung zu den antijüdischen Aktionen gegeben« hatte, schreibt der Historiker Dietmar Süß in seinem Buch Ein Volk, ein Reich, ein Führer: Die deutsche Gesellschaft im Dritten Reich. Nach seinen Schätzungen »muss man wohl – als direkte oder indirekte Folge der Pogrome – von etwa 1.300 bis 1.500 Todesopfern und 1.406 zerstörten Synagogen ausgehen, 30.756 jüdische Männer wurden verhaftet und in Konzentrationslager gesteckt«.
Lotte Kramer hat es nicht vergessen: »Wir erhielten den Anruf eines Onkels, der gegenüber der Synagoge wohnte, wo sich auch unsere Schule befand, er sagte zu unserer Mutter: ›Schick deine Kinder nicht zur Schule, das Gebäude brennt!‹ Mein Vater bekam rechtzeitig den Rat, er solle verschwinden, woraufhin er sich in den Wäldern versteckte. Mit unserer Mutter sind wir hoch auf den Dachboden gestiegen, von wo aus wir durch das kleine Fenster hindurch die Leute auf der Straße sahen, wie sie Geschäfte verwüsteten; zum Glück kamen sie nicht zu uns. Mein Vater kehrte bei Einbruch der Nacht zurück und in dieser Nacht schlief ich im Bett meiner Eltern. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich wirklich Angst.«
In Mannheim begannen die Gewalttätigkeiten am 10. November bei Sonnenaufgang. Drei Synagogen wurden zerstört, eine von ihnen sogar mit Sprengsätzen pulverisiert, Männer wurden festgenommen, um sie später ins Konzentrationslager Dachau zu verschleppen. Profitgier war einer der Hauptbeweggründe für diesen Ausbruch an krimineller Energie: Der Großteil der jüdischen Läden wurde ebenso geplündert wie zahlreiche Wohnungen. Die Banditen des Nationalsozialismus machten in ihren Autos Plünderfahrten, drangen bei Armen ebenso ein wie bei Reichen, raubten, was sie konnten, und zerstörten den Rest. Viele Mannheimer Bürger waren von dieser Barbarei schockiert, die ihren verharmlosenden Namen »Reichskristallnacht« den Scherben von Millionen zersplitterten Scheiben schuldet. Opa wird ähnlich empfunden haben, als er, gerade zurückgekehrt von einer Reise, von seinem Lieferwagen aus dieses traurige Schauspiel betrachtete: brennende Bücher, Möbel, die aus den Fenstern auf den Bürgersteig flogen, zerstörte Fenster und Vitrinen. Julius an seiner Seite packte die Unruhe, als er erfuhr, dass Teile seiner Familie festgenommen worden waren. An diesem Tage beendeten sie ihre illegale Zusammenarbeit, sie war zu gefährlich geworden.
Die Verwandten von Julius konnten befreit werden und von nun war höchste Eile geboten, die Abreise in die USA zu organisieren. Die Familie hatte Kontakte nach Chicago und New York, wo Siegfried lebte, der Bruder von Irma und Mathilde Wertheimer, der in den Briefen an seine Schwestern Lobeshymnen auf Amerika sang. Die Löbmanns schickten tatsächlich erste Möbelstücke nach Chicago, was sie sich dank des Geldes aus dem Verkauf der Firma leisten konnten. Doch es war eine optimistische, wenn nicht gar naive Geste, denn wenn es schon vor 1938 äußerst schwierig war, ein Visum für die USA zu erhalten, so erwies sich dies von nun an als so gut wie unmöglich.
Angesichts der wachsenden Zahl jüdischer Flüchtlinge rief der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt im Juli 1938 zu einer internationalen Konferenz auf, in der vagen Hoffnung, dass die Teilnehmerstaaten sich verpflichten würden, zusätzliche Kontingente aufzunehmen. Nachdem Italien und die UdSSR die Einladung abgewiesen hatten, fanden sich die Vertreter von 32 Staaten und 24 Hilfsorganisationen für neun Tage in Évian-les-Bains ein, am Ufer des Genfer Sees. In der Kühle der Salons des majestätischen Hôtel Royal, zu seiner Einweihung 1909 als »schönstes Hotel der Welt« bezeichnet, Insel gekrönter Häupter und renommierter Künstler, lösten sich die internationalen Delegierten auf der Rednerbühne darin ab, ihr tiefstes Mitgefühl für das Schicksal der europäischen Juden auszudrücken. Aber niemand bot seine Gastfreundschaft an, abgesehen von der Dominikanischen Republik, die im Gegenzug dafür Subventionen einforderte. Die Vereinigten Staaten, von nur einem Geschäftsmann repräsentiert, weigerten sich, ihre festgelegte Quote von 27.370 Visa pro Jahr für Deutschland und Österreich zu erhöhen. Eines der einflussreichsten Länder der Erde hatte damit den Ton vorgegeben und der Rest der Welt zögerte nicht, ihm zu folgen.
Trotz der immensen Kolonialreiche, die Großbritannien und Frankreich damals noch besaßen, wurde keine einzige der denkbaren Optionen praktisch in Betracht gezogen, weder Palästina noch Algerien oder auch Madagaskar. Frankreich erklärte, dass es »einen äußersten Sättigungspunkt in der Flüchtlingsfrage« erreicht hätte. Der Abgesandte aus Australien ließ verlauten, sein Land, eines der weitläufigsten der Welt, habe »kein Rassenproblem« und verspüre »auch keine Neigung, durch eine ausländische Masseneinwanderung eines zu importieren«. Der Vertreter der Schweiz, Heinrich Rothmund, Chef der Fremdenpolizei, teilte mit, sein Land sei ein reines Transitland. Dieser notorische Antisemit hatte nie seinen Hass gegenüber Juden verhehlt, die er als »artfremde Elemente« betrachtete, welche die Schweiz mit »Verjudung« bedrohten.
Ich stelle mir diese Vertreter der »internationalen Gemeinschaft« mit ihren verstimmten und betont schmerzlich berührten Gesichtsausdrücken vor, wie sie zwischen zwei Anstandsreden im Schatten der eleganten Pergola dieses Hotels Erfrischungen zu sich nehmen, in dem einst Marcel Proust, Sohn einer elsässischen Jüdin, überzeugter Dreyfusianer, Passagen seines Buches Auf der Suche nach der verlorenen Zeit geschrieben hat, ein literarisches Meisterwerk, das ganz Frankreich zum Stolz gereichte. Die zukünftige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir, die nach Évian als »jüdische Beobachterin aus Palästina« geladen war, sollte später festhalten: »Dazusitzen, in diesem wunderbaren Saal, zuzuhören, wie die Vertreter von 32 Staaten nacheinander aufstanden und erklärten, wie furchtbar gern sie eine größere Zahl Flüchtlinge aufnehmen würden und wie schrecklich leid es ihnen tue, dass sie das leider nicht tun könnten, war eine erschütternde Erfahrung.«
Von was für Zahlen war die Rede? Es ging darum, unter 32 Staaten, die direkt oder indirekt über große Territorien verfügten, die etwa 360.000 Juden aufzunehmen, die es in Deutschland noch gab, zu denen noch etwa 185.000 Juden aus Österreich hinzukamen. Es handelte sich dabei zum Großteil um großstädtische, gut ausgebildete und praktisch erfahrene Bürger, die für viele Länder eine Bereicherung dargestellt hätten. Etwa für ein Land wie Argentinien, das angesichts seiner riesigen, unterbevölkerten Landstriche stets auf der Suche nach solchen Einwanderern war. Und doch unterzeichnete sogar noch vor dem Ende der Konferenz in Évian der argentinische Außenminister José Maria Cantilo ein Rundschreiben, das unter dem Siegel der Verschwiegenheit sämtlichen argentinischen Konsulaten befahl, Visa – auch Touristenvisa – allen Personen zu verweigern, »von denen anzunehmen ist, dass sie ihr Herkunftsland verlassen haben oder verlassen wollen, weil sie als unerwünschte Personen angesehen werden, oder des Landes verwiesen wurden, ganz unabhängig vom Grund ihrer Ausweisung« – mit anderen Worten: den Juden.
Es fällt schwer, in dieser pauschalen Zurückweisung von Flüchtlingen etwas anderes zu sehen als den Ausdruck einer internationalen Antisemitismus-Epidemie, die weit über die Grenzen des Dritten Reiches hinausragte. China, auf der Konferenz nicht vertreten, war eines der wenigen Länder, das europäische Flüchtlinge akzeptierte, sogar ohne Visum, weil es dort keine Einwanderungsquoten gab. Da sie nirgendwo anders hingehen konnten, begaben sich bis zu 20.000 Juden nach Schanghai, und dies der komplizierten Sprache, der fremden Kultur und der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse zum Trotz. Doch selbst in solcher Entfernung wurden sie noch von der langen Hand der Nazis erfasst: Ende 1941 sperrten die Japaner, die einen Teil Chinas okkupiert hatten, auf Druck ihrer deutschen Alliierten die europäischen Juden in ein Getto, wo 2.000 von ihnen unter desaströsen Lebensbedingungen starben.
Nicht einmal nach den Qualen der Novemberpogrome rührte sich die internationale Gemeinschaft. Einzig Großbritannien erklärte sich mit einer Geste bereit, 10.000 jüdische Kinder in britische Familien aufzunehmen, womit jene Kindertransporte gemeint sind, die Lotte Kramer das Leben gerettet haben. Zugleich aber schloss es mit Palästina, das unter britischem Mandat stand, eine der letzten noch offenen Türen für die europäischen Juden. Aus Angst, die bereits bestehenden Spannungen zwischen Arabern und Juden könnten sich noch weiter zuspitzen, legten die Briten zwischen 1939 und 1944 eine Quote für jüdische Migranten von insgesamt 75.000 Personen fest, während noch beinahe zehn Millionen Juden auf dem europäischen Kontinent lebten.
Nach dem 9. November 1938 und der sukzessiven Abschaffung der letzten Rechte, die Juden noch besaßen, machte sich Panik breit. Hunderttausende, die sich bis dahin geweigert hatten, verstanden plötzlich, dass sie das Land so schnell wie nur eben möglich verlassen mussten. Sie strömten in Massen vor die Konsulate der ganzen Welt, die schon in den Jahren zuvor immer weniger Visa ausgestellt hatten und sich nun angesichts dieses Ansturms an Hoffnungslosigkeit noch abweisender zeigten. Die Diplomaten hatten entsprechende Anweisungen erhalten.
»Mein Vater begab sich zum amerikanischen Konsulat und harrte dort sehr lange aus«, berichtet Lotte Kramer. »Er kehrte mit einer Nummer in der Hand nach Hause zurück, aber er befand sich so weit unten auf der Warteliste … Wir wussten, dass wir keinerlei Chance hatten. Meine Eltern versuchten es auch mit Panama, Ecuador, von wo aus sie hofften, in die USA gelangen zu können, aber sie erhielten nichts.« Trotz der evidenten Aufnahmekapazität dieses von europäischen Juden bevorzugten Ziellands, in dem viele bereits Familienangehörige besaßen, die sich aller Erfahrung nach hervorragend integriert hatten, blieben die USA ihrem Schicksal gegenüber ungerührt und hielten mit einer bürokratisch grausamen Hartnäckigkeit an ihrer Quote fest.