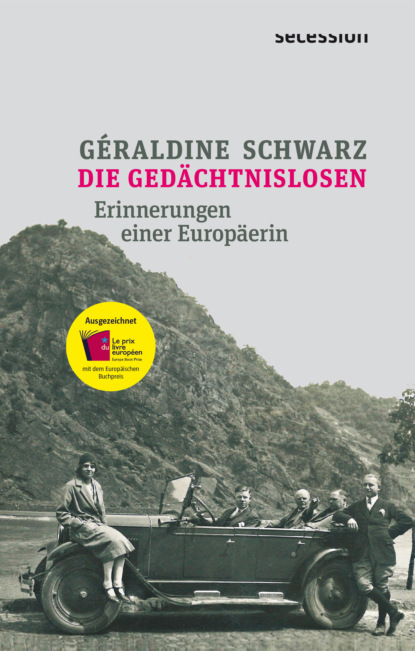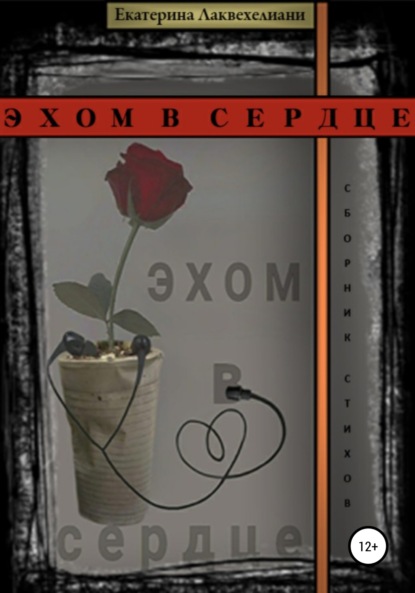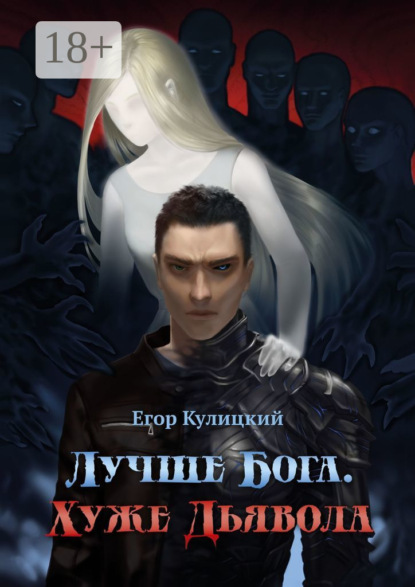- -
- 100%
- +
Eine der wohl dramatischsten Episoden dieser Politik bildete die Reise der St. Louis im Frühling 1939, einem transatlantischen Passagierdampfer aus Hamburg, der Havanna ansteuerte und 937 Personen an Bord hatte, fast alle von ihnen deutsche Juden, die Kuba als Transitland erreichen wollten, um von dort in die USA zu gelangen. Kuba aber, für das man zuvor in Deutschland noch Visa bekommen konnte, hatte in der Zwischenzeit wegen eines politischen Skandals die Einreisebestimmungen geändert. Provokateure hatten die öffentliche Meinung gegen Juden aufgeheizt und eine antisemitische Demonstration noch vor der Ankunft des Schiffes organisiert. Nur 29 Passagiere durften schließlich an Land gehen, die St. Louis aber wurde aus den kubanischen Gewässern verjagt.
Sie fand sich vor Miami wieder, und zwar so nahe der Küste, dass die Flüchtlinge die Lichter an Land sehen konnten. Kapitän Gustav Schröder und jüdische Organisationen versuchten, Präsident Franklin D. Roosevelt davon zu überzeugen, ihnen Asyl zu gewähren. Vergeblich. Der Hauptgrund dafür war die Stimmung in der amerikanischen Bevölkerung, die angesichts der während der Wirtschaftskrise gestiegenen Arbeitslosigkeit allergisch auf jegliche Immigration reagierte, vor allem auf die der europäischen Juden, deren Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt man mehr fürchtete, als dass man Verständnis für ihre Situation hatte. Es lag nun an Kanada, sich solidarisch zu zeigen, aber auch hier erwies sich der Immigrationsbeauftragte Frederick Blair als unerbittlich. Anfang Juni 1939 zurück in Europa, weigerte sich Kapitän Schröder, seine Passagiere an Deutschland auszuliefern, und ließ sie in Antwerpen an Land gehen. Ein Viertel von ihnen fand im Holocaust den Tod.
Die Familie Löbmann hat nie ein Visum erhalten. Es ist gut möglich, dass sie sich mit dem Möbeltransport in die USA an diese fast unmögliche Perspektive geklammert hat, um ihre materiellen Güter nicht aufgeben zu müssen, anstatt ihre Haut zu retten und es mit anderen Ländern zu versuchen. Aber auch ein Visum hätte ihnen mitnichten garantiert, sicher am gewünschten Ziel in Übersee anzukommen, denn dazu musste man zumindest ein, wenn nicht zwei Drittländer durchqueren, Frankreich, Portugal, Belgien, die Niederlande, die Schweiz, wo gewissenlose Mittelsmänner Bestechungsgelder verlangten, die umso höher wurden, je stärker die Not der Juden anwuchs. Reisebüros, Konsulate, Schlepper, Hotelbesitzer, bestochene Beamte – wie viele haben sich nicht am Antisemitismus bereichert! Die Mittel der Löbmanns aber waren begrenzt, da die Summe, die sie aus dem Verkauf ihrer Firma gezogen hatten, nach den für Juden geltenden Verordnungen auf einem vom Reich kontrollierten Konto, von dem sie jeweils nur kleinere Summen abheben durften, blockiert war.
Trotzdem war es noch nicht vollkommen unmöglich, Deutschland zu verlassen. Nach den Novemberpogromen 1938 konnten bis zu 40.000 Juden flüchten. Unter ihnen befand sich Lotte Kramer. Ihre Lehrerin an der Schule in Mainz hatte von den organisierten Kindertransporten nach Großbritannien gehört und einen Platz für sie gefunden. »Meine Mutter sprach mit ihrer Schwester Irma darüber, der es gelang, auch ihre beiden Kinder Lore und Hans im Transport unterzubringen. Ich wollte von meinen Eltern nicht getrennt sein, aber ich war mit meinen Cousins zusammen, und es war ein wenig wie ein Abenteuer.«
1939 konnten noch fast 80.000 Juden das Land verlassen, davon mindestens 1.000 Juden aus Mannheim. Einige von ihnen landeten in Indien oder Kenia, Länder, die nicht ihre erste Wahl gewesen waren.
Die Familie Löbmann hat vielleicht zu lange gezögert, sich von Amerika als Bestimmungsort abzuwenden und sich stattdessen mit dem Lebensminimum irgendwohin zu retten. Diese Abneigung gegen alles Improvisierte wurde zu ihrer Fessel. Je länger die Löbmanns abwarteten, desto mehr ging ihr Vermögen zur Neige und damit die Chance, doch noch auswandern zu können. Denn nach dem 9. November 1938 gab es kein Halten mehr bei den organisierten Plünderungen. Um die Juden für jene Pogrome zu bestrafen, deren unglückselige Opfer sie selbst ja waren, forderte das NS-Regime von ihnen eine Sühneleistung in Form einer neuen Steuer, der Judenvermögensabgabe, mit der die Nationalsozialisten 25 Prozent des Vermögens derer ergaunerten, die wie die Löbmanns mehr als 5.000 Reichsmark besaßen. Dann befahl man ihnen im Februar 1939, sämtliche Gegenstände aus Silber, Gold und Platin auszuhändigen, ebenso wie Perlen und Edelsteine, und zwar für einen Preis, der häufig nur ein Zehntel des eigentlichen Wertes ausmachte. Wenige Monate später zwang eine neue Verordnung diejenigen, die das Land verließen, zusätzlich zur Steuer auf Devisen und zur Reichsfluchtsteuer eine progressive Auswandererabgabe zu bezahlen.
Die Lage der in Deutschland festsitzenden Juden verschlimmerte sich zusehends. Hitler hatte entschieden, sie endgültig aus dem Wirtschaftsleben und der Arbeitswelt auszuschließen. Diejenigen, die bereits alles verloren hatten, wurden zwangsweise herangezogen, um Straßen zu bauen oder den Müll zu entfernen, während Firmen, die noch nicht arisiert worden waren, zu Schleuderpreisen verkauft wurden. Einige Juristen trieben den Zynismus so weit, dass sie die Eigentümer, die in Dachau eingesperrt waren, aufsuchten, um sie den Verkaufsvertrag unterzeichnen zu lassen. Man riss sich Grundstücke unter den Nagel, auch die der Synagogen, der jüdischen Organisationen, der jüdischen Friedhöfe. In Mannheim, wie Christiane Fritsche berichtet, hat selbst die evangelische Kirche an dieser finsteren Zerlegung teilgenommen – und damit die Preise aufs Erbärmlichste gedrückt.
Am Morgen des 22. Oktober 1940 tauchten Nazi-Schergen in den Häusern der Löbmanns sowie bei Wilhelm Wertheimer, dem Bruder von Irma und Mathilde, auf und befahlen ihnen, ihre Koffer zu packen: Jeder Erwachsene hatte das Recht auf maximal 50 Kilogramm Gepäck sowie 100 Reichsmark und sollte Nahrung und Wasser für drei Tage mitnehmen. Ihre Konten, ihre Wertpapiere sowie ihr Grund und Boden wurden mit allem, was sie beinhalteten, gepfändet. Wenige Stunden später warteten sie auf dem Gleis des Mannheimer Bahnhofs gemeinsam mit ungefähr 2.000 anderen Juden der Stadt darauf, in einen Zug zu steigen, dessen Ziel sie nicht kannten. Ungefähr die Hälfte der Mannheimer Gemeinde war in den Jahren davor ins Exil geflohen. Acht Juden hatten sich noch am Morgen der Razzia das Leben genommen. Mehreren Hundert war es gelungen, sich zu verstecken, nur Ehepartner arischer Personen wurden verschont.
Am 23. Oktober setzte sich ein aus neun Zügen bestehender Konvoi mit etwa 6.500 Gefangenen in Bewegung. 4.500 weitere Juden aus dem Südwesten Deutschlands, dem Saarland, aus Baden und der Pfalz waren ebenfalls im Rahmen dieser Aktion verhaftet worden. Nachdem der Transport bei Kehl den Rhein überquert hatte, kam er nachts in Chalon-sur-Saône an, einem Ort, der direkt an der Demarkationslinie lag, die Frankreich nach der Niederlage in eine vom Dritten Reich besetzte Zone im Norden des Landes und eine sogenannte »freie« Zone im Süden unterteilte, die von der begrenzt autonomen französischen Regierung mit Sitz in Vichy kontrolliert wurde. Anders als die Deutschen es sich ausgemalt hatten, legte Vichy, das inzwischen ein eigenes »Judenstatut« zu deren Diskriminierung eingeführt hatte, Protest ein. Vor vollendete Tatsachen gestellt, ließen die französischen Behörden jedoch die Züge in die »freie« Zone einfahren, in der die Deutschen theoretisch kein Sagen hatten, wobei sie deutlich darauf hinwiesen, dass es außer Frage stand, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen durfte.
Nach zwei Tagen, während derer sie der Brutalität der SS ausgeliefert waren, kamen die Passagiere, von denen viele hohen Alters waren, im Lager Gurs im Südwesten Frankreichs an. In diesem von Vichy verwalteten Internierungslager befanden sich Juden und Nicht-Juden aller Nationalitäten – mit Ausnahme der französischen, die entweder von den Nazis deportiert wurden oder aber vom französischen Regime in der »freien« Zone verhaftet worden waren. In Gurs gab es weder Hinrichtungen noch Folter, aber Hunderte der Häftlinge starben aufgrund der Lebensbedingungen, sie verhungerten oder kamen vor Kälte um in diesen fensterlosen Baracken, in denen es weder sanitäre Anlagen noch fließendes Wasser gab, in die der Regen eindrang und wo das Bettzeug aus mit Stroh gefüllten Säcken bestand, die auf den schlammigen Boden geworfen waren. Irma Wertheimer, die Ehefrau von Siegmund Löbmann, erkrankte schwer und wurde Ende November 1941 in ein Hospital in Aix-en-Provence transportiert. Siegmund wurde in das nahe gelegene Internierungslager Les Milles überführt, um in ihrer Nähe sein zu können.
Aus Gurs zu fliehen war verhältnismäßig einfach, da dessen Umzäunung nur zwei Meter hoch und weder elektrisiert noch mit Wachtürmen verstärkt war. Dennoch gab es wenige Fluchtversuche, da die größere Herausforderung erst noch folgte: ein langes, angsterfülltes Versteckspiel mit der Polizei. Vermutlich weil ein solcher Ausbruch mit Kindern und älteren Eltern unvorstellbar war, zogen viele Gefangene die Familie der Freiheit vor.
In Gurs hatten religiöse und humanitäre Verbände die Erlaubnis erhalten, Nahrung zu liefern, medizinische Versorgung anzubieten und den Alltag der Inhaftierten zu erleichtern. Eine von ihnen, die internationale jüdische Hilfsorganisation HICEM, half den Juden dabei, die nötigen Unterlagen für die Einreichung einer Emigrationsanfrage zusammenzustellen. Jene, denen dies gelang, baten den Vorsteher des Lagers, nach Marseille, diesem großen französischen Hafen am Mittelmeer, überführt zu werden, hegten sie doch die Hoffnung, sich von dort aus nach Übersee einschiffen zu können. So gelangten im April 1941 schließlich auch Julius und Mathilde Löbmann mit ihrem Sohn Fritz sowie Wilhelm Wertheimer und seine Frau Hedwig mit ihrem Sohn Otto nach Marseille. Dank der Unterstützung der Mitarbeiter aus der Gedenkstätte des Lagers Les Milles, einer der Vorzeigeinstitutionen in Frankreich, um die jungen Generationen für dieses Gedenken zu sensibilisieren, konnte ich den weiteren Weg der Mitglieder dieser Familie nachzeichnen.
Die Männer kamen nach Les Milles, das unter der Verwaltung von Vichy stand und wo zahlreiche Künstler und Intellektuelle wie etwa Golo Mann und Lion Feuchtwanger interniert waren. Die Frauen und Kinder wurden in zu Unterbringungszentren umfunktionierten Hotels in der Innenstadt von Marseille geschickt.
Hedwig und Otto, der damals neun Jahre alt war, wurden ins Hôtel Bompard gebracht, Mathilde und Fritz, damals zwölf Jahre alt, ins Hôtel Terminus les Ports. Man litt an Unterernährung, an Hygienemangel, an Ungeziefer, an mangelnder Kleidung und Kälte in diesen Häusern, in denen die Stromversorgung und das Wasser rationiert waren und deren Besitzer oft nicht die geringsten Skrupel hatten, die vom französischen Staat ausgezahlten Aufwandsentschädigungen in die eigene Tasche zu stecken und nur einen Bruchteil den Gästen zugutekommen zu lassen. Außerdem war man dem Gutdünken widerwärtiger Figuren wie dem Arzt Félix Roche-Imbart ausgesetzt, der seiner sadistischen Lust frönte, die Unterbringung erkrankter Gäste in Hospitälern und Sanatorien zu verhindern und ihnen den Besuch von Ehegatten zu verbieten. Trotz allem waren im Vergleich zum Lager in Gurs die Lebensbedingungen deutlich bessere. Internationale Hilfsorganisationen gaben Kindern Unterricht und richteten für die Mütter Nähkurse ein, vor allem aber konnten die meisten Frauen sich frei in der Stadt bewegen, am Strand spazieren gehen und weiterhin versuchen, die notwendigen Behördenwege zu erledigen, um auswandern zu können.
Laut Archiv des Lagers Les Milles muss Hedwig versucht haben, für ihre Familie amerikanische Visa zu erhalten. Was wahrscheinlich auch für Mathilde gilt. Sie kamen zu spät. Kurz zuvor war ein solches Ziel noch umsetzbar, dank des amerikanischen Vizekonsuls in Marseille, Hiram Bingham IV, der Visa und gefälschte Papiere beschaffte. Oder aufgrund der Hilfe des amerikanischen Journalisten Varian Fry, dem es gemeinsam mit einem großen Netzwerk an Unterstützern gelungen war, mehr als 2.000 Juden aus Frankreich herauszuschleusen, unter denen sich hauptsächlich Künstler, Intellektuelle und Wissenschaftler wie Claude Lévi-Strauss, Max Ernst, Hannah Arendt oder Marc Chagall befanden. Als Reaktion, aber auch auf Druck des Vichy Regimes hin, entzog das Aussenministerium in Washington dem Konsulat die Entscheidungshoheit in Sachen Visavergabe, versetzte Hiram Bingham IV nach Portugal und konfiszierte den Pass von Varian Fry.
Hedwig Wertheimers und Mathilde Löbmanns Bestrebungen zur Emigration scheiterten im Sommer 1942, sie wurden mit ihren Söhnen nach Les Milles überführt, wo sie wieder auf ihre Ehemänner Julius und Wilhelm trafen. Die Stimmung war bedrückend. Im Lager Drancy nördlich von Paris hatten die Deportationen nach Auschwitz begonnen. Offiziell hieß es, um die Häftlinge in Arbeitslager zu bringen. Beim Anblick der Viehwaggons, in die man ganze Familien ohne Wasser einpferchte, fragten sich viele, warum man wohl auch Kinder, die gar nicht befähigt waren zu arbeiten, in die Züge zwängte. Es war auch schon von Massakern die Rede.
Hedwig und Mathilde mussten die Gefahr gerochen haben. Wie andere Mütter auch, entschieden sie sich, ihre Söhne dem jüdischen Kinderhilfswerk anzuvertrauen. Zeugen haben von herzzerreißenden Trennungen berichtet, dem Weinen der Kinder, die man von ihren Müttern trennte, die wiederum damit zu kämpfen hatten, Haltung zu wahren, um ihre Kleinen nicht zu beunruhigen. Otto wurde ins Château de Montintin südlich von Limoges gebracht, wo sich mehrere Hundert Kinder zwischen 12 und 17 Jahren versteckt hielten, unter ihnen vor allem deutsche Juden, die dort von einem Arzt beschützt wurden. Fritz ging in eine ähnliche Anstalt, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die Kinder vor der Deportation zu retten.
Im Frühling 1943 hatten die beiden Cousins das Glück, noch einmal in einem der letzten Zufluchtsorte Frankreichs vereint zu sein, der in der damals von Italien besetzten Zone im Südosten Frankreichs lag. In Izieu, einem kleinen, hoch gelegenen Dorf an den Hängen eines Arms der Rhône, hatte die polnisch-jüdische Widerstandskämpferin Sabine Zlatin gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Heim errichtet, wo sie die Kinder vor der Deportation bewahren wollte. Zum ersten Mal seit Langem konnten Fritz und Otto wieder an die Leichtigkeit der Kindheit anknüpfen. In der Gedenkstätte von Izieu zeigen Fotos diese Kinder auf einer weiten Wiese, ihr Haar im Wind, als Gruppe vor einem Haus, die Großen tragen die Kleineren auf ihren Armen, in Badehose auf einem Steg an einem See. Sie lächeln fast immer und es ist auf diesen Bildern, die Aufnahmen welcher glücklichen Kindheit auch immer sein könnten, nicht der Hauch eines Vorzeichens zu sehen.
Die italienische Besatzungszone war für Juden die sicherste, da sich die Italiener, im Gegensatz zu den Franzosen, so gut es ging weigerten, sie auszuliefern. Im September 1943 aber, nach der Kapitulation des faschistischen Italiens, kippte die Situation, da nun die Deutschen die italienische Zone in Frankreich besetzten. Die aufkommende Gefahr ahnend, machte sich Sabine Zlatin Anfang April 1944 auf, eine andere Zufluchtsstätte zu finden. Doch während ihrer Abwesenheit geschah es am Morgen des 6. April, dem ersten Tag der Osterferien, als die Kinder gerade dabei waren, ihr Frühstück vorzubereiten, dass zwei Lastwagen der Wehrmacht und ein Dienstwagen der Gestapo die 44 Jungen und Mädchen, den Ehemann von Sabine Zlatin und sechs Erzieher festnahmen und ins Lager von Drancy brachten. Der Befehl dazu stammte vom Leiter der Gestapo in Lyon, Klaus Barbie, einem Mann, der für seine an Wahnsinn grenzende Besessenheit berüchtigt war, Juden und Widerstandskämpfer zu jagen, die er dann mit hemmungsloser Leidenschaft allen möglichen Foltermethoden unterwarf, deren genialer Erfinder er sich zu sein rühmte.
Am 15. April 1944 wurden Fritz Löbmann und Otto Wertheimer, damals 15 und 12 Jahre alt, in einem Konvoi zusammen mit 30 anderen Kindern von Izieu nach Auschwitz deportiert. Am Tag ihrer Ankunft wurden sie vergast.
Zwei Jahre zuvor waren die Eltern von Otto Wertheimer, Hedwig und Wilhelm, und die Mutter von Fritz Löbmann bereits nach Drancy überführt worden. Am 17. August wurden sie mit dem Konvoi Nummer 20 verschleppt. Endstation: Auschwitz. Am 2. September war es dann Siegmund, der nach Drancy kam, er wurde am 7. September mit dem Konvoi Nummer 29 deportiert. Endstation: Auschwitz. Seine Einsamkeit wird seine Notlage nur noch schlimmer gemacht haben. Seine Frau Irma stand auf der Liste der zu Deportierenden des Lagers Les Milles, dürfte aber wohl in letzter Sekunde gerettet worden sein, und dies womöglich von Medizinern, die ihre Notaufnahme im Krankenhaus von Aix-en-Provence verlangten.
Julius Löbmann stand ebenfalls auf der Liste, war jedoch nicht auffindbar. Ihm war die Flucht gelungen. Da es so gut wie unmöglich war, aus Les Milles zu entkommen, musste Julius während einer seiner alltäglichen Wege ins nahe gelegene Dorf Saint-Cyr-sur-Mer geflohen sein, wo er als Teil eines Trosses von Zwangsarbeitern im Dienste der französischen Industrie und Landwirtschaft (GTE) arbeitete. Er muss sich wohl unversehens entschieden haben, als er begriffen hatte, dass seine Familie nicht entkommen würde. Er allein konnte fliehen, die anderen saßen im abgeschlossenen Bereich des Lagers in der Falle. Ich stelle mir vor, wie er sich von seiner Frau verabschiedet, von seinem Sohn, seinem Bruder, seinem Schwager und in der Nacht vor seiner Flucht kein Auge zugemacht hat. Und dann am eigentlichen Tag, an dem es galt, den richtigen Moment zu erfassen, um sich davonzustehlen, um in die Pinienwälder von Saint-Cyr-sur-Mer zu verschwinden oder auf dem Rückweg vom Wagen abzuspringen.
Die Chancen für einen geflohenen Juden, der ohne Geld, ohne Kontakte und ohne irgendwelche Kenntnisse über Frankreich sich selbst überlassen war, waren unter einem Regime, das mit Deutschland kollaborierte und aus freien Stücken antijüdische Verordnungen eingeführt hatte, äußerst gering. Es sei denn, das Schicksal entschied sich, großmütig zu sein und ihn mit einem dieser mutigen und mitfühlenden Franzosen zu begünstigen, die während des Krieges Juden in ihren Kellern oder auf ihren Dachböden versteckt hielten und ihnen regelmäßig heimlich brachten, was zum Überleben reichen musste. Aber selbst dieses Szenario konnte tragisch enden, wenn der Schutzengel denunziert und von der Gestapo oder der französischen Polizei verhaftet wurde und seine Schützlinge gefangen oder in ihren Löchern ohne irgendeine Hilfe zurückblieben.
Wer auf sich allein gestellt blieb, der musste schlau und verwegen sein; und schenkt man Lotte Kramer Glauben, so war Julius dies. Um nicht Gefahr zu laufen, seine Herkunft preiszugeben, gab er sich als taubstumm aus und ließ sich in einem großen Hotel an der Côte d’Azur wahrscheinlich irgendwo in der italienisch besetzten Zone zwischen Nizza und Menton als Liftboy anheuern. Ich weiß nicht, ob sein Patron geahnt hat, mit wem er es zu tun hatte, er besaß jedoch die Güte, trotz der fehlenden Papiere dieses ulkigen Kerls mit Pupillen so blau und Haaren so blond wie bei einem Deutschen ein Auge zuzudrücken.
Nach dem Einmarsch der Deutschen in die italienische Zone muss Julius miterlebt haben, wie Offiziere der Wehrmacht und der SS in dem Hotel abgestiegen sind. Wie viele Male täglich hat er wohl das Martyrium erleiden müssen, diese Männer auf ihre Etage zu fahren, in der Enge der Aufzugskabine ihre Uniformen zu streifen, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließen, seine Hände zittern zu fühlen, wenn er den Knopf bediente, und sein Herz vor Angst trommeln zu spüren, dass ihm ein Blick, ein Reflex passieren mochte, ein »Bitte schön« oder ein »Danke« oder ein »Guten Morgen« – ein einziges Wort auf Deutsch und er wäre verloren gewesen. Im Sommer 1944 wurde er von diesem Druck befreit, als die Truppen der Alliierten in der Normandie und später in der Provence landeten und die Besatzer aus Frankreich verjagten. Vielleicht ging er nach Drancy in der Hoffnung, dort seine Lieben wiederzufinden, und erfuhr dann, dass alle Gefangenen nach Auschwitz gebracht worden waren. War Julius in diesem Moment bereits klar, wofür der Name Auschwitz stand?
Seit dem Sommer 1941 wussten die Briten, dass die Kommandos der SS, deren Funkverschlüsselung sie dechiffriert hatten, im Osten Europas Massaker anrichteten. In der Folgezeit gab es dafür immer mehr Indizien, die den Alliierten aus unterschiedlichen Quellen der deutschen Armee, von Vertretern der jüdischen Bevölkerung und von polnischen Widerstandskämpfern zugespielt wurden. Im Frühling 1942 zeigte sich der Daily Telegraph alarmiert: »Mehr als 700.000 polnische Juden sind bei einem der größten Massaker der Weltgeschichte ermordet worden.« Immer mehr Medien verbreiteten diese Informationen, selbst die Gaskammern wurden erwähnt. Am 17. Dezember 1942 verurteilten die Alliierten diese »bestialischen Vernichtungsmethoden« öffentlich und einhellig. Der britische Radiosender BBC übertrug die Erklärung, die wörtlich lautete: »Niemand wird niemals mehr sagen können, er habe nie etwas von Deportierten gehört. Diejenigen, die fähig sind zu arbeiten, werden in den Lagern ausgebeutet, bis sie vor Erschöpfung sterben. Die Kranken und Gebrechlichen sterben vor Kälte oder an Hunger oder werden brutal umgebracht.« Die amerikanischen, britischen und sowjetischen Regierungen wussten sogar, dass schon mehr als zwei Millionen Juden umgebracht worden und fünf Millionen aufs Schlimmste bedroht waren.
Da diese Informationen von Vichy-Frankreich zensiert wurden, wird Julius einen letzten Funken Hoffnung bewahrt haben, vor allem für seinen kleinen Fritz, diesen Jungen, der noch ein Kind war. Die Nazis würden doch wohl nicht auch noch Kinder ermordet haben. Aber an wen konnte er sich wenden und um Hilfe bitten? Seine ganze Familie, all seine Freunde waren verschwunden, und das befreite Frankreich kümmerte sich keinen Deut um die dem Tod entronnenen Juden. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als nach Amerika zu gehen, nach Chicago, jener Stadt, in die seine Familie geplant hatte zu fliehen, bevor sie von Mannheim fortgerissen wurde.
Während der Überquerung des Atlantiks muss Julius an Bord des Schiffes, das sich von einem in Feuer und Blut versinkenden Europa entfernte, ein Gefühl tiefer Traurigkeit bei der Vorstellung übermannt haben, diese Reise nun allein angetreten zu haben, mit der sich die Seinen als letzten Ausweg voller Bitterkeit abgefunden hatten, und von der er niemals geglaubt hätte, dass sie sich eines Tages in einen unerreichbareren Traum verkehren sollte: sie alle gemeinsam auf diesem Schiff, befreit vom Untergang ihres Heimatlandes. Die Augen auf den Horizont gerichtet, an dem bald schon der ersehnte amerikanische Kontinent aufscheinen sollte, wird Julius wohl gespürt haben, dass er dort niemals das Leben mit seinem Sohn Fritz teilen würde, auch nicht mit seiner Frau Mathilde und auch nicht mit seinem Bruder Siegmund.

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.