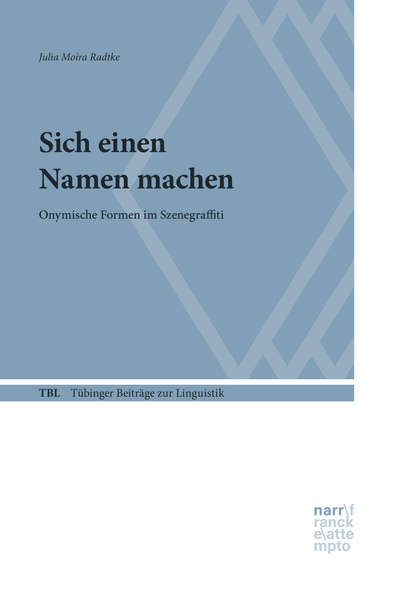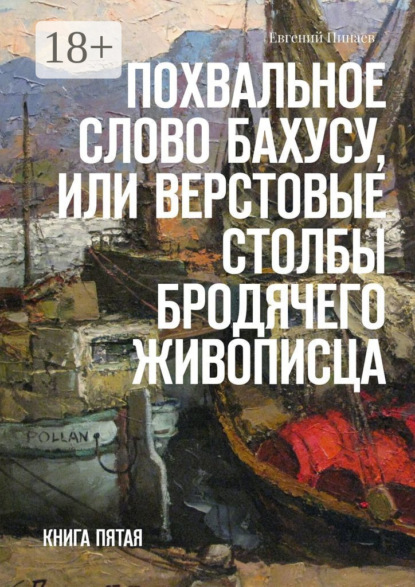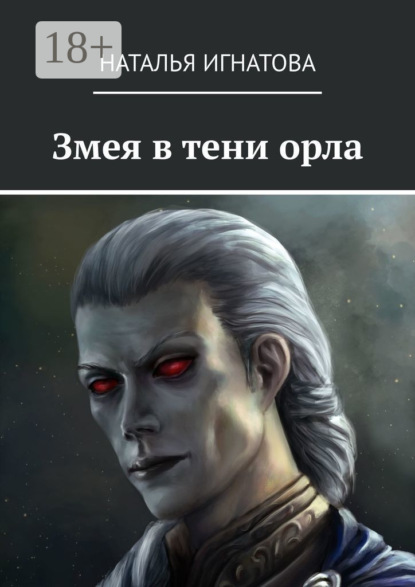- -
- 100%
- +
Jede musikalische Stilepoche bietet damit den Sprachtheoretikern eigene, im Großen und Ganzen vergleichbare, aber im Detail doch differenzierbare Möglichkeiten, prosodische Parameter mit den Mitteln der üblicherweise verwendeten Partitur zu visualisieren.
Stilisierte Formen
Eine zweite Gruppe von Abbildungen nutzt ebenfalls das musikalische System, verzichtet aber auf Notenzeichen. Dieses Verfahren haben in Frankreich die ersten Phonetiker des 19. Jahrhunderts entdeckt und genutzt, um entweder extrem genaue Angaben machen zu können (RousselotRousselot, Jean-Pierre, 1897; RoudetRoudet, Léonce, 1899; vgl. Bsp. 7), oder aber, in einer freieren Auslegung (Linie anstelle von Notenköpfen), um den kontinuierlichen Verlauf der Sprachmelodie zu akzentuieren (MarichelleMarichelle, Hector, 1897, vgl. auch Bsp. 8).
Im ersten Fall ist das traditionelle Notensystem an die Bedürfnisse der Phonetiker angepasst. Bei RousselotRousselot, Jean-Pierre entspricht jede Linie des Systems (und damit auch jeder Zwischenraum) einem Halbton, und nicht etwa einer festgelegten Folge von Ganz- und Halbtönen. Diese Änderung ermöglicht sicherlich das Lesen des Schemas für musikalische Laien, sie hat aber auch in besonderer Weise Einfluss auf den entstehenden Verlauf der melodischen Linie, die nunmehr die realen akustischen Vorgänge direkt, ohne Umweg über die Musiktheorie (das heißt, zumindest die Kenntnis der diatonischen Tonleiter), abbildet.
Bei Léonce RoudetRoudet, Léonce wie auch bei RousselotRousselot, Jean-Pierre sind die experimental gewonnenen Tonhöhen pro Silbe oder Phonem mittels einer mehr oder weniger gerundeten Linie verbunden. Der optische Eindruck ist der einer kontinuierlichen Stimmgebung, wobei die Tonhöhenentwicklung gewissermaßen stufenweise von einer Note zur nächsten erfolgt. Hector MarichelleMarichelle, Hector dagegen verzichtet auf die Angabe einzelner Tonhöhen. Seine Transkription in Form von durchgängigen Kurven hat zum Ziel, auf die kontinuierlichen und glissandoartigen (gleitenden) Intonationsvariationen hinzuweisen, die laut MarichelleMarichelle, Hector typisch für die Sprechstimme sind, und damit ein Unterscheidungsmerkmal von Sprache und Gesang (Musik) bilden.1 Trotz dieses nunmehr klar herausgearbeiteten Unterschieds von Sprache und Gesang bleibt MarichelleMarichelle, Hector dem Notensystem treu: Es bildet weiterhin einen festen Bezugspunkt, und selbst der Notenschlüssel ist bei ihm vorhanden.2
Der das graphische System in Ganz- und Halbtöne einteilende Notenschlüssel verschwindet in dem bekannten, von Pierre DelattreDelattre, Pierre (1966) gewählten System, das trotz der Reduzierung von fünf auf vier Linien deutlich an die musikalische Partitur erinnert. Bei DelattreDelattre, Pierre dienen die in dieses System gezeichneten Kurven der Schematisierung der zehn hauptsächlichen, im Französischen gebräuchlichen Intonationsmuster (siehe Tabelle 2).
Niveau 2 - 4+ Entscheidungsfrage Question Niveau 2 - 4 Integrierende Weiterweisung Continuation majeure Niveau 2 - 4_ Implikatur Implication Niveau 2 - 3 Nicht-integrierende Weiterweisung Continuation mineure Niveau 4 - 4 Hohe Nichtverweisung Écho Niveau 1 - 1 Tiefe Nichtverweisung Parenthèse Niveau 2 - 1 Aussage Finalité Niveau 4 - 1 Ergänzungsfrage Interrogation Niveau 4 - 1 Befehl Commandement Niveau 4 - 1 Ausruf ExclamationTabelle 2:
Die 10 Basis-Intonationen des Französischen nach Pierre DelattreDelattre, Pierre (1966). Deutsche Übersetzung nach Wunderli (1981)
Ergänzungsfrage, Befehl und Ausruf durchschreiten dieselben Niveaustufen (4–1), haben aber verschieden ausgeprägte Melodieverläufe (vgl. Bsp. 9a). Die vier Linien entsprechen bei DelattreDelattre, Pierre nicht mehr bestimmten Einzeltonhöhen, sondern Sprechniveaus. Sie bieten weiterhin einen Bezugspunkt und helfen beispielsweise, ähnliche Melodieformen, wie etwa die Aussage (abfallend von Niveau 2 auf Niveau 1) vom Ausruf (abfallend von Niveau 4 auf Niveau 1) zu unterscheiden (vgl. Bsp. 9b). Es handelt sich damit um eine „kombinierte Kontur-Niveau-Darstellung“ (Wunderli, 1981). Der visualisierte prosodische Parameter ist vor allem intonatorischer Natur.
Die melodische Bewegung der von DelattreDelattre, Pierre stilisierten Intonationsfloskeln ist auf den ersten Blick verständlich und interpretierbar. So entsprechen zum Beispiel in der Folge „Jean-Marie/va manger? malgré tout?“ sowohl die erste als auch die zweite Einheit („Jean-Marie/va manger?“) Aufwärtsbewegungen, während die dritte Einheit („malgré tout?“) auf einem hohen Niveau beharrt. Damit ist der melodische Verlauf annäherungsweise vorstellbar. Das genaue Studium zeigt anhand der Formen und angegebenen Sprechniveaus, dass es sich zunächst um eine continuation mineure oder nicht-integrierende Weiterweisung (2–3) handelt, die im Text durch den Slash ( / ) verdeutlicht ist. Das zweite und dritte Element sind durch eine continuation majeure oder integrierende Weiterweisung (2–4) verbunden und die Folge schließt mit einer hohen Nichtverweisung (écho, 4–4).3
Wenn die Diagramme und Schaubilder, wie sie die gängigen Programme wie Praat, Prosogramme, Winpitch oder ToBI zur Analyse von Grundfrequenz und Intonation generieren, auch deutlich an Abstraktion gewonnen haben, so bleibt doch die Assoziation einer Tonfolge, wie sie in einer musikalischen Partitur dargestellt wird, lebendig.4 Sie kommt übrigens automatisch zum Einsatz, wenn die generierten Skripte, wie von Jörg Mayer (2017) gefordert, mit dem Höreindruck verglichen werden („Stimmt der Höreindruck (steigender/fallender/gleichbleibender Stimmton) mit der ermittelten F0-Kontur überein?“ Mayer, 2017: 93).
2 Sprache und Musik: Ästhetische Wandel im Laufe der Jahrhunderte
Wenn wir heute die Musik verschiedener Jahrhunderte hören oder praktizieren, so entdecken wir, dass jede Epoche und jeder Stil eine eigene Ausdrucksweise haben, von denen jede unser neuronales Netz auf eine andere Art angeregt. Die Musik ist von den Komponisten nicht als eine kognitive Stimulation konzipiert worden, aber sie wird ganz natürlich zu einer solchen, da sie Gefühle mobilisiert, so Emmanuel BigandBigand, Emmanuel und Barbara TillmannTillmann, Barbara (2020).1
Wir kennen Musikgattungen, in denen Rhythmus und Akzentuation wichtige Bezugspunkte bilden, zum Beispiel durch die Hierarchie der Taktzeiten in Barock und Klassik, aber auch im modernen Rap. Andere Gattungen wie das romantische Lied sind weitaus mehr von Melodie und Phrasierung bestimmt oder spielen vorrangig mit stimmlichen Klangfarben oder der Nähe und den möglichen gleitenden Übergängen zwischen Sprech- und Gesangsstimme. Dies ist beispielsweise der Fall in den französischen Chansons des 20. und 21. Jahrhunderts oder im Sprechgesang. Doch selbst wenn in einer Kompositionsform bestimmte prosodische Parameter im Vordergrund stehen, bleiben die Übrigen immer präsent: Sie treten lediglich in den Hintergrund. Man kann somit von verschiedenen Modellen sprechen, nach denen die musikalischen Sprachparameter in Musik umgewandelt werden. Die Zusammenhänge dieser praktischen und bis heute zugänglichen prosodischen Spuren in musikalischen Werken zeigen sich auch in der Denkweise der Sprachforscher.
Die folgende chronologische und auf den musikalischen Epochen in Frankreich beruhende Darstellung der Entwicklung ästhetischen Denkens und Handelns in Bezug auf die Verbindungen von Sprache und Musik soll helfen, die Ausführungen der nächsten Kapitel besser zu verstehen. Dabei werden nur die musikalischen Gattungen berücksichtigt, in denen die Wort-Ton-Beziehung im Französischen eine deutliche Rolle spielt.
2.1 Der Begriff „Ästhetik“
Ästhetik wird hier in einem weiten, auf Alexander Gottlieb BaumgartenBaumgarten, Alexander Gottlieb (1714-1762) und seine Schrift Aesthetica (1750-1758) zurückgehenden Sinn verstanden:1 Die von BaumgartenBaumgarten, Alexander Gottlieb begründete Wissenschaft betrifft die sinnliche Erkenntnis, die Lehre vom Schönen und die Lehre von der Kunst. Schönheit kann gefühlt, erkannt, gedacht, verstanden und erklärt werden. Angeborene Fähigkeiten können durch Schulung der Sinne und des Gedächtnisses gefördert und stimuliert werden, so dass sich bestimmte Erwartungshaltungen (und somit die Grundlage eines bestimmten stilistischen Geschmacks) entwickeln können. Damit greift BaumgartenBaumgarten, Alexander Gottlieb zwei antike Traditionen auf.
Die Platoniker behandeln das „Schöne“ im Kontext der Metaphysik. Die Liebe zum Lebendig- und zum Sittlich-Schönen wird zum Antrieb der Suche einer Idee des Schönen und damit der Liebe zur Weisheit. Dabei spielen sowohl die Komposition des Kunstwerkes als auch seine Präsentation eine Rolle: Kunst dient einer sinnlichen Darstellung der Wahrheit. Klare Linien und Formen werden nicht nur als „immer an und für sich ihrer Natur nach schön“ betrachtet, sondern sie „führen gewisse ganz eigentümliche Lustgefühle mit sich“ (Platon,Platon [1869]: 51). Mathematik ist ein bedeutendes Kriterium zur Bestimmung des Schönen; Symmetrie, Rhythmus, Geometrie und Proportion werden zu bestimmbaren und erlernbaren Parametern: „Maß und Ebenmaß“ ist laut PlatonPlaton ([1869]: 64) „doch wohl überall das, woraus Schönheit und alles Edle entsteht“.
Die Aristoteliker entwickeln den Kunstbegriff in den Disziplinen Poetik und Rhetorik, den Wissenschaften, der Komposition (oder Produktion) und des Schaffens (epistéme poietiké). Kunst hat bei AristotelesAristoteles eine besondere Verbindung mit der Natur: Sie ist die konkrete Vorlage des Schönen. Zur Nachahmung bedienen sich die verschiedenen Künste, Dichtung und Musik, „bestimmter Mittel […] und zwar verwenden sie diese Mittel teils einzeln, teils zugleich“ (AristotelesAristoteles, [2012]: 1447a). Weiterhin führt AristotelesAristoteles ([2012]: 1447b) aus: „Es gibt nun Künste, die alle die oben genannten Mittel verwenden, ich meine den Rhythmus, die Melodie und den Vers“. Prosa, Poesie, Musik und Tanz sind die von dieser Aussage betroffenen Künste, wobei die Dichtung aufgrund ihrer Nähe zum Wort und zur Idee den höchsten Rang einnimmt.2 Rhetorik hat das Schöne zwar nicht zum eigentlichen Zweck (dieser liegt vielmehr in der Qualität eines argumentierten Vortrags auf der Grundlage seiner Überzeugungskraft), ihre Techniken können aber nach denselben Mustern bewertet werden wie die Kunstsprache.
Kirchenväter wie Augustinus fragen sich einige Jahrhunderte später nach dem Recht der Sinnesfreuden an schönen Dingen. Das Schöne der Klänge, der Farben oder der Formen darf keinen eigenen Wert beanspruchen, sondern alle Schönheit muss als auf Gott hinweisend gewertet werden (Konfessionen, X, 33 und 34). Sie kann mit den Qualitäten Gleichheit, Entsprechung, Symmetrie und Harmonie beschrieben werden (Augustinus, De musica, 387-391). Musica est scientia bene modulandi, dieser auf Augustinus zurückgeführte Slogan durchzieht das gesamte Mittelalter: Musik ist eine vom Verstand geführte Operation (vgl. Favier, 2017: 46).
Boethius,3 der als einer der Ersten in seinem musikalischen Lehrwerk De istitutione musica (ca. 500) die Aufteilung der sieben freien Künste in Trivium und Quadrivium definierte, übernimmt die Idee, Schönheit mit mathematischer Ordnung gleichzusetzen. Der gelehrte Musiker (musicus) steht in Opposition zum Dilettanten, der keine theoretischen Kenntnisse besitzt, sondern ausschließlich zu seinem Vergnügen auf seinem Musikinstrument spielt.
Die Musik, die mit Arithmetik, Geometrie und Astronomie das Quadrivium der mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen bildet, wird als „höhere Rechenkunst“ angesehen (Keil, 2014: 59), da sie sich mit Proportionen beschäftigt: „Musik war gewissermaßen klingende Bruchrechnung und insofern auf ähnliche Weise höhere Arithmetik, wie die Astronomie als höhere Geometrie angesehen wurde“ (Keil, 2014: 60).
Augustinus und Boethius sind die wichtigsten Theoretiker für die Übermittlung antiken Musikwissens während des gesamten Mittelalters bis ins 16. Jahrhundert: Beide wurden immer wieder gelesen, kopiert und kommentiert.
2.2 Die Renaissance: Rückkehr zur Antike
Die „vers mesurés à l’antique“
In die gegen 1420 beginnende, musikalische Epoche der Renaissance fallen nicht nur die Veröffentlichung der ersten Grammatiken für die französische Sprache, sondern auch die Dichtungen der Autoren der Pléiade und die von Jean-Antoine BaïfBaïf, Jean-Antoine de (1532–1589) ins Leben gerufene Académie de poésie et de musique. BaïfBaïf, Jean-Antoine de initiierte, vor allem in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Claude Le JeuneLe Jeune, Claude (1525/1530–1600), einen fruchtbaren Austausch von Poeten und Musikern. Die Beziehung von Poesie und Musik erhält eine neue Bedeutung durch die Antikenbegeisterung, die diese Epoche so maßgeblich charakterisiert, dass sogar ihr Name, Renaissance, auf diese Leidenschaft zurückzuführen ist.
Der Norden Frankreichs und das heutige Belgien entwickeln sich in der Renaissance zum wichtigsten europäischen Musikzentrum. Die musikalischen Hauptgattungen, Messe1, Motette2 und Chanson3, sind vokal. Das neuerwachte Bewusstsein der französischen Dichter für ihre eigene Sprache, das sich beispielsweise in der Abfassung der ersten Grammatiken zeigt, führt zu einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema der Verbindung von Poesie und Musik. Dabei sind besonders die vers mesurés à l’antique (siehe unten) von Bedeutung. Der Terminus mesuré verweist auf Ordnung und Regelmäßigkeit. Das Maß für den französischen Vers wird die Anzahl der Silben pro Zeile, im Gegensatz zur griechischen Metrik, in der die Quantität, das heißt die Länge der Silben, die Struktur des Versmaßes bestimmt. Darüber hinaus bildet der Reim ein klangtragendes und farbiges Element und gibt dem französischen Vers, so Joachim Du BellayDu Bellay, Joachim (1549), auf natürliche Weise einen musikalischen Charakter.4
Der Reim bildet in der Struktur der Poesie einen Fixpunkt. „Die ‚poetische Zeit‘ des französischen Verses ist bemessen, mesuré, bis zum Auftreten des Reimes“, so Myriam Suzanne RionRion, Myriam Suzanne (2001: 82). Die Autorin zitiert dazu einen Passus aus dem Abrégé (1565) von Pierre de RonsardRonsard, Pierre de, in dem der Autor fordert, „lange und kurze Verse in verschiedenen Variationen (wie er vorschlägt: lang – kurz, lang – kurz – kurz) miteinander zu kombinieren und diesem Phänomen besonderen lyrischen Charakter zuspricht“5 (2001: 83). RionRion, Myriam Suzanne unterstreicht den musikalischen Denkansatz RonsardRonsard, Pierre des folgendermaßen: „Er hebt auf eine Qualität des Rhythmischen, der rhythmischen Variation ab, wie sie schon in seiner Forderung nach dem regelmäßigen Abwechseln männlicher und weiblicher Verschlüsse [i. e. Reime] durchscheint. Das prägt seine Vorstellung von musikalischer Qualität“ (idem).
Musiktheorie und musikalische Praxis
Die Varietas (Vielfalt oder Abwechslung) ist auch ein der Musik der Renaissance zugrundeliegendes ästhetisches Prinzip. Zahlensymbolik und melodische, voneinander unabhängige Einzelstimmen, die zu weitgespannten Sätzen verschmelzen, sind typisch für die mehrstimmigen Vokalkompositionen, wie wir sie von Johannes Ockeghem (1430–1495) oder Josquin Desprez (1440–1521) kennen (vgl. Bsp. 10).
Im Gegensatz zu unserem heutigen Notensystem haben die Noten in der Renaissance keine absoluten Werte: Das sogenannte Mensurzeichen (vgl. Bsp. 11), das an der Stelle des heutigen Taktzeichens1 steht, bestimmt das Verhältnis der Notenwerte untereinander. In der Komposition können die verschiedenen Abschnitte und sogar unterschiedliche Stimmen in einem einzigen Abschnitt mit unterschiedlichen Mensuren notiert sein. Einziges verbindendes Element ist in diesem Fall der Tactus, ein gemeinsamer Grundschlag. Trotz Mehrstimmigkeit ist der Höreindruck linear. Strukturbildendes Element ist neben der Klausel2 vor allem die gemeinsame Atmung der Sänger.
Eine wichtige Gattung bildet im 15. und 16. Jahrhundert die Chanson, ein mehrstimmiges, weltliches, in französischer Sprache gesungenes „Lied“.3 Besonders in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeichnen sich viele Chansons durch eine syllabische Textverteilung und einen durchgehend homorhythmischen Satz aus: Alle Stimmen singen zur gleichen Zeit denselben Text. Dies Verfahren ist nicht nur der Textverständlichkeit, sondern auch der neuen Verbindung von Text und Musik zuträglich. Der Theoretiker Pontus de TyardTyard, Pontus de (1555) unterstreicht ebenso wie Pierre de RonsardRonsard, Pierre de das (neu-) platonische Ideal einer engen und klar geregelten Verbindung von Wort und Musik. Die Präzision der Verse RonsardRonsard, Pierre des, die, wie oben geschildert, metrische Regeln und Varietas miteinander in Einklang bringen, erleichtert die Vertonung des Textes mit einer Musik, die durch die Regelmäßigkeit des Phrasenbaus und durch die Schlichtheit der Satzstruktur die als wichtig erachteten prosodischen Elemente perfekt widerspiegelt.4
Quantität und Akzent
Die gute, richtige und natürliche Ordnung der Dinge ist ein wichtiges Thema für die Autoren der Renaissance. Die Rhetorik von Louis de LesclacheLesclache, Louis de (1648) beispielsweise ist laut Michel Le Guern (Lesclache, 2012 [1648]) von einer wahren Ordnungsbesessenheit durchzogen. Diese zeigt sich im dem folgenden, dem 9. Kapitel des 2. Teils entnommenen Zitat: „Alle Dinge haben ihre Ordnung. Alle Handlungen werden in der richtigen Reihenfolge ausgeführt. Es ist offensichtlich, dass die Ordnung uns das perfekte Wissen aller Dinge gibt.“1
Die Quantität, das heißt die Länge der Silben, ist einer dieser von der Natur gegebenen, die Welt ordnenden und Zugang zur wahren Erkenntnis der Dinge ermöglichenden Faktoren. Sie stellt ein die Disziplinen verbindendes Element dar. Neben Poeten und Musikern beschäftigen sich auch die Grammatiker mit diesem Thema. Wenn der französische Vers auf der Anzahl der Silben beruht, so heißt dies nicht, dass die französische Sprache in den Augen der Theoretiker nicht über unterschiedliche Quantitäten verfüge.2 Oft wird Silbenlänge mit Akzentuierung gleichgesetzt – eine Intuition, die zwar nicht grundsätzlich falsch, aber doch bei Weitem nicht vollständig ist (vgl. Kapitel 6). Der Akzent, den Myriam Suzanne RionRion, Myriam Suzanne in der Poesie RonsardRonsard, Pierre des durch die Häufigkeit der Reime identifiziert hat (siehe oben), entsteht in der Vokalmusik der Renaissance durch die den gleichmäßigen Melodiefluss unterbrechenden langen Noten oder durch die Verwendung bestimmter, das Phrasenende ankündigender Formeln (der Klauseln).
In der Renaissance hat die Verbindung von Sprache und Musik eine theoretisch-philosophische Grundlage. Sie ist von der Antikenrezeption der Autoren bestimmt und manifestiert sich vorwiegend in den Parametern Rhythmus (Quantität) und Klangqualität. Poesie, Musik und Philosophie vereinen sich in dem gemeinsamen Ziel der Erkenntnis, das heißt insbesondere der Kenntnis des Universums und der Erhebung der Seele zu einem Zustand vollkommener Ruhe (His & Vignes, 2010: 255).
2.3 Der französische Barock: Eine musikalische Deklamation
Musik und Deklamation
Die für die Renaissance so typische Linearität der Komposition steht im Zentrum der großen Umwälzungen, die das Barockzeitalter mit sich bringt. Die moderne Takthierarchie mit konsequenter Betonung der ersten Zählzeit jedes Taktes (und entsprechenden Nebenbetonungen) entwickelt sich, und in der Vokalmusik ist eine Tendenz zu monodischen Kompositionen, das heißt zum Sologesang, spürbar. Im Unterschied zu Italien verläuft diese Entwicklung in Frankreich nicht über die Gattung der Oper.1 Dieses neue Kompositionsgenre konnte hier nur schwer Fuß fassen. Der Übergang zu einer neuen Ästhetik vollzieht sich in kleinen Formen wie die der (von der Theorie der musique mesurée à l’antique beeinflussten) Chanson und des Air de Cour. Neben den mehrstimmigen, homorhythmischen Kompositionsformen (vgl. Bsp. 13) entsteht eine neue Gattung, die ebenfalls in Strophenform verfasst, aber für eine Solostimme mit Lautenbegleitung komponiert ist. Diese Form ermöglicht eine sorgfältige Textbehandlung und einen expressiven Gesang, kurz gesagt, eine wahrhafte Deklamation des Textes. Die Beherrschung der Deklamationskunst wird denn auch unabdingbar für jeden barocken Komponisten und Sänger.2
Rhythmisch gesehen entspricht die lange Silbe einer langen Note. Die betonte Silbe des Taktes befindet sich zudem normalerweise auf dem ersten, betonten Taktschlag. Takthierarchie und ein neues, harmonisches Denken geben der Musik nunmehr eine zusätzliche, vertikale Ausrichtung. Darüber hinaus spiegeln melodische Konturen und Phrasierung des Gesangs diejenigen der Rede wider (vgl. Schweitzer, 2018: 332–334). Die Musik ist der Poesie untergeordnet, und gemäß diesem Ideal muss das Klangmaterial der gesprochenen Sprache genau in präzise musikalische Rhythmen, Intervalle, Figuren und Klangfarben umgewandelt werden. Die Musik kann somit als natürliche Nachahmung der gesprochenen Sprache verstanden werden. Durch diesen Kunstgriff erhält die Musik eine semantische Funktion. Sie kann nicht nur Geräusche der Natur (zum Beispiel Vogelgesang) oder natürliche Phänomene (wie das Hinaufsteigen einer Treppe durch eine aufsteigende Tonfolge) imitieren, sondern Musik wird zu einer eigenen Sprache, wenn sie direkt nach den Prinzipien der gesprochenen Sprache moduliert wird.
Mehr noch als im deutschen Sprachraum, in dem die musikalische Rhetorik einen wichtigen Platz einnimmt,3 wird vom französischen Komponisten verlangt, mit den Regeln der musikalischen Kunst dieselben Gedanken und Gefühle wie ein Redner auszudrücken.
Sprachtheoretische Grundlagen
Das dazu nötige Handwerkszeug findet sich in den Grammatiken, die Silbenlänge (Quantität) und Akzent des Französischen erklären,1 sowie in den Texten zur Rhetorik, die Fragen der rhythmischen Gestaltung, Atmung und Stimmgebung behandeln.2 Die Autoren unterscheiden dabei noch nicht zwischen Vokal- und Silbenlänge. Gemäß der Prämisse, dass ein Konsonant allein nicht klingen – und damit keine Zeit beanspruchen – kann, resultiert die Silbenlänge automatisch aus der Vokallänge (vgl. Fournier, 2007). Ein wichtiger Moment ist die Definition des Akzents als einem zu zwei sprachlichen Disziplinen gehörenden Phänomen: Antoine ArnauldArnauld, Antoine und Claude LancelotLancelot, Claude unterscheiden in der Grammaire générale et raisonnée (1660: 17) einen dem Bereich der Grammatik angehörenden Akzent (ein fester Wortakzent, „naturel, & de grammaire“) von dem rhetorischen Akzent (ein flexibler, dem Ausdruck dienender Akzent, „de Rhetorique“, vgl. Kapitel 6). Das unterschiedliche Zusammenspiel dieser beiden Akzente charakterisiert die verschiedenen Sprachen.