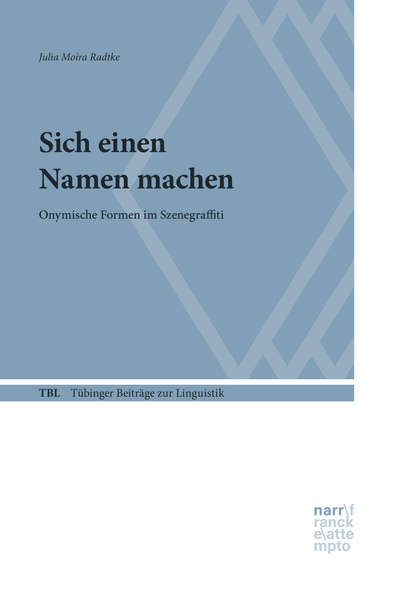- -
- 100%
- +
Zwei Jahre später formulieren Antoine ArnauldArnauld, Antoine und Pierre Nicole in der Logique ou L’art de penser von 1662 die Rolle der Stimme, der Gestik und der Mimik für das Verständnis und den Ausdruck eines Satzes.3 Damit nähern sich die beiden Disziplinen, Grammatik und Rhetorik, einander an.
Das Rezitativ: Symbiose von textueller und musikalischer Deklamation
Das Rezitativ bildet die neue Gattung, in der die perfekte Übereinstimmung von Deklamation und Sprache am deutlichsten zu Tage tritt (vgl. Kintzler, 2006: 299). Es nimmt einen bevorzugten Platz in der Tragédie lyrique ein. Im Vergleich zur italienischen Oper ist die Tragédie lyrique deutlich mehr dem Theater und seiner lyrischen Deklamation verhaftet. Sie schöpft ihre Ausdruckskraft aus dieser literarischen Komponente.
Das Erfolgsduo für diesen Kompositionstyp ist allgemein bekannt: Seit ihrem ersten gemeinsamen Werk Cadmus & Hermione (1673) sind Jean-Baptiste LullyLully, Jean-Baptiste (1632–1687) und Philippe Quinault (1635–1688) für die perfekte Harmonie von Text und Musik berühmt (Bsp. 14). Nach den Aussagen von Jean-Laurent Le Cerf de la ViévilleLe Cerf de La Viéville, Jean-Louis ging LullyLully, Jean-Baptiste wie folgt vor, wenn Quinault ihm eine neue Szene vorlegte:
LullyLully, Jean-Baptiste las sie, bis er sie fast auswendig kannte. Er setzte sich ans Cembalo und sang und sang den Text, wobei er sich am Cembalo begleitete. Wenn er fertig war, hatte er sich die gesamte Komposition bis zur kleinsten Note hin fest eingeprägt. Lalouette1 oder Colasse2 kamen und er diktierte ihnen die Musik. Am nächsten Tag erinnerte er sich kaum noch an das, was er komponiert hatte. All seine Vokalkompositionen entstanden auf diese Art. (Le Cerf de la ViévilleLe Cerf de La Viéville, Jean-Louis, 1705)3
Die Schauspielerin, die die Grundlage für die praktischen Beobachtungen LullyLully, Jean-Baptistes lieferte, ist die bereits erwähnte Marie Desmares (1642–1698), bekannt unter dem Namen La Champmeslé (Bsp. 15). Le Cerf de la ViévilleLe Cerf de La Viéville, Jean-Louis (1705) berichtet, dass LullyLully, Jean-Baptiste ihre Intonation und Akzentuierung genauestens verinnerlichte und ihre déclamation chantante, ihre singende Deklamation, wie beschrieben in Melodien verwandelte. Musikalische Praxis und theatralische Deklamation nähern sich einander an mit dem gemeinsamen Ziel einer actio oder prononcio,4 die die Zuhörenden bewegt, indem sie Verstand und Herz gleichermaßen anspricht. Die Rhetorik als Kunst der öffentlichen Rede wird bedeutsam als Lehre eines affektvollen Vortrags, der immer die Regeln des Schönen und der guten Eloquenz (éloquence) berücksichtigt (vgl. Schweitzer, 2020b).
2.4 Das klassische Zeitalter und die Lumières
Gemeinsamer Ursprung von Gesang und Sprache
Der „klassische Stil“ fällt in Frankreich mit dem Zeitalter der Aufklärung, den Lumières zusammen. Die Zusammenhänge von Musik und Sprache erhalten im Rahmen der Sprachphilosophie eine neue Dimension.
Jean-Jacques RousseauRousseau, Jean-Jacques ist heute der bekannteste Vertreter der Theorie, nach der Gesang und Sprache einen gemeinsamen Ursprung in natürliche Empfindungen und spontane Gefühle ausdrückenden Lauten haben. Gesang stellt für RousseauRousseau, Jean-Jacques den Anfang aller menschlichen Äußerung dar: Die Ursprache war gesanglich durch ihre Melodiösität und ihre Akzentuierung.1 Wie RousseauRousseau, Jean-Jacques ausführlich in seinem Essai sur l’origine des langues (1755) darlegt, haben für ihn Akzente eine klangliche wie auch eine semantische Funktion.
Noch weiter abstrahiert kann Sprache als das perfekte Mittel zur Vermittlung von Gedanken und Theorien, die Melodie dagegen für das (Mit)Teilen von Gefühlen betrachtet werden.2 Sprache (wie auch eine sprachliche Äußerung in einer bestimmten Sprache) ist damit für RousseauRousseau, Jean-Jacques umso ausdrucksvoller, je höher der Anteil ihrer musikalischen Elemente ist (vgl. Kapitel 5). Eine harmonische, und damit vertikal ausgerichtete Musik spricht den Verstand an, während in der Melodie des einstimmigen Gesangs vorwiegend Emotionen zum Ausdruck kommen.3 Wie RousseauRousseau, Jean-Jacques, so bedauert auch Eugène-Eléonore BéthisyBéthisy, Eugène Eléonor de de Mézières die Verarmung der modernen Sprachen:
Ich frage mich, ob die Menschen nicht zuerst einfach nur Laute gebildet haben, bevor ihr Gehirn begonnen hat, Worte zu formen, und welche unglücklichen Umstände dazu geführt haben, dass ihnen diese weitaus spätere Erfindung nun natürlicher vorkommt als der Ruf der Natur. (BéthisyBéthisy, Eugène Eléonor de, 1760)4
Im Vergleich mit den natürlichen, zu Beginn der Zeiten gesprochenen und gesungenen Äußerungen der Urväter werden die heutige Sprache und Musik von RousseauRousseau, Jean-Jacques und von BéthisyBéthisy, Eugène Eléonor de als eine Verarmung angesehen: Sie haben Teile ihrer ursprünglichen Ausdruckskraft verloren. Um diese wiederzugewinnen, erscheint Autoren wie RousseauRousseau, Jean-Jacques eine Rückkehr zur ursprünglichen Schlichtheit der Sprachen und des Gesangs unabdingbar.
Kunst ist Nachahmung der Natur
Ein melodiöser und angenehmer Gesang ist für RousseauRousseau, Jean-Jacques (1768) nichts anderes als eine Nachahmung der Akzentuation einer ausdrucksvollen oder von Gefühlen bewegten Stimme: „Man schreit und man klagt ohne zu singen, aber man singt niemals, ohne Schreie oder Klagen zu imitieren.“1
Die Forderung, die Natur nachzuahmen, bleibt vorherrschend in der Musik wie in den anderen Künsten, ein Paradigmenwechsel ist jedoch spürbar. Charles BatteuxBatteux, Charles stellt in Les Beaux-Arts (1746) eine Theorie der Poesie vor, in der die Nachahmung der Natur das verbindende Element aller Künste darstellt. Die Nachahmung betrifft aber nicht einen realen Moment, sondern das Wesen der Dinge, das den Sinnen normalerweise auf direktem Wege unzugänglich bleibt.2
Das Ideal BatteuxBatteux, Charles ist klassisch, da die Suche nach dem Wesen der Dinge das Übersteigen des Gewöhnlichen und das Streben nach Vollkommenheit mit sich führt. Musik ist nicht mehr an die Sprache einer linguistischen Gemeinschaft gebunden, wie dies im Barock der Fall war und wie es das Beispiel der Kompositionsweise LullyLully, Jean-Baptistes zeigt, sondern wird immer mehr zu einer universellen Sprache der Gefühle. In diesem Sinne erwähnt Christoph Willibald Gluck (1714–1787) im Jahre 1773 ausdrücklich eine den Menschen aller Nationen verständliche Musik.3
Sprache und Universalität
Auch in den Grammatiken ist das Thema der universellen Verständlichkeit ein Thema. Diese kann durch Einsatz der prosodischen Mittel erreicht werden: Es geht hier nicht um lexikalische Fragen, sondern um das Verständnis des von der Prosodie zum Inhalt und Ausdruck der Worte und Satzkonstruktionen beigetragenen Sinns.1 In den verschiedenen Texten kristallisiert sich das Thema um die Frage des Akzents als besonders wichtig heraus. Die Autoren trennen nunmehr deutlich zwei Akzenttypen: Der erste, accent prosodique oder auch accent tonique genannt, ist melodisch, das heißt mittels Tonhöhenveränderung realisiert. Er interveniert auf Silbenniveau und entspricht dem accent de grammaire von ArnauldArnauld, Antoine & LancelotLancelot, Claude (siehe oben). Der zweite, accent oratoire genannt, beeinflusst die Intonation, den Rhythmus und die Intensität ganzer Satzteile und wird von den Gefühlen der sprechenden Person bestimmt.2 Die Prosodie gilt als art de regler [le] chant de la voix, die Kunst, den Gesang in der Stimme zu modulieren (D’AlembertD’Alembert, Jean Le Rond & Diderot, 1751).
Das Ideal, die Natur oder vielmehr ihr Wesen zu imitieren, beeinflusst ebenfalls die Denkweise der Grammatiker und Rhetoriker. Dies zeigt sich in dem von ihren Arbeiten anvisierten Sprachniveau. Im Gegensatz zum 17. und zum frühen 18. Jahrhundert beginnt man nun, sich für die spontane Ausdrucksweise des Volkes, das heißt, seine natürliche Redegabe zu interessieren (auch wenn die technischen Mittel noch keine in heutigem Sinne befriedigende Forschung erlauben). „Weniger zivilisierten Völkern“ wird eine natürliche Beredsamkeit zugestanden, die auch ohne Beachtung der zahlreichen Regeln der Rhetorik ausdrucksstark ist (vgl. Siouffi & Steuckardt, 2021).
Pierre-Paul DorfeuilleDorfeuille, Pierre-Paul Gobet, dit (1799/1800: 9) rät dem zukünftigen Akteur „d’observer la scène du monde“. Diese Weltbühne stellt für den Lernbegierigen die beste Schule der Passionen und des menschlichen Herzens dar. Ihr Studium kann ihm helfen, zu lernen, wie er dem Publikum gefallen und, vor allem, dessen Herz zum Klingen bringen kann.
2.5 Die Romantik: Traumwelten und wissenschaftliche Genauigkeit
Trennung von Kunst und Wissenschaft
Mit Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelt sich eine neue Kunstästhetik. Die Schreckensherrschaft Robespierres und die Napoleonischen Kriege veranlassen die Romantiker, die die gewaltigen politischen und gesellschaftlichen Umwälzungen der Aufklärung anlasten, zu einer heftigen Kritik an der vernunftbetonten Welt ihrer Vorfahren. Naturbegeisterung und Faszination für das Irrationale und Fremde, aber auch Vergangene, kennzeichnen die Künstler. Die das Herz ansprechenden Künste und die die Vernunft proklamierenden Wissenschaften gehen fortan getrennte Wege.
Eine der Folgen dieser Trennung ist zunächst eine ästhetische Aufwertung der Künste, die für viele Romantiker beinahe ein Religionsersatz, ein Zufluchtsort vor der ernüchternden Gegenwart, wird. Der Künstler wird zum ausführenden Organ seines Genies: Ihm obliegt es, das Schöne im Kunstwerk spürbar zu machen. Die Musik wird im Rahmen der Schönen Künste in einem Atemzug mit Poesie, bildender Kunst und Architektur behandelt:
Schön im Kunstwerk ist nur, was der Künstler darin hineinlegt. Es ist das eigentliche Ergebnis seiner Anstrengung und die Bestätigung seines Erfolgs. Wann immer ein von einem beliebigen – körperlichen, seelischen oder geistigen – Eindruck zutiefst getroffener Künstler diesen Eindruck mithilfe eines beliebigen Verfahrens – Gedicht, Musik, Statue, Gemälde, Gebäude – so zum Ausdruck bringt, dass er in die Seele des Betrachters oder des Hörers dringt, ist das Kunstwerk schön, und zwar nach Maßgabe der Intelligenz, die es voraussetzt, der Tiefe des Eindrucks, den es ausdrückt, und der Ausdruckskraft, die ihm vermittelt wird. Das Zusammentreffen dieser Bedingungen bildet den vollständigen Ausdruck des Schönen. (VéronVéron, Eugène, 1878 [2010])
Die Begabung oder das „Genie“ für die musikalische Komposition definiert der Komponist Anton ReichaReicha, Antoine (1814:1) mit vier Eigenschaften:
1 Eine große Kunstleidenschaft (das heißt, die Leidenschaft für die Musik),
2 Das Bedürfnis zu schaffen, und das Geschaffene zu präsentieren,
3 Die Begabung, Ideen zu konzipieren und auszuführen, und
4 Eine ausgeprägte Sensibilität und Urteilskraft für die (musikalische) Kunst.
Diese Eigenschaften sind naturgegeben und können nicht durch das Studium von Lehrwerken der Poetik, Rhetorik oder Komposition ersetzt werden, die allerdings unentbehrlich sind, um das vorhandene Talent zu entwickeln.
Die Ausdruckskraft der Melodie
Poetik, Rhetorik und Musik werden hier in einem Atemzug genannt und Anton ReichaReicha, Antoine (1814) empfiehlt das Studium seines Werkes ausdrücklich allen lyrischen Poeten, um zu begreifen, dass der Rhythmus das die Poesie und die Musik verbindende Element bildet. Der poetische Rhythmus des Textes ist nunmehr der Melodie übergeordnet.1 Damit rückt auch die ausdrucksstarke und empfindsame Melodiebildung ins Zentrum der Überlegungen und ReichaReicha, Antoine zeigt sich verwundert, dass diese bislang so wenig studiert worden sei.2
Charles Darwin führt die Überlegungen RousseauRousseau, Jean-Jacquess zu einer ursprünglichen Verbindung von Sprache und Gesang weiter aus und erklärt nicht nur, dass „musikalische Laute eine der Grundlagen für die Entwicklung der Sprache abgeben“ (Darwin, 1875: 317), sondern unterstreicht auch die Nähe der melodischen Ausdruckskraft von Sprech-und Gesangsstimme:
Der leidenschaftliche Redner, Barde3 oder Musiker hat, wenn er mit seinen abwechselnden Tönen und Cadenzen4 die stärksten Gemüthserregungen in seinen Hörern erregt, wohl kaum eine Ahnung davon, dass er dieselben Mittel benutzt, durch welche in einer äußerst entfernt zurückliegenden Periode seine halbmenschlichen Vorfahren ineinander die glühenden Leidenschaften während ihrer gegenseitigen Bewerbung und Rivalität erregten. (Darwin, 1875: 318)
Die Rolle der den Gesang imitierenden Sprechstimme wird hier deutlich hervorgehoben: Die Musik der Sprache übermittelt einen Sinn.
Melodie und Phrasierung
In diesem Zusammenhang gewinnt die Einteilung und Gestaltung der Phrasen in der Musik einen wichtigen Platz. Poeten und Grammatiker beobachten für verschiedene Satzzeichen bestimmte melodische Schlussfloskeln und Pausenlängen, und bei den Musikern bildet die Phrasierungskunst ein nunmehr wichtiges Studienobjekt. Schauspieler, Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen müssen lernen, ihre Atmung genau der Struktur der Komposition anzupassen und immer genügend Luft zur Verfügung zu haben, um die jeweilige Phrase bis zum Ende gut gestalten zu können (vgl. Bsp. 17).
Louis DubrocaDubroca, Louis (1802: 321) unterscheidet generell die repos de la respiration (die Atempausen) von den repos des objets (den inhaltsbestimmten Pausen). Vor allem die zweite Kategorie kann studiert und systematisiert werden. Das Komma erlaubt nur eine fast unmerkliche Atempause und markiert einen kleinen Abschnitt im Verlauf des Satzes. Vor dem Semikolon markiert die Stimme einen leichten melodischen Abfall und die anschließende Pause muss sehr kurz sein. Melodieabfall und Pause sind ausgeprägter für den Doppelpunkt und extrem deutlich nach dem Punkt (1802: 322–325).
Die musikalische Konnotation ist noch deutlicher bei Louis Becq de Fouquères:
Die vollkommene Kadenz entspricht einer Rückkehr der Stimme zum Grundton der Tonleiter und man findet sie im Allgemeinen am Ende eines Satzes. Für Ohr und Verstand bildet sie eine endgültige Ruhepause. Die Rückkehr der Stimme zu einem mit dem Grundton harmonischen Ton der Tonleiter wird als unvollkommene Kadenz bezeichnet. Sie steht am Ende von Satzteilen und bedeutet für Ohr und Geist eine relative Ruhepause. (Becq de Fouquères, 1881)1
Das musikalische Vokabular ist mehr als eindeutig (und erschwert heutigen, musiktheoretisch vielleicht weniger gebildeten Lesern und Leserinnen beinahe die Lektüre):
Der Grundton der Tonleiter ist der für die Tonart namengebende Ton („C“ in „C-Dur“, usw.).
Die vollkommene Kadenz besteht in der Harmonielehre aus der Akkordfolge Dominante und Tonika. Die Tonika, das heißt die Grundtonart des Stückes, erscheint dabei mit dem Grundton in der Melodiestimme.
Die unvollkommene Kadenz besteht ebenfalls aus der Akkordfolge Dominante und Tonika, allerdings endet die Melodie nicht auf dem Grundton, sondern auf einem der anderen Töne des Tonikaakkords.
Die zum Grundton harmonischen Töne entsprechen den Tönen des Grundakkords (der Tonika) des Stückes.
Wenn man die musikalische Terminologie in eine leichter verständliche Sprache übersetzen möchte, so könnte die obige Passage wie folgt lauten (vgl. auch Bsp. 18):
Die für das Satzende typische Tonlage erlaubt der Stimme eine vollkommene Entspannung. Der Hörer (oder die Hörerin) versteht dadurch, dass der Satz hier zu Ende ist. Die für das Ende eines Satzabschnitts typische Tonlage erlaubt der Stimme zwar keine vollkommene, aber doch eine relative Entspannung. Der Hörer (oder die Hörerin) versteht dadurch, dass der Satz hier noch nicht zu Ende ist.
Wissenschaft und die „Lehre vom Schönen“
Auf Seiten der Wissenschaft nimmt die Erforschung der Töne ebenfalls eine wichtige Rolle ein. In seiner Lehre von den Tonempfindungen (1863) sucht Hermann von Helmholtz (1821–1894) eine wissenschaftliche Begründung für das Wesen des „Schönen“ in einer dem Hörer und der Hörerin unbewussten realen Vernunftmäßigkeit (das heißt konkret, die Rolle der Frequenzen und verschiedenen Obertöne).
Aber besonders die ersten Phonetiker haben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entscheidenden Einfluss auf eine neue Art, die Musik der Sprache, das heißt die Prosodie, zu untersuchen. Im Gegensatz zu Musikern, Poeten und Rhetorikern verlassen die Phonetiker die Pfade der alten Forschungsmethoden, die vor allem auf Schlussfolgerungen auf der Basis von Höreindrücken bestanden. Genaue Messungen und Berechnungen kennzeichnen die neuen, von den Phonetikern entwickelten Methoden, zu denen in Frankreich Forscher wie Jean-Pierre RousselotRousselot, Jean-Pierre, Hector MarichelleMarichelle, Hector und Léonce RoudetRoudet, Léonce wichtige Beiträge leisteten.1 Der von RousselotRousselot, Jean-Pierre entwickelte Versuchsaufbau erlaubt eine extrem exakte Transkription der melodischen und zeitlichen Entwicklung (Frequenz und Rhythmus) sowie der Geschwindigkeit der Kehlkopfschwingungen.2 RoudetRoudet, Léonce (1899) äußert sich außerordentlich begeistert dazu: „Genau das, und nichts Anderes, ist die Rolle der experimentalen Wissenschaft: Sie deckt Details auf, die unsere Sinne sonst nur gebündelt und anhand der aus ihnen resultierenden Ergebnisse wahrnehmen können!“3
2.6 Die Moderne: Wissenschaft und Emotionserforschung
Der Parameterbegriff
Diese technischen Möglichkeiten erfahren im 20. Jahrhundert bedeutende Weiter- und Neuentwicklung, die den Forschern das vergleichende Studium größerer Datenmengen und oraler Korpora erlaubten. Maurice GrammontGrammont, Maurice, Hélène-Nathalie Coustenoble, Lilias Eveline Armstrong (alle zu Beginn des Jahrhunderts) und Pierre DelattreDelattre, Pierre (Mitte des Jahrhunderts) haben verschiedene Sprachen, zum Beispiel das Französische, das Englische und das Spanische, miteinander verglichen. Dabei konnten sie zeigen, dass ein perzeptiver Unterschied in der Abgrenzung der Worte im Sprachfluss liegt, wobei im Englischen und Spanischen die Aufmerksamkeit auf das Wort, und im Französischen auf die Sinneinheit (groupe de sens) gelenkt wird (vgl. Vaissière, 2006). Die von den Phonetikern des 19. Jahrhunderts definierten drei Parameter Intonation, Rhythmus und Akzentuation werden gesondert und in Kombination studiert.
Der Parameterbegriff rückt auch bei den Komponisten serieller Musik in den Mittelpunkt. Die betrachteten Elemente sind nicht nur Tonhöhe und Tonlänge, sondern auch akustische Eigenschaften wie Intensität, Klangfarbe oder Stimmregister. Neben Pierre Boulez (1925–2016) ist besonders Olivier MessiaenMessiaen, Olivier eine wichtige (französische) Persönlichkeit auf diesem Gebiet. Verschiedene Reihen mit einer bestimmten Anzahl unterschiedlicher Tonhöhen, Anschlagsarten, Lautstärken, Rhythmen (usw.) werden nach vorab genau festgelegten Kompositionsverfahren (Variationen und Übereinanderschichtungen) miteinander kombiniert. Das Vorgehen ist nicht nur mathematisch (wie man leicht glauben könnte), sondern hat auch eine spielerische Komponente. Die Forderung einer „sprachlichen Melodie“ ist bei MessiaenMessiaen, Olivier (1944) klar ausgedrückt und die Musik ist ausdrücklich als eine Sprache definiert.1
MessiaenMessiaen, Olivier formuliert ebenfalls eine Ästhetik des Schönen und Edlen und das Streben nach religiösen Gefühlen.2 Diese durchaus traditionellen Werte werden aber bei dem Pariser Komponisten und Organisten mit neuen Mitteln angestrebt. MessiaenMessiaen, Olivier selbst beschreibt sie als eine Art Spannung zwischen den unendlichen Möglichkeiten serieller Berechnung und der mathematischer Begrenzung aufgrund des Materials (der Reihen) selbst.3
Phonostylistik und Erforschung der Gesangsstimme
In den 1960ger Jahren sind die technischen Möglichkeiten so weit fortgeschritten, dass großangelegte instrumentale Studien zur Erforschung der Zusammenhänge von perzeptiven Eindrücken und messbaren akustischen Faktoren anvisiert werden können. Damit rückt das Studium der spontanen Sprachäußerung in realen Kommunikationssituationen immer weiter in das Zentrum des Forschungsinteresses. Die Verbindungen zwischen (Norm-) Syntax und Prosodie sind bei dieser Art von Untersuchung weitaus weniger deutlich und andere Funktionen der Prosodie, wie der Ausdruck von Emotionen, Selbstdarstellung und diskursbedingte Stimmmodulationen dominieren. Die Aufteilung des Akzents in de grammaire oder tonique und in d’oratoire oder d’émotion, die sich seit dem 17. Jahrhundert in den französischen Grammatiken gezeigt hatte, spiegelt sich in den Betrachtungen der verschiedenen Parameter wider, die a) zum Verständnis des Codes und der Funktion der Aussage nötig sind, und b) zusätzliche, zum Verständnis ebenfalls wichtige Informationen (wie Stimmfärbung, Intensitätsvariationen, Atmung, usw.) übermitteln.
Die letzteren werden im Rahmen der von Nicolas Troubetzky ins Leben gerufenen und in Frankreich vor allem von Ivan FónagyFónagy, Ivan und Pierre Léon entwickelten Phonostylistik wichtig, die in diesem Sinne das Erbe der Rhetoriker des 16. und 17. Jahrhunderts angetreten haben. Die lange Zeit im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehenden Intonationsmuster (zum Beispiel DelattreDelattre, Pierre, 1966) werden durch Studien zu den Verbindungen von Emotionen in Musik und in Sprache komplettiert (zum Beispiel FónagyFónagy, Ivan, 1983).
Bei den Phonetikern wird die Gesangsstimme Objekt eigener Forschungsarbeiten. Dank der genauen Messmöglichkeiten kann die zeitlich unterschiedliche Organisation der Silbe in Sprache und Gesang verglichen werden (Scotto di Carlo & Autesserre, 1992). Die Unterschiede sind auf die bedeutende Verlängerung der Vokale auf Kosten der Konsonantendeutlichkeit zurückzuführen, die bei den im lyrischen Gesang (Opernschule) ausgebildeten Sängern die Regel ist. Diese Veränderung der Silbenstruktur ist auch einer der Gründe, weshalb Opernsänger und Sängerinnen oft schwer – oder gar nicht – zu verstehen sind (Scotto di Carlo, 1978). Im Unterschied zu den barocken Sängern der Lullyschen Tragédie lyrique, von denen absolute Textverständlichkeit erwartet wurde, stellt die auf die romanische Tradition zurückgehende „klassische“ Gesangstechnik die Formung der Stimme in den Vordergrund. Diese muss in erster Linie in der Lage sein, über ein großes sinfonisches Orchester hin zu tragen. Dabei wird generell die italienische Sprache mit ihrer hohen Anzahl offener Vokale bevorzugt (vgl. Schafroth, 2020).
Eine neue Texttradition: das Chanson des 20. Jahrhunderts
Paolo Zedda (1995) betont ausdrücklich die Eigenheiten des französischen Chansons: „Le chant français est un chant d’articulation!“ Der französische Gesang beruht auf der Artikulation, und das heißt vor allem, auf der deutlichen Aussprache der Konsonanten. Die große Ähnlichkeit der beiden vokalen Ausdrucksarten, Sprache und Gesang, wird dabei in anderen Bereichen als dem des Operngesangs fruchtbar eingesetzt. Besonders im Chanson après guerre ist diese Verbindung dadurch gekennzeichnet, dass die Musik im Dienste der Aussage des Textes steht. Laut Herbert Schneider (2016) zielen die Chansonsänger und Sängerinnen in der Regel auf „eine möglichst enge Zusammenführung des sprachlichen und des musikalischen Elements [ab], sodass sich eine Symbiose ergibt. Die Einheit von Text und Musik ist die beste Garantie für seinen Erfolg.“ Mit wenigen Ausnahmen verwenden die Sänger und Sängerinnen keine literarischen Gedichte, sondern bevorzugen in einem familiären Sprechstil geschriebene Texte (Rey et al., 2007: 418-419).