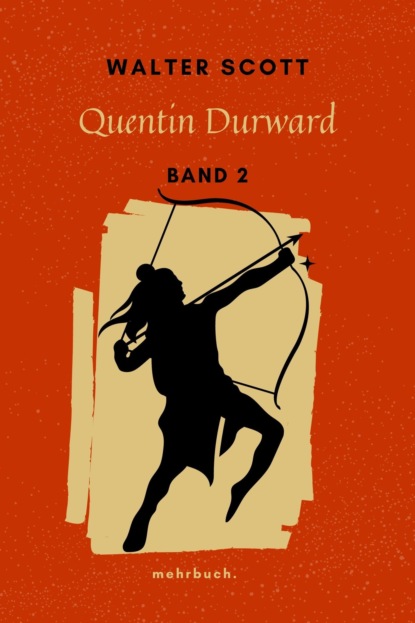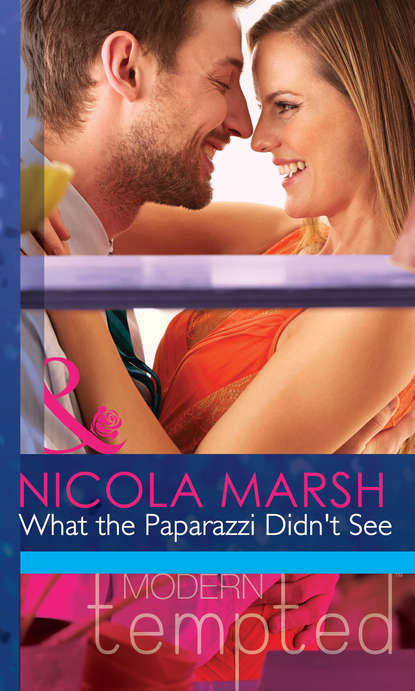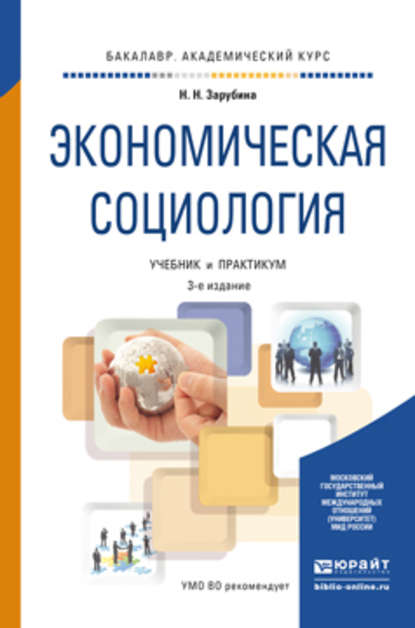- -
- 100%
- +
Dieselbe Wärme des Temperaments, welche Hermann Pavillon zu einem hitzköpfigen und ungemäßigten politischen Eiferer machte, hatte auch die angenehmere Folge, ihn im Privatleben zu einem gutmüthigen, freundlichen Manne werden zu lassen, der, mochte er auch zuweilen ein wenig durch Eitelkeit irre geführt werden, doch stets gutdenkend und wohlwollend war. Er ermahnte Quentin, für die arme artige Jungfrau die größte Sorge zu tragen, und nach dieser unnöthigen Ermahnung begann er aus dem Fenster zu rufen: »Lüttich, Lüttich, hierher, von der wackern Kürschner- und Gerberzunft!«
Einige von seinen Gesellen versammelten sich auf diesen Ruf und auf das besondere Pfeifen, wovon er begleitet ward (jede der Zünfte hatte für sich solch' ein eigenthümliches Zeichen), und bildeten, während noch mehrere hinzukamen, eine Schutzwache unter dem Fenster, aus welchem ihr Führer rief, so wie vor der Hinterthür.
Es schien sich nun eine gewisse Ruhe herzustellen. Aller Widerstand hatte aufgehört, und die Führer der verschiedenen Klassen der Angreifenden trafen Maßregeln, um einer allgemeinen Plünderung vorzubeugen. Die große Glocke ward geläutet, um einen Kriegsrath zusammen zu rufen, und da ihre Eisenzunge die glorreiche Einnahme Schönwalds durch die Insurgenten der Stadt Lüttich mittheilte, so antworteten auf diesen Klang auch alle Glocken der Stadt, deren fernes und verworrenes Getön zu rufen schien: Heil den Siegern! Es würde natürlich gewesen sein, daß Herr Pavillon seine Stelle nun eilig verlassen hätte; aber, sei es aus Sorge für diejenigen, die er unter seinen Schutz genommen hatte, oder vielleicht auch, um seiner eigenen Sicherheit gewisser zu sein, er begnügte sich damit, Boten auf Boten abzusenden, um seinen Lieutenant, Peterkin Geislaer, sogleich zu ihm zu beordern.
Endlich kam, zu seinem großen Troste, Peterkin herbei, welcher diejenige Person war, auf welche, mocht' es Krieg, Politik oder Handel betreffen, Pavillon bei allen wichtigen Angelegenheiten Vertrauen zu setzen gewohnt war. Er war ein stämmiger, derbgebauter Mann, mit breitem Gesicht und dichten schwarzen Augenbrauen, welche anzeigten, daß er rasch zu Rath und That war, – ein wahrhaftes Rathgebergesicht. Er trug ein Büffelwamms, einen breiten Gürtel und ein Schwert zur Seite und eine Hellebarde in der Hand.
»Peterkin, mein lieber Lieutenant,« sagte sein Vorgesetzter, »dies war ein glorreicher Tag – Nacht, sollt' ich sagen – ich hoffe, du bist diesmal zufrieden?«
»Ich bin schon zufrieden, da Ihr es seid,« sagte der wackere Lieutenant; »doch hätt' ich nicht gedacht, daß Ihr den Sieg, wenn Ihr es einen nennt, in dieser Kammer für Euch allein feiern wollt, während Ihr im Rathe vermißt werdet.«
»Aber bin ich dort vermißt?« sagte der Syndicus.
»Ei, freilich seid Ihr's, um für die Rechte Lüttichs aufzustehen, die mehr denn je in Gefahr sind,« antwortete der Lieutenant.
»Pfui, Peterkin,« antwortete sein Vorgesetzter, »du bist immer so ein grilliger Murrkopf« – –
»Murrkopf? Ich nicht,« sagte Peterkin; »was andern Leuten gefällt, wird immer auch mir gefallen. Ich wünsche nur, daß wir keinen König Storch statt eines Königs Klotz erlangt haben, wie in der Fabel, die der Küster von St. Lambert aus Meister Aesops Buche zu lesen pflegte.«
»Ich errathe Eure Meinung nicht, Peterkin,« sagte der Syndicus.
»Nun wohlan, ich sage Euch, Meister Pavillon, daß dieser Eber, oder Bär, gewiß Schönwald zu seiner eigenen Höhle machen wird, und daß wir dann wahrscheinlich einen schlimmern Nachbar für unsere Stadt an ihm haben, als an dem alten Bischof. Hier hat er sich die ganze Eroberung zugeeignet, und ist nur unschlüssig, ob er sich Fürst oder Bischof nennen soll; – und eine Schmach ist es, zu sehen, wie der alte Mann von ihnen gemißhandelt worden ist.«
»Ich will es nicht dulden, Peterkin,« sagte Pavillon, aufspringend; »ich haßte die Bischofsmütze, doch nicht das Haupt, das sie trug. Wir sind Zehn gegen Einen im Felde, Peterkin, und wollen dies Wesen nicht dulden.«
»Ja, Zehn gegen Einen im Felde, aber blos Mann gegen Mann im Schloß; überdies nimmt Nickel Block der Fleischer, und der ganze Vorstadtpöbel die Partei Wilhelms von der Mark, theils um in Saus und Braus zu jubiliren (denn er hatte alle Bier- und Weinfässer preisgegeben), theils aus altem Haß gegen uns, die wir Zunftgenossen sind und Privilegien haben.«
»Peterkin,« sagte Pavillon, »wir wollen sogleich nach der Stadt gehen. Ich will nicht länger in Schönwald bleiben.«
»Aber die Schloßbrücken sind aufgezogen, Meister,« sagte Geislaer – »die Thore geschlossen und von den Lanzknechten bewacht; und wenn wir den Weg mit Gewalt erzwingen wollten, so würden diese Kerle, deren tagtäglich Geschäft Krieg ist, uns, denen Fechten nur Feiertagsarbeit ist, übel mitspielen.«
»Aber warum hat er die Thore besetzt?« sagte der besorgte Bürger; »oder warum will er ehrliche Männer zu Gefangenen machen?«
»Ich kann's nicht sagen,« antwortete Peterkin. »Es geht da ein Geschrei um die Damen von Croye, die während des Sturms aus dem Schloß entflohen sind. Dies brachte den Mann mit dem Bart zuerst außer sich, und nun hat ihn das Trinken gleichfalls außer sich gebracht.«
Der Bürgermeister warf einen trostlosen Blick auf Quentin, und schien in Verlegenheit, was zu thun sei. Durward, der bei diesem Gespräch kein Wort verloren hatte, weil er davon höchlich beunruhigt ward, sah gleichwohl ein, daß ihre Sicherheit einzig auf der Aufrechthaltung seiner eigenen Geistesgegenwart beruhe, so wie auf der Erhaltung des Muthes Pavillons. Er mischte sich nun kühn in die Unterhaltung, als Einer, der ein Recht hat, seine Stimme abzugeben. – »Ich bin beschämt,« sagte er, »mein Herr Pavillon, zu bemerken, daß Ihr unschlüssig seid, was hier zu thun sei. Geht kühn zu Wilhelm von der Mark, und verlangt freien Abzug vom Schlosse für Euch, Euren Lieutenant, Euren Knappen und Eure Tochter. Er kann Euch unter keinem Vorwande gefangen halten.«
»Für mich und meinen Lieutenant – das bin ich selber und Peterkin? – Gut, aber wer ist mein Knappe?«
»Ich bin es für jetzt,« erwiederte der unverzagte Schotte.
»Ihr?« sagte der betroffene Bürger; »aber seid Ihr nicht der Abgeordnete König Ludwigs von Frankreich?«
»Wahr; aber meine Botschaft geht an den Magistrat zu Lüttich – und blos in Lüttich werd' ich mich ihrer erledigen. – Wenn ich vor Wilhelm von der Mark meine Eigenschaft anerkennen wollte, müßt' ich dann nicht in Unterhandlung mit ihm treten? Ja, und wahrscheinlich würd' er mich zurückhalten. Ihr müßt mich insgeheim in der Eigenschaft Eures Knappen mit aus dem Schlosse nehmen.«
»Gut – mein Knappe; aber Ihr spracht von meiner Tochter – meine Tochter ist, hoff' ich, sicher in meinem Hause in Lüttich – wohin ich auch ihren Vater wünsche, von ganzem Herzen und ganzer Seele.«
»Diese Dame,« sagte Durward, »wird Euch Vater nennen, so lange wir hier sind.«
»Und für mein ganzes übriges Leben,« sagte die Gräfin, sich zu des Bürgers Füßen werfend und seine Kniee umschlingend. – »Nie soll ein Tag vergehen, an welchem ich Euch nicht ehren, lieben und für Euch beten will, wie eine Tochter für ihren Vater, wenn Ihr mir nur in dieser fürchterlichen Lage beisteht. – O, seid nicht hartherzig! Denkt, Eure eigene Tochter kniete so vor einem Fremden, und bät' um Leben und Ehre bei ihm – denkt daran, und gebt mir den Schutz, welchen Ihr Eurer Tochter wünschen würdet!«
»Fürwahr,« sagte der gute Bürger, sehr gerührt von ihrer ausdrucksvollen Rede – »ich glaube, Peterkin, dieses artige Mädchen hat etwas von unsers Trudchens süßem Blicke, mir kam es gleich so vor; und auch der muntere Jüngling hier, der so mit seinem Rath bei der Hand ist, hat Aehnlichkeit mit Trudchens Liebhaber. – Ich wette d'rauf, Peterkin, dies ist eine Liebesgeschichte, und es wäre Sünde, sie nicht zu fördern.«
»Eine Sünd' und Schande wär's,« sagte Peterkin, ein gutmüthiger Flamänder, trotz all' seiner Selbstgefälligkeit; und während er so sprach, trocknete er sein Auge mit dem Aermel seines Wammses.
»Demnach soll sie meine Tochter sein,« sagte Pavillon, »gehörig in ihren schwarzseidenen Schleier gehüllt; und wenn nicht genug treuherzige Gerber vorbanden sind, sie zu schützen, da sie die Tochter des Syndicus ist, so sollen sie nie wieder eine Haut gerben. – Aber hört, es wird Fragen zu beantworten geben – wie, wenn man mich fragt, was meine Tochter hier bei solchem Blutvergießen gemacht hat?«
»Was hat die Hälfte der Lütticher Weiber hier gemacht, als sie uns zum Schlosse folgten?« sagte Peterkin; »sie hatten gewiß keinen andern Grund, als daß sie eben dahin wollten, wohin sie gar nicht gehörten. – Unsre Jungfrau Trudchen ist ein wenig weiter als die Andern gekommen – das ist Alles.«
»Trefflich gesprochen,« sagte Quentin; »seid nur kühn und nehmt dieses Herrn guten Rath an, edler Herr Pavillon, und, ohne Euch selber Mühe zu machen, verrichtet Ihr die würdigste Handlung seit den Tagen Karl des Großen. – Hier, süße Dame, hüllt Euch dicht in diesen Schleier« (denn viele Gegenstände weiblichen Putzes lagen im Zimmer zerstreut), – »seid getrost, und binnen wenigen Minuten werdet Ihr in Freiheit und Sicherheit sein. – Edler Herr,« setzte er hinzu, sich an Pavillon wendend, »gehen wir denn!«
»Halt – halt – halt eine Minute,« sagte Pavillon, »mir ahnt Unheil! – Dieser von der Mark ist ein Wüthrich; ein vollkommener Eber seiner Natur wie seinem Namen nach; wie, wenn die junge Dame eine von denen von Croye wäre? – und wie, wenn er sie entdeckte und in Zorn geriethe?«
»Und wenn ich eine von jenen unglücklichen Frauen wäre,« sagte Isabelle, im Begriff, ihm wieder zu Füßen zu fallen, »könntet Ihr mich deßhalb in diesem Augenblicke der Verzweiflung verlassen? O, daß ich in der That Eure Tochter wäre, oder die Tochter des ärmsten Bürgers!«
»Nicht so arm – gar nicht so arm, junge Dame – wir können das Unsre bezahlen,« sagte der Bürger.
»Verzeiht, edler Herr,« begann das unglückliche Mädchen von Neuem.
»Kein edler Herr,« sagte der Syndicus; »ein schlichter Bürger von Lüttich, der seine Wechsel in baaren Gulden bezahlt. – Doch das gehört nicht hieher. – Wohlan, sagt nur, Ihr seid eine Gräfin, aber trotzdem will ich Euch schützen.«
»Ihr seid dazu verpflichtet, und wäre sie auch eine Herzogin,« sagte Peterkin, »Ihr habt einmal Euer Wort gegeben.«
»Recht, Peterkin, ganz recht,« sagte der Syndicus; »es ist unsre alte niederländische Weise: ›ein Wort ein Mann!‹ Und nun laßt uns an das Werk. – Wir müssen uns von diesem Wilhelm von der Mark verabschieden, und doch weiß ich nicht – mir ahnt Böses, wenn ich an ihn denke; und könnte diese Ceremonie abgewendet werden, so wäre mir das eben recht.«
»Thätet Ihr nicht besser, da Ihr doch eine Macht beisammen habt, vor das Thor zu rücken und die Wache zu überwältigen?«
Aber einstimmig rief Pavillon und sein Rathgeber, daß ein solcher Angriff auf die Krieger ihres Bundesgenossen nicht thunlich sei, und zugleich machten sie einige Andeutungen auf seine Verwegenheit, wodurch sich Quentin überzeugte, daß sich dergleichen Wagniß mit solchen Genossen nicht unternehmen ließe. Sie beschloßen daher, kühn nach der großen Schloßhalle zu gehen, wo, wie sie hörten, der wilde Eber der Ardennen sein Gelag hielt, und freien Ausgang für den Syndicus von Lüttich und seine Begleiter zu verlangen, ein Gesuch, welches, wie es schien, zu vernünftig war, um abgeschlagen zu werden. Noch immer seufzte der gute Rathsherr, wenn er auf seine Begleiter blickte, und rief seinem treuen Peterkin zu: »Siehst du, was es gefährlich ist, ein zu kühnes und gefühlvolles Herz zu haben! Ach, Peterkin! wie viel haben mich Muth und Menschlichkeit schon gekostet, und wie viel werd' ich noch für meine Tugenden zahlen müssen, eh' uns der Himmel aus diesem verdammten Schlosse Schönwald befreit!«
Als sie über die Höfe gingen, die noch mit Sterbenden und Todten bedeckt waren, flüsterte Quentin, indem er Isabellen durch die Schreckensscenen führte, ihr Muth und Trost zu, und erinnerte sie, daß ihre Sicherheit einzig von ihrer Festigkeit und Geistesgegenwart abhänge.
»Nicht von der meinen, nicht von der meinen,« sagte sie, »sondern einzig von der Eurigen: – O, wenn ich nur dieser furchtbaren Nacht entgehe, so werd' ich nimmer dessen vergessen, der mich errettete! Nur eine Gefälligkeit noch, um die ich Euch bitte – ich beschwöre Euch, sie mir zu gewähren, beschwöre Euch bei Eurer Mutter Ehre und bei Eures Vaters Ruhm!«
»Was könntet Ihr bitten, ohne daß ich es gewährte?« sagte Quentin leise.
»Stoßt Euren Dolch in mein Herz,« sagte sie, »eh' Ihr mich als Gefangene in die Hände dieser Ungeheuer kommen laßt.«
Quentins einzige Antwort war ein Handdruck, dessen Erwiederung nur der Schrecken zu verhindern schien. Und, auf ihren jungen Beschützer gelehnt, betrat sie die furchtbare Halle, während Pavillon und sein Lieutenant voranschritten und etwa ein Dutzend Kürschner- und Gerbergesellen folgten, die als Ehrenwache ihren Syndicus begleiteten.
Bereits als sie der Halle nahten, schien das Jubelgeschrei und der Ausbruch wilden Gelächters, welcher herabtönte, eher ein Gelag von Teufeln zu verkünden, die sich eines Triumphes über das Menschengeschlecht freuten, als ein Fest menschlicher Wesen, die eine kühne Unternehmung glücklich vollbracht hatten. Ein so fester Muth, wie ihn allein die Verzweiflung eingeflößt haben konnte, unterstützte die erzwungene Standhaftigkeit der Gräfin Isabelle; unverzagter Sinn, der sich mit der Gefahr steigerte, beseelte Durward; Pavillon aber und sein Lieutenant machten aus der Noth eine Tugend, und sahen ihrem Geschick gleich den Bären, die an einen Pfahl gebunden sind, entgegen, welche nothwendigerweise der Gefahr stehen müssen.
Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Die Zecher.
Cade. Wo ist Dick, der Fleischer von Ashford?
Dick. Hier, Sir.
Cade. Sie fielen vor dir, wie Schafe und Ochsen; und du benahmst dich, als wärst du in deinem eignen Schlachthause.
Zweiter Theil von König Heinrich VI.
Kaum konnte ein mehr seltsamer und schrecklicher Wechsel möglich sein, als der in der Schloßhalle von Schönwald stattgefunden hatte, seit Quentin dort dem Mittagsmahl beiwohnte; und es war in der That eine Scene, welche mit den furchtbarsten Zügen das Elend des Krieges malte, zumal des Krieges, der von den schonungslosesten aller Krieger, den Miethsoldaten einer barbarischen Zeit geführt ward; Männer waren es, welche durch Gewohnheit und tägliche Uebung mit alledem vertraut geworden waren, was grausam und blutig am Kriege ist, während sie des Patriotismus und des romantischen Rittersinnes gänzlich entriethen.
Statt des ordentlichen, anständigen und etwas förmlichen Mahles, wozu sich bürgerliche und geistliche Beamte wenige Stunden zuvor in dem nämlichen Raume versammelten, wo ein leichter Scherz nur leise ausgesprochen werden konnte, und wo, bei allem Ueberfluß an Speisen und Wein, ein Anstand herrschte, der fast zur Heuchelei ward, da war nun eine Scene wilder und tobender Schwelgerei, wie sie Satan selbst, hätte er das Festmahl in Person angerichtet, nicht schlimmer bieten konnte.
Am obern Ende der Tafel saß, in des Bischofs Thronsessel, den man eilig aus seinem großen Rathszimmer hierher gebracht hatte, der gefürchtete Eber der Ardennen selbst, der diesen schrecklichen Namen wohl verdiente, dessen er sich zu freuen schien und den er auch so viel als möglich zu verdienen strebte. Er hatte den Helm abgelegt, trug aber außerdem seine gewichtige und glänzende Rüstung, die er wirklich nur selten ablegte. Ueber seine Schulter hing ein grober Ueberwurf, aus der Haut eines großen wilden Ebers gemacht, dessen Hufen und Hauzähne von massivem Silber gefertigt waren. Die Haut des Kopfes war so zubereitet, daß sie, über den Helm gezogen, wenn der Freiherr bewaffnet war, oder auch als Kappe, wenn er ohne Helm ging, wie es jetzt der Fall war, ihm das Ansehen eines grinzenden, scheußlichen Ungeheuers gab; und doch bedurfte das Gesicht, welches so überschattet wurde, kaum solcher Schreckmittel, um das Furchtbare seines natürlichen Ausdruckes zu erhöhen.
Der obere Theil des Gesichts Wilhelms von der Mark, wie es die Natur geformt hatte, strafte fast seinen Charakter Lügen. Denn obwohl sein Haar, wenn er es unbedeckt zeigte, den rauhen und wilden Borsten der Kappe glich, die er überzog, so versprachen doch eine offne, hohe und männliche Stirn, volle rothe Wangen, große glänzende, hellfarbige Augen und eine Adlernase, Tapferkeit und Großmuth. Aber die Wirkung dieser glücklichern Züge ward gänzlich durch die Gewohnheit der Gewaltthat und der Unbändigkeit vernichtet, die, vereinigt mit Schwelgerei und Unmäßigkeit, diesen Zügen einen Charakter aufgeprägt hatten, der mit der rauhen Ritterlichkeit, die sie sonst bezeichnet haben würden, im Widerspruch stand. Jene Wuth hatte, weil sie Gewohnheit geworden, die Backenmuskeln, sowie die um die Augen gelegenen, und diese vorzüglich, aufgeschwellt; schlechte Sitten und Gewohnheiten hatten die Augen selbst trübe gemacht, den Theil derselben, der weiß sein sollte, geröthet und das ganze Gesicht jenem häßlichen Ungeheuer ähnlich gemacht, welchem der schreckliche Freiherr sich gern vergleichen ließ. Aus einer ganz besondern Art des Widerspruchs jedoch bemühte sich Wilhelm von der Mark, während er sonst das Ansehn eines wilden Ebers annahm und sich selbst des Namens zu freuen schien, durch die Länge und Stärke seines Bartes den Umstand zu verstecken, der ihm die Benennung ursprünglich zugezogen hatte. Dies war eine ungewöhnliche Stärke und ein Hervorragen des Mundes und der Unterkinnlade, was, sammt den großen, vorstehenden Seitenzähnen, ihm die Aehnlichkeit mit jenem wilden Thiere gab; so daß er, zumal da er auch gern im Ardennerwalde jagte, den Namen des Ebers der Ardennen erhielt. Der Bart, groß, wirr und ungekämmt, versteckte aber keineswegs das Schreckenhafte seines Gesichts, und vermochte auch den brutalen Ausdruck desselben nicht zu veredeln.
Die Krieger und Offiziere saßen rings um die Tafel, untermischt mit den Männern aus Lüttich, deren einige aus den niedersten Ständen waren; unter ihnen zeichnete sich Nickel Block der Fleischer, der nahe beim Eber saß, durch seine aufgestreiften Aermel aus, wodurch Arme sichtbar wurden, die bis an die Ellbogen mit Blut versudelt waren, gleich wie das große Messer, das vor ihm auf dem Tische lag. Die Soldaten trugen meistens lange verworrene Bärte, ebenso wie ihr Anführer; ihr Haar war aufwärts gestrichen, um dadurch die natürliche Wildheit ihres Ansehens zu erhöhen; und berauscht, wie viele von ihnen zu sein schienen, theils durch die Freude über ihren Sieg, theils durch die vielen vollen Gläser, die sie geschlürft hatten, boten sie ein häßliches und widerliches Schauspiel dar. Das Gespräch, welches sie hielten, und die Lieder, welche sie sangen, ohne dabei von einander Gehör zu verlangen, waren so schlüpfrig und lästerlich, daß Quentin Gott dankte für den ungeheuren Lärm, welcher für seine Begleiterin Alles unverständlich machte.
Es bleibt nur noch, in Bezug auf die bessere Klasse der Bürger, welche mit den Kriegern Wilhelms von der Mark Theil an dem fürchterlichen Gelage nahmen, zu sagen übrig, daß die bleichen Gesichter und ängstlichen Mienen der meisten derselben zeigten, daß ihnen entweder das Mahl nicht gefiel, oder daß sie ihre Kameraden fürchteten; andre jedoch, von niedriger Erziehung oder roherem Charakter, sahen in den Excessen der Soldaten nur ein ritterliches Benehmen, welches sie nachzuahmen strebten; und, um darin so weit als möglich zu kommen, verschlangen sie ungeheure Becher voll Wein und Schwarzbier – ein Laster, welches zu allen Zeiten in den Niederlanden nur zu gewöhnlich war.
Die Anrichtung des Mahles war eben so unordentlich gewesen, als die ganze Gesellschaft. Des Bischofs ganzes Silbergeschirr, (ja selbst das zum Dienste der Kirche gehörige, denn der Eber der Ardennen kümmerte sich nicht um den Vorwurf des Kirchenraubes –) war mit irdnem Geschirr, großen ledernen Feldflaschen und Trinkhörnern der gemeinsten Art untermischt.
Ein entsetzlicher Vorfall bleibt hier noch zu erwähnen übrig, und gern überlassen wir's der Phantasie des Lesers, den Rest der Scene selber auszumalen. Bei dieser wilden Zuchtlosigkeit der Soldaten Wilhelms von der Mark, hatte Einer, der von der Tafel ausgeschlossen war, (ein Lanzknecht, ausgezeichnet durch seinen Muth und sein kühnes Benehmen während der heutigen Erstürmung,) unverschämterweise einen großen Silberbecher weggenommen und mit der Erklärung hinweggetragen, daß ihn dies für seine Ausschließung vom Gelage entschädigen solle. Der Anführer lachte, daß ihm die Seiten erschütterten, über einen Scherz, der mit dem Charakter des ganzen Corps übereinstimmte; als aber ein Anderer, der weniger wegen Kühnheit in der Schlacht berühmt schien, sich dieselbe Freiheit herauszunehmen wagte, setzte Wilhelm von der Mark sogleich dieser scherzhaften Sitte ein Ziel, welche sonst die Tafel bald alles werthvollen Schmuckes beraubt haben würde. – »Ho! bei dem Geiste des Donners!« rief er, »die, welche im Angesicht des Feindes nicht Männer zu sein wagen, dürfen sich unter ihren Freunden nicht unterstehn, Diebe zu sein. Was, du feiger Schuft! du, der da wartete, bis das Thor geöffnet und die Brücke aufgezogen war, während Konrad Horst sich über Graben und Mauer den Weg erzwang, willst du dich deß unterfangen? – Knüpft ihn an das Gitter des Saalfensters auf! – Er soll Takt mit den Füßen schlagen, während wir einen Becher auf seine glückliche Reise zum Teufel trinken.«
Das Urtheil ward so schnell vollzogen als gesprochen; in einem Augenblick nachher hauchte der Arme, an den Eisenstäben aufgehangen, seine Seele schon aus. Sein Körper hing noch dort, als Quentin und die Andern die Halle betraten; der Körper, welcher den bleichen Mondstrahl aufhielt, warf über den Boden hin einen ungewissen Schatten, welcher unbestimmt doch furchtbar die Umrisse des Gegenstandes nachahmte, welcher ihn hervorbrachte.
Als die Ankunft des Syndicus Pavillon in dieser stürmischen Versammlung von Mund zu Mund angekündigt ward, bemühte er sich, Kraft seines Ansehens und Einflusses, eine Miene der Wichtigkeit und des Gleichmuths anzunehmen, die ihm, nach einem Blick auf den schrecklichen Gegenstand am Fenster und auf die wilde Scene ringsum, sehr schwer zu behaupten ward, obgleich ihm Peterkin mahnend, aber selber etwas betroffen, in's Ohr flüsterte: »herzhaft, Meister, oder wir sind verloren!«
Der Syndicus behauptete indeß seine Würde so gut er konnte, während er in der kurzen Anrede der Gesellschaft zu dem großen Siege Glück wünschte, den die Krieger Wilhelms von der Mark und die guten Bürger von Lüttich gewonnen hatten.
»Ja,« antwortete Wilhelm von der Mark spöttisch, »wir haben endlich das Wild erlegt, wie der Dame Windspiel zum Wolfshund sagte. Aber seht da! Herr Bürgermeister, Ihr kommt wie Mars, mit der Schönheit an Eurer Seite. Wer ist diese Hübsche? – Entschleiert, entschleiert – Heutnacht nennt kein Weib ihre Schönheit ihr eigen.«
»Es ist meine Tochter, edler Hauptmann,« antwortete Pavillon; »und ich muß Euch um Verzeihung bitten, daß sie ihren Schleier trägt. Sie hat es so den heiligen drei Königen gelobt.«
»Ich will sie gleich vom Gelübde lossprechen,« sagte von der Mark; »denn hier mit einem Messerschlag will ich mich zum Bischofe von Lüttich weihen; und ich hoffe, ein lebendiger Bischof ist drei todte Könige werth.«
Die Gäste schauderten und murrten; denn Lüttichs Bürgerschaft, und selbst einige der rohen Soldaten verehrten die Könige von Cöln, wie man sie gewöhnlich nannte, obwohl sie sonst nichts achteten.
»Nun, ich habe gegen ihre verstorbnen Majestäten nichts Böses im Sinne,« sagte von der Mark; »blos Bischof will ich werden. Ein Fürst, der zugleich weltlich und geistlich ist, der da Macht hat, zu binden und zu lösen, wird am besten für eine Bande Bösewichter, wie ihr seid, passen, denen kein Anderer Absolution geben würde. – Aber kommt hieher, edler Bürgermeister – setzt Euch neben mich, Ihr sollt sehen, wie ich mir eine Vakanz zu meinem eignen Besten bereite. – Bringt unsern Vorgänger auf dem heiligen Stuhle herein.«
Ein Geräusch erhob sich in der Halle, während Pavillon, der den angebotenen Ehrensitz höflich ablehnte, sich am untern Ende der Tafel niederließ und seine Begleiter sich dicht hinter ihm hielten, nicht unähnlich einer Heerde Schafe, die, wenn ein fremder Hund erscheint, sich wohl zuweilen hinter einem alten Leithammel versammelt, der, Kraft seines Amtes und Ansehens, auch mehr Muth als sie selber zu haben scheint. Nahe bei diesem Platze saß ein sehr hübscher Bursch, wie man sagte, ein natürlicher Sohn des Wüthenden von der Mark, gegen den dieser zuweilen Zuneigung, ja Zärtlichkeit zeigte. Die Mutter des Burschen, eine schöne Concubine, starb durch einen Schlag, den ihr der wüthende Häuptling in einem Anfall von Trunkenheit oder Eifersucht ertheilte; und ihr Tod verursachte nachher dem Tyrannen so viel Gewissensqual, als er zu empfinden fähig war. Seine Zuneigung zu dem überlebenden Kinde mochte zum Theil auf jenem Umstande beruhen. Quentin, der diesen Zug von des Häuptlings Charakter schon durch den alten Priester erfahren hatte, stellte sich so dicht als möglich bei dem Jünglinge auf; denn er war entschlossen, sich seiner entweder als Geißel oder als Beschützers zu bedienen, wenn andere Rettungsmittel fehlschlügen.