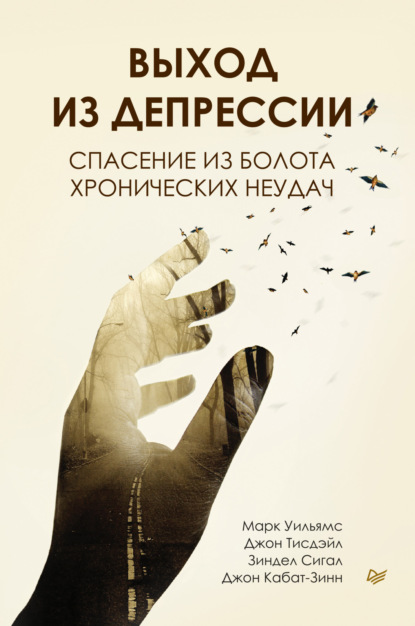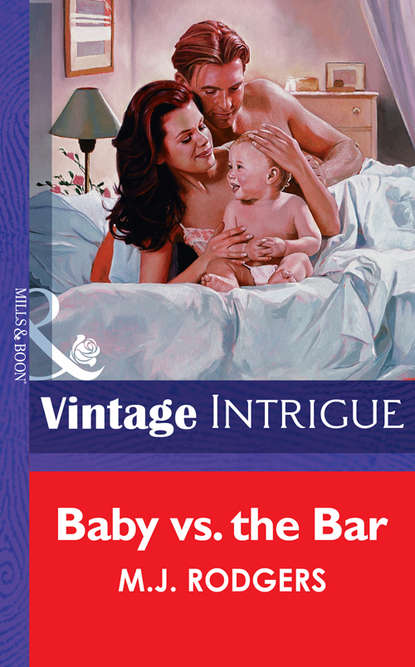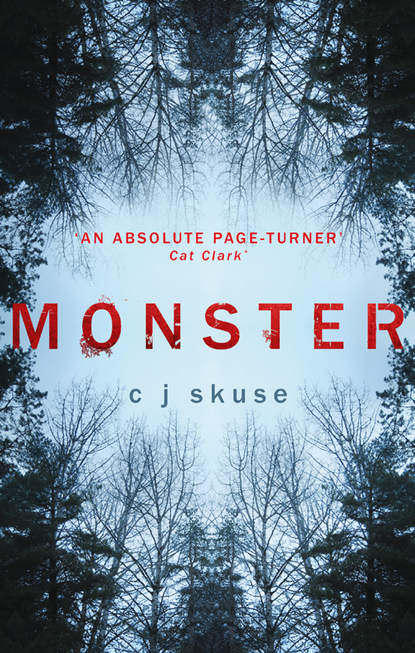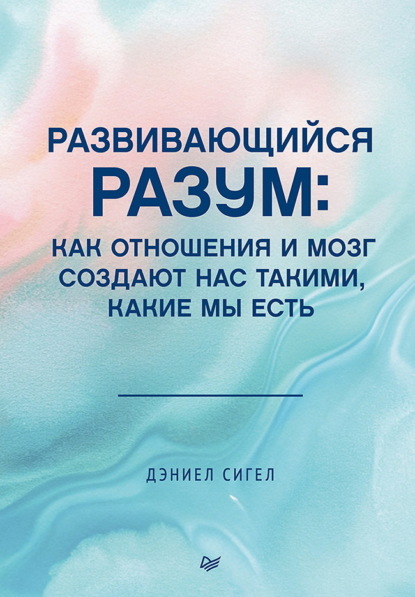- -
- 100%
- +
„Sollten in der DDR Schritte erforderlich sein, so wäre mit zu überprüfen, ob nicht auch in den polnisch besetzten Gebieten zugleich eine wenigstens vorläufige Lösung gefunden werden kann. Es erscheint mir notwendig, dass bei allen Überlegungen beide Gebiete im Blick behalten werden, dies schon deshalb, weil ja die Bundesrepublik für beide Gebiete auf die Geltendmachung ihrer konkordatär festgelegten Rechte verzichten müsste.“50
Nach einer Unterredung im vatikanischen Staatssekretariat hatte Bengsch diesen Gedanken sogar als offiziellen Vorschlag unterbreitet:
Sollte sich die Möglichkeit ergeben, in den polnischen Westgebieten Apostolische Administratoren einzusetzen, „halte ich es für notwendig, dasselbe gleichzeitig in den ostdeutschen Jurisdiktionsgebieten zu tun. […] Auch ich würde eine Änderung für die ‚DDR’ allein nicht befürworten. […] Wenn aber in den westpolnischen Gebieten Administratoren eingesetzt werden, ergibt sich eine andere Lage.“51
Als daraufhin „offenbar in den Bonner Ministerien unnötige Unruhe hervorgerufen“ wurde, schrieb Bengsch im April 1967 an Nuntius Bafile, er sei auch mit einer anderen Regelung einverstanden.
„Wichtig ist nur, wie mir scheint, dass alles, was nicht mehr von den westdeutschen Ordinarien veranlasst oder getragen werden kann, von der Autorität des Heiligen Stuhles veranlasst oder getragen wird.“52
Die Vertragspolitik der sozial-liberalen Bundesregierung Brandt/Scheel spielte dem Vatikan nach 1969 das damals entscheidende Argument zu, zunächst in Bezug auf die Gebiete östlich der Oder und Neiße einen wichtigen Schritt weiterzugehen. Nach der Unterzeichnung und Ratifizierung des Warschauer Vertrags am 3. Juni 197253 reagierte Rom binnen drei Wochen – und errichtete vier neue polnische Diözesen.54 In der vatikanischen Erklärung55 wurde zur Begründung auf pastorale Notwendigkeiten hingewiesen. Die vor dieser Entscheidung nicht konsultierte Deutsche Bischofskonferenz tat sich freilich schwer, gerade diese Begründung als ausschlaggebend zu akzeptieren.56 In Rom hieß es damals, man beabsichtige weiterhin keine endgültigen Regelungen vor einem noch zu schließenden Friedensvertrag, aber eine vatikanische Reaktion auf die Ratifizierung des Warschauer Vertrages sei unausweichlich notwendig, schließlich könne man in Rom nicht deutscher sein als die Deutschen selbst.
Kritiker dieser Entscheidung wiesen darauf hin, dass die vatikanische Neuregelung nur die Anpassung im Westen Polens vorgenommen, die „übrigen Grenzen“ Polens aber nicht berücksichtigt habe. Corrado Bafile, seit 1960 Apostolischer Nuntius in Deutschland, versicherte den zahlreichen Kritikern der vatikanischen Entscheidung in einem allgemeinen Antwortschreiben am 31. Juli 197257, er stehe den vorgebrachten Argumentationen keineswegs fremd gegenüber, die Kritiker fänden bei ihm Respekt und Anteilnahme. Gleichzeitig warb er um Verständnis für den Heiligen Stuhl, der verpflichtet sei, zunächst und vor allem die Seelsorge optimal zu gewährleisten. Von polnischer Seite seien in den vergangenen Jahren immer wieder schwere Vorwürfe erhoben worden, Rom lasse sich zu sehr von politischen Erwägungen leiten und ablenken.
„In der Tat“, schrieb der Nuntius, „wäre es für die polnischen Katholiken unverständlich gewesen, wenn der Heilige Stuhl sich in der neuen Situation länger geweigert hätte, den polnischen Bischöfen in ihrem Willen zur inneren Festigung der Kirche beizustehen. Das jetzt entstandene Missverständnis bezüglich der päpstlichen Anordnung bestehe hauptsächlich darin, dass die Errichtung der neuen Diözesen und die Ernennung der Bischöfe als ein Akt nicht so sehr kirchlicher oder pastoraler als vielmehr politischer Natur aufgefasst wird, d.h. als politische Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Eine solche Auffassung sei jedoch nicht gerechtfertigt. Der Heilige Stuhl habe mit seiner Anordnung keine Anerkennung politischer Art ausgesprochen: das wäre auch gar nicht seine Aufgabe gewesen. Der Heilige Stuhl hat vielmehr eine Maßnahme kirchlicher Natur in einer Angelegenheit seiner Zuständigkeit getroffen und sich dazu erst entschieden, nachdem die Grenzlinie an der Oder-Neiße zwischen den beteiligten Staaten als unverletzlich erklärt worden war.“58
Auf den Vorwurf, der Heilige Stuhl habe zwar die Bistumsgrenzen an die Oder-Neiße-Grenze angepasst, in Bezug auf die „Diözesen, die an den übrigen Grenzen Polens liegen“, aber nichts dergleichen getan, antwortete Bafile:
„Demgegenüber ist geltend zu machen, dass derartige Probleme sich nicht mittels schematischen Vorgehens lösen lassen, unabhängig von den realen Bedürfnissen der Seelsorge. Es ist doch so: während für die Gebiete jenseits der Oder - Neiße seit Jahren eine Neuordnung der Diözesen nachdrücklich verlangt wurde, liegt ein ähnliches Anliegen betreffs der Gebiete entlang der übrigen polnischen Grenzen im allgemeinen nicht vor. Außerdem sind in den Gebieten jenseits dieser letztgenannten Grenzen die gegenwärtigen Verhältnisse nicht gerade günstig für eine neue Organisierung der Seelsorge.“59
Die Neuregelung in Polen hatte eine wichtige Signalwirkung für die Politik der vielen kleinen Schritte der 1970er Jahre in der DDR. Mit der in der Verlautbarung vom 28. Juni 1972 errichteten Apostolischen Administratur Görlitz, die aus dem Gebiet der Erzdiözese Breslau ausschied, hatte der Vatikan erstmals in einem kirchenrechtlichen Akt von der Deutschen Demokratischen Republik Kenntnis genommen.
Am 21. Dezember 1972 unterzeichneten Egon Bahr und Michael Kohl in Ost-Berlin den Grundlagenvertrag. Nach dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung – der Bundestag ratifizierte am 11. Mai 1973, die Volkskammer am 13. Juni 1973 – verstärkte die DDR den Druck auf den Vatikan und die katholischen Bischöfe. Jetzt wollte die DDR auch kirchenpolitisch wie ein souveräner Staat behandelt werden. Dabei ging es erstens um die Forderung der völligen kirchenrechtlichen Trennung der Kirche in den beiden Teilen Deutschlands, zweitens um die Errichtung einer Diözese auf dem Gebiet der DDR, drittens um die Einrichtung einer eigenen Bischofskonferenz und schließlich um die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der DDR zum Vatikan.
Am 14. Juli 1973 ernannte Papst Paul VI. die Bischöflichen Kommissare von Erfurt, Schwerin und Magdeburg, Hugo Aufderbeck, Heinrich Theissing und Johannes Braun, zu Apostolischen Administratoren und den Bischöflichen Kommissar von Meiningen, Karl Ebert, zum Weihbischof von Erfurt.60 Dadurch wurde „die Jurisdiktion der Ordinarien von Fulda, Würzburg, Paderborn, Hildesheim und Osnabrück für ihre in der Deutschen Demokratischen Republik gelegenen Diözesananteile suspendiert.“61
Am 22. September 1976 wählte die Deutsche Bischofskonferenz Joseph Kardinal Höffner als Nachfolger des am 24. Juli 1976 überraschend verstorbenen Julius Kardinal Döpfner zu ihrem Vorsitzenden. Döpfner hatte noch alles versucht, den nächsten Schritt in Richtung einer kirchenrechtlichen Anerkennung der DDR – die Errichtung der Berliner Bischofskonferenz – zu verhindern, blieb aber erfolglos. Der Heilige Stuhl hatte gerade noch Rücksicht auf den Termin der Bundestagswahl am 3. Oktober 1976 genommen, ließ sich aber am 26. Oktober 1976 von der Umwandlung der Berliner Ordinarienkonferenz in die „Berliner Bischofskonferenz“ nicht abhalten:
„Die neue Bischofskonferenz tritt an die Stelle der früheren Berliner Ordinarienkonferenz, welche als Regionalkonferenz im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz galt, und hat die Funktionen und Befugnisse, welche die geltenden kirchenrechtlichen Bestimmungen den unabhängigen Bischofskonferenzen für ihre betreffenden Territorien zuerkennen. […] Die Errichtung der Berliner Bischofskonferenz entspricht Bedürfnissen, die kirchlicher Natur sind.“62
In der offiziellen Stellungnahme der deutschen Bischöfe hieß es:
„Die Deutsche Bischofskonferenz versteht diese kirchenrechtliche Verselbständigung der Berliner Ordinarienkonferenz nicht als Trennung, sondern sie weiß sich mit ihren bischöflichen Mitbrüdern in der DDR auch fernerhin eng verbunden. […] Die seelsorglichen Erwägungen, die den Heiligen Stuhl veranlasst haben, die genannte Maßnahme zu treffen, sind in der heute vom Presseamt des Heiligen Stuhls veröffentlichen Erklärung dargelegt. Die Deutsche Bischofskonferenz verweist auf diese Erklärung.“63
Polen stand von jetzt an und für die nächsten 15 Jahre mit hoher Priorität auf der politischen Tagesordnung in Deutschland. Karol Wojtyła wurde jetzt auch von der politischen Seite ein gefragter Gesprächspartner. Als Erzbischof von Krakau hatte Wojtyła zu Kardinal König in Wien und zu einigen deutschen Bischöfen freundschaftliche Beziehungen gepflegt und sich in ganz verschiedenen Angelegenheiten als Vermittler betätigt. In diesen Zusammenhang gehört auch die Anregung Wojtyłas, ein Stipendienprogramm aufzulegen, das polnischen Stipendiaten ein Studium in Paris ermöglichen sollte. Das daraufhin von Johannes Schauff und vielen anderen – Heinrich von Brentano, Herbert Czaja, Baron Theodor zu Guttenberg, Reinhold Lehmann, Herbert Wehner – 1969 gegründete „Werk für europäische Partnerschaft“ wurde bis 1990 vom Auswärtigen Amt mit insgesamt 2 Millionen DM unterstützt.
7. Besuch aus Polen 1978
Nach den beiden Polen-Reisen der Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz – 1973 reiste Julius Kardinal Döpfner erstmals nach Polen, im April 1977 der Kölner Kardinal Höffner – kam es vom 20. bis 25. September 1978 unter Leitung des 77-jährigen Primas Wyszyński, der Polen nach 1945 bis zu diesem Tag nur verlassen hatte, um den Vatikan und Italien zu besuchen, zum ersten Gegenbesuch einer zehnköpfigen polnischen Delegation in der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Reisedramaturgie wurde von beiden Seiten peinlich genau darauf geachtet, dass dieser Besuch vor allem zum Besuch des Primas wurde. Dies bedeutete u. a., dass der Erzbischof von Krakau sich in diesen Tagen bewusst im Hintergrund hielt. Kardinal Wojtyła versäumte aber nicht, verschiedentlich an den im Juli 1976 verstorbenen Kardinal Döpfner zu erinnern, der „Gott auf dem Wege der Annäherung an die Kirche in Polen und an unser Volk suchte, nach den Schreckenserfahrungen des Zweiten Weltkrieges.“64 Ohne das Vorbild Kardinal Döpfners wäre damals wahrscheinlich keine neue Qualitätsstufe der deutsch-polnischen (Kirchen-)Beziehungen erreicht worden. Döpfner hatte bereits in seiner berühmt gewordenen Hedwigs-Predigt vom 16. Oktober 1960 dringend empfohlen, den Blick von den gegenseitigen Aufrechnungen zu den gemeinsamen Aufgaben der Zukunft zu wenden. Für die Annahme dieser Anregung in breiteren Kreisen war es damals aber offensichtlich noch zu früh. Auch der Besuch 1978 verlief zunächst noch in den alten Bahnen. Die vertrauten Themen der Vergangenheit wirkten immer noch wie eine nicht abgelöste Hypothek. Die Gespräche drehten sich um die Pflege deutscher Kriegsgräber und allgemein der deutschen Gräber in Polen, um die Möglichkeit zu deutschsprachiger Seelsorge, um gemeinsame Wallfahrten. Um das Problem der Kirchenglocken oder die Zusammenarbeit katholischer Wissenschaftler und Theologen aus beiden Ländern, sowie um die „facultates specialissimae“, die Sonderbefugnisse für Kardinal Hlond, die angeblich von den Päpsten Johannes XXIII. und Paul VI. gegenüber Primas Wyszyński erneuert worden waren.
Für den Erfolg des damaligen Zusammentreffens war dann entscheidend, dass es beiden Seiten – unterstützt durch das bei dieser Begegnung neu entstandene Vertrauen – doch noch gelang, den zukunftsgerichteten Auftrag der Kirche in beiden Ländern als Schwerpunkt herauszustellen. Die beiden Vorsitzenden der Bischofskonferenzen machten mehrfach deutlich, dass die Gestaltung der Zukunft wichtiger sei als der Streit um die Vergangenheit.
„Unsere Kirchen haben die Pflicht“, sagte der Primas zum Abschluss, „das Zusammenleben und die Zusammenarbeit der Nationen auf den Grundprinzipien der christlichen Sittenlehre aufzubauen. Man kann nicht immer in die Vergangenheit zurückblicken, obwohl man sich ihrer erinnern muss, um keine Fehler zu wiederholen.“65
In den Worten Kardinal Höffners hieß dies:
„Es ist unsere tiefe Hoffnung und Überzeugung, dass der Besuch des Primas von Polen bei uns in Deutschland der Ausgangspunkt für eine neue Epoche in unseren Beziehungen und für Europa ist.“66
Kardinal Wojtyła ließ ebenfalls keinen Zweifel:
„Wir sind heute da, um durch die vielen Jahrhunderte hindurch zu unserem gemeinsamen ‚Anfang‘ zu gelangen. […] Ich habe die Hoffnung, dass die Begegnung einen regeren und auch tieferen Austausch der Güter in Gang setzen wird, welche das Leben unserer Kirchen und unserer christlichen Völker formen. […] Ich bin überzeugt, dass dies zur Gestaltung eines neuen Antlitzes Europas und der Welt beitragen wird zur nahenden Jahrhundert- und Jahrtausendwende.“67
Die beiden Bischofskonferenzen vereinbarten damals – auf Vorschlag von Karol Wojtyła – eine bis zum heutigen Tag aktive gemeinsame „Kontaktgruppe“ einzurichten, um künftig die gegenseitige Information zu verstetigen und zu intensivieren. Wojtyła wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er wegen Terminschwierigkeiten, die durch den Tod Papst Pauls VI. und das sich anschließende Konklave entstanden waren, seine Zusage nicht einhalten konnte, gemeinsam mit Mutter Teresa am Freiburger Katholikentag teilzunehmen (13.17.9.1978). Das Motto des Katholikentreffens lautete: Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Nur wenige Wochen später – am 16. Oktober 1978 – wurde Kardinal Wojtyła zum Papst gewählt. Der Besuch in Deutschland von 1978 markierte so auch aus weltkirchlicher Sicht nicht nur ein Ende, sondern auch einen in dieser Form völlig unerwarteten Anfang einer grundlegend neuen Phase vatikanischer Politik, deren Gestaltung der neue Papst sich selbst vorbehielt. Der neue Kardinalstaatssekretär Erzbischof Casaroli hatte Außenminister Genscher schon kurz nach dem Amtsantritt des polnischen Papstes gesagt:
„Herr Minister, wir brauchen uns jetzt über die Fragen, über die wir uns in der Vergangenheit gestritten haben, nicht mehr zu streiten. Bei diesem Papst werden Sie immer recht bekommen.“68
8. Papstbesuch 1980
Die Vorbereitungen für den Besuch Johannes Pauls II. 1980 verliefen nicht in allen Bereichen problemfrei und geräuschlos. Zurecht ging man von einer grundsätzlichen Sympathie der großen Mehrzahl der deutschen Katholiken für den Papst und für die Person Karol Wojtyła aus. In dem skandierten Ruf „Johannes Paul II. – wir stehen an Deiner Seite“ drückte sich bereits bei seiner Ankunft auf dem Flughafen eine spontane emotionale Zustimmung aus.
Die offiziellen diplomatischen Beziehungen verliefen ebenfalls korrekt. Das persönliche Verhältnis des protestantischen Bundeskanzlers Helmut Schmidt zu Karol Wojtyła war dagegen zumindest vorbelastet. Schmidt hatte im November 1977 Polen besucht und dabei auf Rat des Wiener Kardinals Franz König auch einen Besuch in Krakau eingeplant. Dabei habe der damalige Erzbischof von Krakau es „vorgezogen“, erinnert sich Schmidt, „statt eines von mir vorgeschlagenen ‚zufälligen‘ Treffens in seiner Kathedrale mich durch einen hohen Geistlichen begrüßen zu lassen“, „um nicht unnötig Konflikte mit der Regierung in Warschau heraufzubeschwören.“69 Helmut Schmidt fühlte sich dadurch so gekränkt, dass er die Episode mehrfach schriftlich und mündlich festgehalten hat und nach der Wahl des polnischen Papstes Johannes Paul II. und dem polnischen Staats- und Parteichef Gierek gratulierte.
Der Bundeskanzler konnte auch die Haltung Johannes Pauls II. in der Frage der Empfängnisverhütung nicht verstehen. Der Papst sei für seine Argumente unzugänglich geblieben, obwohl er ihm im persönlichen Gespräch mehrere Male versucht habe, „den Circulus vitiosus zwischen Bevölkerungsexplosion, Unterentwicklung und Massenelend zu erklären.“70 Helmut Schmidt fühlte sich gleichwohl und trotz seiner kritischen Bemerkungen „durch die Gottergebenheit und Warmherzigkeit“ des Papstes fasziniert und empfand „menschliche Sympathie.“71
Im deutsch-polnischen Verhältnis hatte im Dezember 1979 ausgerechnet ein katholischer Politiker durch ein Interview im Nachrichtenmagazin Der Spiegel heftige Angriffe provoziert, der zu den engagiertesten Vertretern der Aussöhnung zwischen Polen und Deutschen gehörte: Hans Maier, der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.72 Maier hatte nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Grundvertrag in seiner Eigenschaft als bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus darauf bestanden, dass in allen Karten in Schulbüchern dort, wo politische Grenzen eingezeichnet waren, die Grenzen des Reiches vom 31. Dezember 1937 markiert wurden, um deutlich zu machen, dass über die damalige staatsrechtliche Zugehörigkeit von z.B. Breslau oder Königsberg friedensvertraglich noch nicht entschieden war. Seine Kritiker in Polen und in Deutschland forderten dagegen, sich an die Empfehlung der deutsch-polnischen Schulbuchkommission anzuschließen und „von den gegenwärtigen Realitäten auszugehen.“73
Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hatte seit dem Briefwechsel in der Konzilsaula 1965 zu jedem Katholikentag eine Delegation polnischer Katholiken eingeladen und begrüßen können – erstmals in Bamberg 1966. Einmalig 1980 – auf dem Berliner Katholikentag (4.-8. Juni 1980) – waren die polnischen Katholiken nicht mit führenden Repräsentanten vertreten – aus Protest gegen die Position Hans Maiers in der Frage der politischen Landkarten in den Schulbüchern.
Formeller Anlass der Papst-Reise war der 700. Todestag von Albertus Magnus, der am 15. November 1280 verstorben war und in Köln begraben liegt. „Er war einer der größten Geistesmenschen im 13. Jahrhundert. Er hat wie kaum ein anderer das ‚Netz‘ geknüpft, das Glaube und Vernunft, Gottesweisheit und Weltwissen miteinander verbindet.“74 Der Papst ehrte mit Albertus Magnus aber nicht nur den Wissenschaftler. „In ihm ehre ich zugleich den Genius des deutschen Volkes, ehre ich vor allem die katholische Kirche dieses Landes, die wie in der Vergangenheit bis in unsere Tage ein hoch angesehenes und lebendiges Glied der Weltkirche geblieben ist.“75 Das uneingeschränkte – „wie in der Vergangenheit bis in unsere Tage“ – aus dem Mund des ehemaligen Erzbischofs von Krakau, in dessen Diözese das Vernichtungslager Auschwitz lag und der freiwillig zum Zwangsarbeiter in Polen wurde, um der wahrscheinlichen Deportation ins Reich zu entgehen, überraschte in seiner Eindeutigkeit auch diejenigen, die um das Urteil des Zeitzeugen Wojtyła über die Vergangenheit besser Bescheid wussten.
Für Papst Johannes Paul II. überwogen die Hoffnungen auf die Zukunft die Ängste wegen der Vergangenheit. Er erinnerte auch jetzt noch einmal an den Besuch der polnischen Bischöfe in Deutschland 1978, der zu dem, wie sich inzwischen herausgestellt hat, nicht mehr umkehrbaren Paradigmenwechsel in den deutsch-polnischen Beziehungen von der Vergangenheit zur Zukunft geführt hatte, und rief dazu auf, in den Friedensbemühungen nicht nachzulassen,
„durch die auch Ihr Land zur weltweiten Völkerverständigung maßgeblich beizutragen sucht, mit besonderer Freude (hebe ich) die wachsende Verständigungsbereitschaft zwischen Ihren Bürgern und dem polnischen Volk hervor. Hierbei gebührt bekanntlich auch den Bischöfen und Katholiken in beiden Ländern ein nicht geringes Verdienst. In allen leidvollen Beziehungen zwischen den Völkern gilt der Grundsatz: Nicht das Aufrechnen des gegenseitig sich zugefügten und erduldeten schweren Unrechts und Leids, sondern allein der Wille zur Versöhnung und die gemeinsame Suche nach neuen Wegen friedlichen Zusammenlebens können für die Völker den Weg in eine bessere Zukunft ebnen und gewährleisten.“76
„Ich werde Euch liebe Brüder sehr dankbar sein, wenn Ihr Euch weiterhin darum bemüht, diese Kontakte noch zu vertiefen. Dabei haben wir die Geschichte der Kirche und der Christenheit dieser Nation in ihrer tausendjährigen Dimension vor Augen, in der das Leben ihrer Bürger oft nicht leicht gewesen ist. Diese Nation ist Euch von der göttlichen Vorsehung als unmittelbarer östlicher Nachbar gegeben worden.“77
Eine besondere Mahnung erging an die polnischen Landsleute des Papstes in der Bundesrepublik, mit denen er in Mainz zusammentraf:
„Wenn man ein neues Leben unter veränderten zivilisatorischen Bedingungen beginnt, darf man sich nicht kritiklos faszinieren lassen. Man darf sich nicht durch die technische Zivilisation auf Kosten des Glaubens, des inneren Lebens, der Liebesfähigkeit – mit einem Wort –, zu Lasten all dessen, was für das wahre Menschsein, für die volle Dimension und die Berufung des Menschen entscheidend ist, verschlingen lassen.“78
Der Zukunftsaspekt dominierte auch die ökumenischen Gespräche:
„Gerade in Ihrem Lande, in dem Martin Luther geboren wurde und die ‚Confessio Augustana‘ vor 450 Jahren verkündet worden ist, erschien mir diese Herausforderung für die Zukunft als überaus wichtig und entscheidend. Um was für eine Zukunft handelt es sich? Es geht um jene Zukunft, die für uns als Jünger Christi aus dem Gebet Jesu im Abendmahlssaal hervorgeht, aus dem Gebet: Ich bitte Dich, Vater, ‚alle sollen eins sein‘ (Johannes 17/21).“79
9. Solidarność, Solidarität und Stagnation
Bei dem Deutschlandbesuch des Papstes 1980 war nicht abzusehen, dass sich binnen Jahresfrist die Rahmenbedingungen der deutsch-polnischen Beziehungen grundlegend verändern würden. Am 13. Mai 1981 wurde Papst Johannes Paul II. bei einem Attentat in Rom schwer verletzt, wenige Tage später, am 28. Mai 1981, verstarb in Warschau Primas Wyszyński. Die Auseinandersetzungen um soziale Reformen und politische Freiheit in Polen, die zunächst zur Gründung der freien Gewerkschaft „Solidarität“ führten, weiteten sich binnen kurzem zu einer Protestbewegung großer Teile des polnischen Volkes aus, der die Regierung am 13. Dezember 1981 nur noch durch die Ausrufung des Kriegsrechts Herr zu werden glaubte.
Die persönliche Bedrohung vieler politisch engagierter polnischer Katholiken, zu denen oft jahrelang gewachsene Verbindungen bestanden, und die katastrophale Versorgungskrise führten bei den deutschen Katholiken zu einer in diesem Ausmaß einmaligen Solidaritätswelle und intensiven Gebets- und Solidargemeinschaft. Hans Maier beschwor Bundesregierung, Bundestag und politische Parteien, Polen in seinem Kampf um Freiheit und Selbstbestimmung jetzt nicht allein zu lassen und forderte doppelte Solidarität ein, die Solidarität des Gebetes und der helfenden Tat und die Solidarität der entschiedenen politischen Stellungnahme. Bernhard Vogel hatte sich 1976 als Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken mit dem Versprechen verabschiedet, mit Nachdruck alle Forderungen nach größerer Freiheit der Kirchen in den Ländern unter kommunistischer Herrschaft zu unterstützen und die Solidarität mit allen bekräftigt, die sich für die Menschenrechte in diesen Ländern einsetzen. Diese Unterstützungsversprechen aller Katholiken wurden nach der Ausrufung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 eingefordert, als die gesellschaftlichen Veränderungen in Polen von einer drastischen Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage begleitet wurden. Der Aufruf der deutschen Bischöfe vom 13. Januar 1982 zu einer Sonderkollekte löste eine beispiellose Welle der Hilfsbereitschaft aus. „Hunderte Millionen Mark werden gespendet, unzählige Hilfen versuchen auf mannigfachen Wegen die Not der Kleinkinder und der alten Menschen zu lindern. Durch Pakete und Briefwechsel entstehen zehntausende von persönlichen Verbindungen.“80
Die vorrangigen innenpolitischen Probleme und die Behinderung der katholischen Laienorganisationen in Polen durch die Auswirkungen des Kriegsrechts beeinflussten die deutsch-polnischen Beziehungen dann aber doch auch negativ. „Einem friedlichen Verhältnis“, so Reinhold Lehmann, „steht immer noch die Ungleichheit der Beziehungen entgegen. Die Deutschen sind materiell die Gebenden, die Polen die Nehmenden.“81
Die außergewöhnliche Hilfs- und Opferbereitschaft der gesamten deutschen Bevölkerung zugunsten der polnischen Bevölkerung zeigte an, dass die Versöhnung der Polen und der Deutschen gesellschaftlich inzwischen eine gewisse Reichweite erlangt hatte, wenn aktuelle Not zu lindern war.
Die erste deutsche Demonstration gegen das Kriegsrecht fand als Schweigemarsch am 22. Dezember 1981 in Köln statt. Die Deutsche Bischofskonferenz, das Zentralkomitee, Pax Christi und zahlreiche Verbände kooperierten damals auf Initiative des BDKJ und forderten die Freilassung aller Verhafteten.