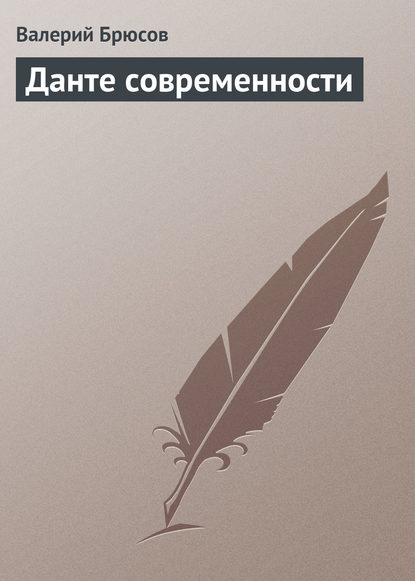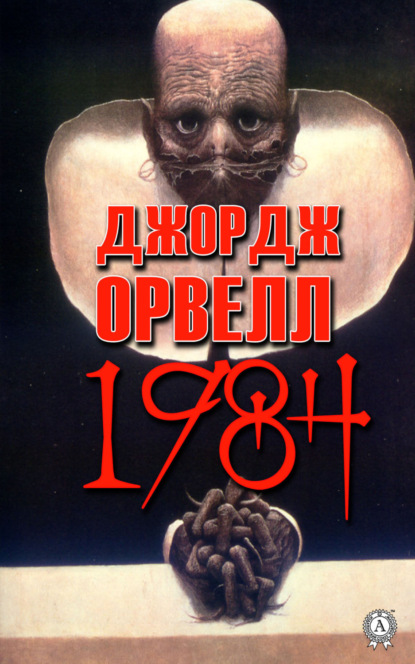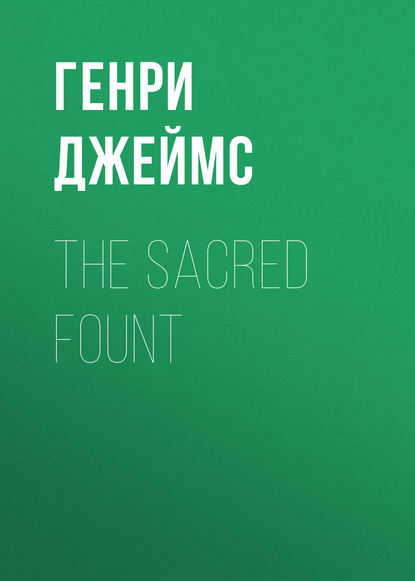- -
- 100%
- +
„Seht auf Polen, auf den Kampf dieses tapferen Volkes! Lasst es nicht allein! […] Einer wachsenden Zahl von Deutschen wurde klar, dass in Polen auch ihre Sache – die Sache der Freiheit, der Menschenrechte – verhandelt wurde.“82
Und was ebenso wichtig war: Seit den Tagen der Gründung freier Gewerkschaften und der Streiks auf der Danziger Werft „erlebten die Deutschen die Polen nicht mehr nur als Fordernde, sie erlebten sie als Menschen, die in das künftige Europa eine lebenswichtige Mitgift einzubringen hatten.“83
„Der entscheidende Umbruch im Verhältnis zwischen Ost und West und damit zwischen unseren beiden Völkern ging von der moralisch und nicht selten auch religiös begründeten Solidaritätsbewegung in Polen aus. Er führte in der Konsequenz zum Zusammenbruch des totalitären Systems und zum Fall der Mauer, die Deutschland und Europa 40 Jahre lang getrennt hat.“84
Die Gespräche der deutschen und polnischen Katholiken gerieten in den 1980er Jahren dennoch ins Stocken, in eine „Phase der Bewährung“, wie es der Sekretär der Deutschen Bischofkonferenz und spätere Bischof von Hildesheim, Josef Homeyer, ausdrückte. Verständlicherweise konzentrierten sich die polnischen Katholiken in ihrem Überlebenskampf zunächst einmal verstärkt auf sich selbst. Der Kontakt der deutschen Bischöfe zu dem neuen Primas Glemp musste sich erst entwickeln. In der Grenzfrage, die zu einer Art Lackmustest der Verständigung geworden war, gab es keine Fortschritte. Die deutschen Bischöfe sahen sich nicht legitimiert, einen förmlichen Verzicht auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete zu erklären. Die polnischen Bischöfe waren sehr zurückhaltend, das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen in Bezug auf die deutsche Einheit zu unterstützen. Die bilateralen Beziehungen erwiesen sich in diesen Jahren aber als belastbar. Man unterstützte sich, wo man sich unterstützen konnte, und musste an den wunden Punkten den eigenen Standpunkt nicht verschweigen.
Noch im Oktober 1985 war ein Versuch der Bischöfe gescheitert, eine gemeinsame Erklärung zur Grenzfrage zu verabschieden. Die Verlegenheit auf beiden Seiten, zwanzig Jahre nach dem Briefwechsel eine angemessene Form der Erinnerung zu finden, war kein gutes Omen für die Qualität der damaligen Beziehungen.
Die Bischöfe, die sich zu einer außerordentlichen Synode in Rom aufhielten, trafen sich aber anlässlich des 20. Jahrestags des Austauschs der Vergebungsbotschaften im Dezember 1985 in der Titelkirche von Primas Glemp Santa Maria in Trastevere. Kardinal Höffner erinnerte dabei an seinen Vorgänger Kardinal Döpfner (1970):
„Die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland wünscht entschieden, dass alle, die in jenen Gebieten östlich der Oder und Neiße wohnen, dort in Frieden und Sicherheit leben können und dass niemand jetzt und in Zukunft ihnen einen Zwang auferlegt.“85
Höffner stellte aber auch noch einmal klar:
„Weil das Verständnis für dieses Grundbedürfnis des polnischen Volkes bei uns allgemein verbreitet ist, hoffen wir auch, dass die polnischen Mitbrüder uns verstehen, wenn wir eine solche Erklärung nicht vermischen wollen und können mit einer Stellungnahme zur Frage einer noch ausstehenden abschließenden Friedensordnung für unser Land als Ganzes und für den ganzen gespaltenen europäischen Kontinent. Eine solche herbeizuführen oder für überflüssig zu erklären, steht nicht in der Macht der Kirche.“86
10. Maximilian Kolbe und Edith Stein
In dieser Phase sind die beiden Selig- und Heiligsprechungsprozesse für Edith Stein (1891-1942) und Maximilian Kolbe (1894-1942) Beispiele einer gelungenen Kooperation deutscher und polnischer Katholiken. Am 10. Oktober 1982 reiste Kardinal Höffner mit neun weiteren Bischöfen zur Heiligsprechung Maximilian Kolbes nach Rom und predigte bei einem gemeinsamen Dankgottesdienst im Petersdom. Die Seligsprechungen von Edith Stein und des Jesuitenpaters Rupert Mayer waren der Anlass für den zweiten Papstbesuch von Johannes Paul II. in der Bundesrepublik Deutschland vom 30. April bis 4. Mai 1987. Im Rahmen dieser Pastoralreise wurde dadurch eine Art Zwischenbilanz zum Thema „Katholischer Kirche und Nationalsozialismus“ gezogen. Bei der Begrüßung des Hl. Vaters vor der Seligsprechung der Karmelitin Edith Stein am 1. Mai 1987 erwähnte Kardinal Höffner aus gutem Grund den polnischen Franziskanerpater Maximilian Kolbe87, der 1971 selig- und 1982 von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen worden war.
„Wie der Märtyrer von Auschwitz, Maximilian Kolbe, Fürsprecher bei Gott ist für die Versöhnung von Polen und Deutschen, so möge die Märtyrerin von Auschwitz, Edith Stein, Fürsprecherin sein für die Versöhnung zwischen Juden und Deutschen.“88
Die Selig- und Heiligsprechung des Franziskanerpaters Kolbe war der erfolgreiche Abschluss jahrzehntelanger deutsch-polnischer Bemühungen. Bereits im Frühjahr 1960 hatte Franz Wosnitza (1902-1979), ehemaliger Generalvikar von Kattowitz, einen Gesprächskontakt zu dem ehemaligen Mitarbeiter im Kattowitzer Ordinariat, Bolesław Kominek (1903-1974), geknüpft, um mit ihm über P. Kolbe und Edith Stein zu sprechen. „Meinen Vorschlag, gegenseitig die Heiligsprechung der KZ-Martyrer Pater Kolbe und Edith Stein zu fördern, nahm er [i.e. Kominek] sehr bereitwillig auf.“89 In einem Vortrag über „die geschichtliche Belastung der deutsch-polnischen Beziehungen“ am 28. Juli 1960 berücksichtigte Kominek P. Kolbe und Edith Stein bereits öffentlich gemeinsam:
„Als ich heuer in Rom, in Paris und Wien mit deutschen Menschen sprach, die eines guten Willens waren, wurde unter anderem auch ein Vorschlag zur Rede gebracht, dem ich innerlich nur beipflichten kann: die Deutschen machen mit uns Propaganda für die Seligsprechung unseres P. Maximilian Kolbe, einem der zahlreichen Opfer aus dem KZ Auschwitz, und wir in Polen werden eine der schönsten deutschen Menschengestalten zu verstehen suchen – Schwester Edith Stein, Karmelitin, deutscher und jüdischer Abstammung, ebenfalls ein Opfer des KZ Auschwitz, aber geboren in Lublinitz auf polnischem Boden, groß geworden in Breslau – im heutigen Wrocław – Märtyrerin wieder auf polnischem Boden, in Auschwitz.“90
Im gleichen Jahr predigte der Berliner Bischof Döpfner auf dem Eucharistischen Weltkongress in München 1960 über den Glaubenszeugen P. Kolbe.
Am 24. August 1963 informierte der Würzburger Franziskanerpater Franz Xaver Lesch – im Auftrag seines Generalministers und nach Rücksprache mit Kominek – seinen Ortsbischof Dr. Josef Stangl: Mit Rücksicht auf den Kardinal Wyszyński vorbehaltenen „besonderen Spielraum“ sei noch keine konkrete Vereinbarung getroffen worden; der Orden plane aber arbeitsteilig eine breit angelegte Medienkampagne. Die Bischöfe sollten die Möglichkeit prüfen, Kolbe zur „Gestalt der Versöhnung“ zu proklamieren. So könnte für die zweite Konzilsperiode eine Begegnung der deutschen und polnischen Bischöfe in Rom entsprechend vorbereitet werden. Bereits am 19. November 1963 übersandte Kardinal Döpfner in Rom einen polnischen Entwurf für diese gemeinsame Erklärung in lateinischer Sprache an die Weihbischöfe Joseph Ferche und Friedrich Rintelen mit der Bitte um Korrektur. Das endgültige gemeinsame Bittgesuch91 trug schließlich das Datum vom 21. November 1963, dem Fest Mariä Opferung. In ihrer gemeinsamen Erklärung aus der Konzilsaula hofften die Bischöfe beider Länder,
„dass durch sein Vorbild und seine Fürbitte der Gott des Friedens beiden Völkern die Gnade einer Versöhnung aus innerstem Herzen gewähre.“92 „Die polnischen und deutschen Kardinäle und Bischöfe sind voll Bewunderung für diesen Diener Gottes Maximilian Kolbe und sein Verdienst, und sie flehen durch die Fürsprache der unbefleckt empfangenen Jungfrau Maria in Demut zu Gott, dass zur größeren Ehre der Kirche und zum Segen der ganzen Menschheit Eintracht und Liebe, Brüderlichkeit und Friede unter den Völkern herrschen mögen“, „nicht achtend gegenwärtige Streitigkeiten, Kriege und Rivalitäten, die die beiden Nationen so lange entzweit haben.“93
In dieses Jahr 1963 fallen auch die Pilgerfahrt nach Auschwitz, die am Beginn des Maximilian-Kolbe-Werks94 steht, und die ersten Arbeitseinsätze in ehemaligen Konzentrationslagern. Am 30. Januar 1969 verkündete Papst Paul VI. den „heroischen Tugendgrad“ für P. Kolbe und sprach ihn am 17. Oktober 1971 selig. Kardinal Wojtyła äußerte sich damals in Radio Vatikan zu der Frage: „Warum wird Pater Maximilian Kolbe seliggesprochen?“95 1978 wählte Kardinal Wojtyła für seine Predigt im Dom von München das Thema: „Unser gemeinsamer Weg“:
„Wenn die Kirche einmal die Schwester Benedikta vom Kreuze auf die Altäre erheben wird, worum der deutsche Episkopat, von polnischen Bischöfen unterstützt, sich bemüht, so werden sie beide: Maximilian Kolbe und Edith Stein, uns allen, Polen und Deutschen, zurufen, von demselben Ort des Märtyrertodes, den sie erlitten haben, ohne von einander zu wissen: ‚Wollet doch des Evangeliums Christi würdig leben!‘ Die bewegende Kraft dieses Rufes wird dann noch viel mächtiger sein.“96
Bei seinem ersten Papstbesuch überreichte Johannes Paul II. dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz eine Reliquie von P. Kolbe als Geschenk der Weltkirche an die deutschen Katholiken. Kardinal Höffner betete bei seiner ersten Polenreise 1977 in der Todeszelle des Seligen Maximilian Kolbe, „dessen baldige Heiligsprechung als Märtyrer wir erhoffen“97, bei seinem Besuch in Polen im Juni 1982 unterzeichnete er mit dem polnischen Vorsitzenden ein gemeinsames Gesuch, Maximilian Kolbe als Märtyrer heilig zu sprechen. „Wir wollen uns gemeinsam für die Erneuerung Europas im Geist Jesu Christi des Gekreuzigten einsetzen. Möge Europa mithelfen, die Botschaft der Liebe und der Gerechtigkeit in der Welt zu verwirklichen.“98 Höffner stand auch an der Spitze der deutschen Delegation, die am 10. Oktober 1982 zur Heiligsprechung Maximilian Kolbes nach Rom fuhr.
Die Kölner Karmelitin Edith Stein, geboren in Breslau und ermordet in Auschwitz, steht im Übrigen nicht nur unter den Anforderungen ihrer jüdischen und katholischen Identität, sondern auch mitten in den Verwicklungen der deutsch-polnischen Geschichte. Ihr Lebensweg hat an verschiedenen Stationen eine erstaunliche Nähe zu dem des polnischen Papstes, der sie selig- und heiliggesprochen hat. Beide haben ein wissenschaftliches Buch über den heiligen Johannes vom Kreuz veröffentlicht, beide haben sich mit der Philosophie Max Schelers beschäftigt. Das Konzentrationslager Auschwitz, in dem Edith Stein und ihre Schwester Rosa ermordet wurden, liegt im Erzbistum Krakau. 1995 konnten die polnischen und deutschen Bischöfe in einem gemeinsamen Wort „Das Geschenk der Versöhnung weitergeben“ fast selbstverständlich Maximilian Kolbe und Edith Stein als „mutige Zeugen des christlichen Glaubens in unserem Jahrhundert“ in einem Satz nennen.
11. Gefahren des Rückschritts
Mit der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Grenzvertrags am 14. November 1990 unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung endete die deutsch-polnische Nachkriegszeit, der Nachbarschaftsvertrag vom 17. Juni 1991 sollte die Gründungsakte einer politischen Zukunftsallianz werden. Vor dem Beitritt Polens zur Nato und EU entstand aber erneut eine Situation des Ungleichgewichts, der eine sollte helfen, dem anderen musste geholfen werden. Am Ende der 1990er Jahre ging nach dem allmählichen Abtreten der Erlebnisgenerationen in beiden Ländern manches bereits Erreichte teilweise wieder verloren. Es war deshalb an der Zeit, noch nicht beantwortete alte Fragen neu zu stellen, sich wieder verstärkt für einander zu interessieren. Welches waren die sog. „heißen Eisen“, die unbewältigten Probleme der gemeinsamen Geschichte, Gegenwart und Zukunft, wo fühlten die Polen sich von den Deutschen missverstanden, wo war es umgekehrt? Wo sind die nachwachsenden „Menschen der Versöhnung“, die eine so wichtige Rolle gespielt haben? Der vorübergehende Optimismus bezüglich der Stabilität der Verständigung betraf in den 1980er und 1990er Jahren offenbar primär die aktuelle Situation, er galt noch nicht im Blick auf die Vergangenheit. Die gemeinsame Erklärung von katholischen Laien beider Länder zum 50. Jahrestag des Kriegsbeginns – 1. September 1989 – hatte dann wieder Hoffnung aufkommen lassen, dass die beiden schwierigsten Problemkreise der Vergangenheit – die Frage der Dauerhaftigkeit der polnischen Westgrenze und die Kennzeichnung der Vertreibung als Unrecht – inzwischen vielleicht doch nicht mehr völlig ausgespart werden mussten. In der Erklärung heißt es: „Deshalb treten wir dafür ein, dass die Westgrenze Polens dauerhaften Bestand hat.“99 Und: „Gemeinsam erinnern wir daran, dass die Feindschaft zurückschlug, als die Waffen schwiegen. Jetzt wurden Menschen oft verfolgt, nur weil sie Deutsche waren.“100 Nur wenige Monate später tauchten diese Positionen in einer Erklärung der Bischöfe nach einem Treffen in Gnesen (20.-22. November 1990) aber nur noch in der sehr abgeschwächten Formulierung wieder auf, man wolle Überlegungen anstellen, ob „nicht eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Fachleuten die völkerrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Vertreibung, über die noch unterschiedliche Meinungen bestehen, aufarbeiten könnte.“101 In der zweiten gemeinsamen Erklärung richteten die Bischöfe 2005 den Blick dann wieder nach vorne und formulierten die beiderseitige Entschlossenheit, „im engen Miteinander entschiedener das künftige Europa mit zu gestalten“102.
„Mit diesem Einsatz für die Gestaltung Europas wollen wir auch zum Aufbau einer friedlichen Welt beitragen. Dazu gehört auch, dass Europa sich glaubwürdig um ein zukunftsfähiges Verhältnis zu den Ländern des Südens und Ostens einsetzt.“103
Die Bischöfe sahen aber auch mit Sorge, dass die Erinnerung an die finsteren Stunden der Vergangenheit nicht nur den Geist der Versöhnung gebiert, sondern auch alte Wunden wieder aufreißt. „Dem Ungeist des Aufrechnens, der die Menschen gegeneinander aufbringt, erteilen wir eine eindeutige Absage.“104 Kardinal Lehmann erinnerte immer wieder neu daran, dass wir nicht nur hören, welches Erbe wir übernehmen, sondern auch, welche Formen es heute für die Fortführung gibt:
„Wir müssen uns noch mehr als bisher im neuen Europa miteinander für ein gemeinsames europäisches Haus in einem vom christlichen Glauben inspirierten Geist einsetzen, ja dafür kämpfen.“105
1 K. Lehmann, Unrecht der Geschichte – Perspektiven der Versöhnung. Rede beim Tageskongress „Gegen Unrecht und Gewalt – Erfahrungen und Perspektiven kirchlicher Versöhnungsarbeit“ am 30.1.2001 in Mainz, in: Kl. Barwig/D. R. Bauer/K.-J. Hummel (Hgg.), Zwangsarbeit in der Kirche. Entschädigung, Versöhnung und historische Aufarbeitung, Stuttgart 2001, 67-77, hier 70.
2 H. Lübbe, Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewusstsein, in: Historische Zeitschrift Bd. 236, 1983, 579-599.
3 Nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichneten sich fast 90 % der Franzosen als katholisch. Siehe M. Albert, Die Katholische Kirche in Frankreich in der vierten und fünften Republik, Rom u. a. 1999, 24; ders., Frankreich, in: E. Gatz (Hg.), Kirche und Katholizismus seit 1945, Bd. 1: Mittel-, West- und Nordeuropa, Paderborn u. a. 1998, 163-222, hier 164.
4 Ende 1946 waren rund 95 % der polnischen Bevölkerung katholisch. Siehe J. Kopiec, Polen, in: E. Gatz (Hg.), Kirche und Katholizismus seit 1945, Bd. 2: Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa, Paderborn u. a. 1999, 95-131, hier 102.
5 Zitiert nach K. v. Beyme (Hg.), Die großen Regierungserklärungen der deutschen Bundeskanzler von Adenauer bis Schmidt, München 1979, 43-73, hier 71.
6 Ebd., 69.
7 Das Manuskript dieses Beitrags geht auf den öffentlichen Abendvortrag des Verfassers im Rahmen der Erfurter Tagung „50 Jahre polnisch-deutscher Briefwechsel. Aussöhnung im Konflikt“ 30.-31. Oktober 2015 zurück und wurde für den Druck lediglich mit den notwendigen Nachweisen ergänzt.
8 Abgedruckt in: Publik 48, 27.11.1970, 23.
9 W. Brandt, Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960-1975, Hamburg 1976, 240f.
10 Manfred Plate in einer Besprechung der Erinnerungen von Bartoszewski, in: Christ in der Gegenwart 28 (10.7.2005).
11 T. Mechtenberg, Deutschland - Polen: Die Öffentlichkeitswirksamkeit der EKD-Denkschrift im Vergleich zum Briefwechsel der katholischen Bischöfe 1965, in: Ost-West-Informationsdienst Nr. 189 (1996), 41-50, hier 41.
12 B. Kerski, Die Rolle nichtstaatlicher Akteure in den deutsch-polnischen Beziehungen vor 1990, in: W.-D. Eberwein/B. Kerski (Hgg.), Die deutsch-polnischen Beziehungen 1949-2000. Eine Werte- und Interessengemeinschaft, Opladen 2001, 75-111, hier 108. Kerski nennt in diesem Zusammenhang das „Kooperationsnetz zwischen Eliten, über das Informationen und Meinungen ausgetauscht oder persönliche Kontakte geknüpft werden konnten“ und das auch bei sich verändernden außenpolitischen Prioritäten wirksam blieb, weil es Personengruppen mit ähnlichen Zielsetzungen verband, die sie gemeinsam in ihren Gesellschaften durchzusetzen versuchten.
13 Nachdem er zuerst an den Brief der polnischen Bischöfe und „den berühmten Satz über die Vergebung“ erinnert und „den bewegenden Kniefall Willy Brandts zu Füßen des Ghetto-Denkmals in Warschau“ hervorgehoben hatte, zählte Mazowiecki namentlich folgende Persönlichkeiten auf: Anna Morawska, Mieczysław Pszon, Jan Józef Lipski, Stanisław Stomma, Władysław Bartoszewski, Karl Dedecius, Marion Dönhoff, Lothar Kreyssig, Günter Särchen, Reinhold Lehmann.
14 Rede von Mazowiecki zum 50. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 vor dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, in: Berichte und Dokumente Nr. 67, 1995, 11.
15 Vgl. W. Bartoszewski, Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Die Erfahrung meines Lebens, Freiburg 1986; ders., Kein Frieden ohne Freiheit. Betrachtungen eines Zeitzeugen am Ende des Jahrhunderts, Baden-Baden 2000; ders., Die deutsch-polnischen Beziehungen: gestern, heute und morgen, Konstanz 2002; ders., „Und reiß uns den Hass aus der Seele“. Die schwierige Aussöhnung von Polen und Deutschen, Warschau 2005; sowie die Laudatio von Hans Maier und die Danksagung Bartoszewskis anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Jahr 1986: Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Hg.), Władysław Bartoszewski. Ansprachen anlässlich der Verleihung, Frankfurt/Main 1986.
16 Bernhard Vogel am 27. September 2003 in der Katholischen Akademie Berlin anlässlich der Feier zum 30jährigen Bestehen des Maximilian-Kolbe-Werks.
17 A. Stempin, Das Maximilian-Kolbe-Werk. Wegbereiter der deutsch-polnischen Aussöhnung 1960-1989, Paderborn 2006, 92-99, hier 97.
18 Zentralarchiv des Bischöflichen Ordinariats Magdeburg (ZBOM), GS II., Wojtyła an Günter Särchen, 14.12.1964.
19 H. Stehle, Der Briefwechsel der Kardinäle Wyszyński und Döpfner im deutsch-polnischen Dialog von 1970-1971 in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 31 (1983), 536-553, hier 537.
20 Wort aus Berlin. Rundfunkansprachen und Predigten des Bischofs von Berlin, Julius Kardinal Döpfner, Bd. 2, Berlin 1961, 98-114.
21 Vgl. KNA, Aktueller Dienst Vatikan Nr. 277, 29.11.1990.
22 Hinführung und Begrüßung durch Karl Kardinal Lehmann bei der Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung am 21. September 2005 in Fulda, in: Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz, 21.9.2005, 1.
23 KNA, Dokumentation Nr. 25, 9.9.1965, 1.
24 Ebd., 4.
25 Ebd.
26 Zitiert nach O. B. Roegele, Versöhnung oder Haß? Der Briefwechsel der Bischöfe Polens und Deutschlands und seine Folgen. Eine Dokumentation, Osnabrück 1966, 104-118, hier 117.
27 Erzbischöfliches Archiv München / Kardinal-Döpfner-Archiv (EAM KDA) 43/1965, 10.
28 Ebd.
29 Vgl. den Bericht an das Auswärtige Amt vom 30.10.1965, in: M. F. Feldkamp (Hg.), Die Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland zum Heiligen Stuhl 1949-1966. Aus den Vatikanakten des Auswärtigen Amts. Eine Dokumentation, Köln 2000, 486f.
30 KNA, Aktueller Dienst Inland, Nr. 195, 4.9.1965.
31 Ebd.
32 Die ZEIT, 29.10.1965.
33 Botschaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Brüder in Christi Hirtenamt vom 18. November 1965, in: Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz, Bd. 1: 1965-1968, Köln 1998, 1-24, hier 18. Der Brief ist auch abgedruckt bei O. B. Roegele, Versöhnung oder Haß? (wie Anm. 26); siehe auch P. Madajczyk, Annäherung durch Vergebung. Die Botschaft der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Brüder im Hirtenamt vom 18. November 1965, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 40 (1992), 223-240; T. Mechtenberg, Briefwechsel polnischer und deutscher Bischöfe 1965. Die Reaktion der Machthaber in der DDR, in: Deutschland Archiv 28 (1995), 1146-1152.
34 EAM, KDA 43/1965, Briefwechsel Kominek/Döpfner, 10./18.10.1965.
35 EAM, KDA 43/1965, Schreiben vom 27.11.1965.
36 S. Gawlitta, „Aus dem Geist des Konzils! Aus der Sorge der Nachbarn!“. Der Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe von 1965 und seine Kontexte, Marburg 2016, 159.
37 Ebd., 163.
38 Gruß und Antwort der deutschen Bischöfe an ihre polnischen Brüder im Hirtenamt, 5.12.1965. Zitiert nach: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Dokumente der Deutschen Bischofskonferenz Bd. 1: 1965-1968, Köln (1998), 25-34, hier 26f.
39 Zitiert nach W. Grycz, Geheime Dokumente geben Aufschluss: Die Versöhnungsbotschaft der polnischen Bischöfe – und die Quittung des Staates, in: Ost-West-Informationsdienst des Katholischen Arbeitskreises für zeitgeschichtliche Fragen 187 (1995), 58-72, hier 65.
40 G. Weigel, Zeuge der Hoffnung. Johannes Paul II., Paderborn 2002, 187f.
41 Ebd., 188.
42 Schröder an Sattler, 21.3.1966, in: M. F. Feldkamp (Hg.), Die Beziehungen (wie Anm. 29), Dok. 215, 506-509, hier 506f.
43 M. Seidler, Das Polen - Memorandum des Bensberger Kreises - Wirkung in Deutschland und in Polen, in: F. Pflüger / W. Lipscher (Hgg.), Feinde werden Freunde. Von den Schwierigkeiten der deutsch-polnischen Nachbarschaft, Bonn 1993, 103-112, hier 104f.
44 Bensberger Kreis (Hg.), Ein Memorandum deutscher Katholiken zu den polnisch-deutschen Fragen, Mainz 1968, 18.
45 Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Vertriebenenorganisation, in: KNA, Dokumentation Nr. 7, 2.3.1968.
46 Joseph Ratzinger an Manfred Seidler, 1.3.1968, in: Bestand Bensberger Kreis, Archiv der Sozialen Demokratie, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
47 Der Brief des Primas vom 12.9.1968 wurde veröffentlicht in: KNA, Dokumentation 2.10.1968.
48 Zitiert nach W. Pailer, Stanisław Stomma, Nestor der polnisch-deutschen Aussöhnung, Bonn 1995, 110.
49 Notiz des Berliner Generalvikars Walter Adolph nach einem Gespräch mit dem deutschen Botschafter Dieter Sattler am 24.10.1966, in: M. Höllen, Loyale Distanz? Katholizismus und Kirchenpolitik in SBZ und DDR. Ein historischer Überblick in Dokumenten, Bd. 3/1, Berlin 1998, Dok. 592, 33. Vgl. auch 63f.
50 Ebd.
51 DAB V/5-7-1, Promemoria im Anschluss an die Unterredung von Bengsch im Vatikanischen Staatssekretariat am 28.2.1967, 3.
52 DAB V/5-7-1, Bengsch an Bafile, 18.4.1967.
53 Der Vertrag wurde am 7.2.1970 unterzeichnet und am 3.6.1972 ratifiziert. Über die Neuordnung der kirchlichen Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Grenze entschied der Heilige Stuhl am 28.6.1972.
54 Vgl. dazu R. Morsey, Die Haltung der Bundesregierung zur vatikanischen Kirchenpolitik in den früheren Ostgebieten des Deutschen Reiches 1958-1978, in: K.-J. Hummel (Hg.), Vatikanische Ostpolitik unter Johannes XXIII. und Paul VI. 1958-1978, Paderborn 1999, 75.
55 Die vatikanische Verlautbarung zur Neuordnung der Gebiete östlich von Oder und Neiße vom 28.6.1972 hat sich folgerichtig ausdrücklich auf den deutsch-polnischen Vertrag bezogen.
56 Die Dokumentation „Die kirchenrechtliche Neuordnung in den Oder-Neiße-Gebieten“ (Europa-Archiv, Folge 16, 1972, D 384-386) enthält die Verlautbarung des Vatikans vom 28.6.1972, die Erklärung des Leiters des vatikanischen Pressesaales Federico Alessandrini vom 28.6.1972, die Stellungnahme des Auswärtigen Amtes vom 28.6.1972 und die Erklärung von Kardinal Döpfner namens der Deutschen Bischofskonferenz vom 29.6.1972. Vgl. dazu auch das Interview von Kardinal Bolesław Kominek in Tygodnik Powszechny vom 26.8.1973, Nr. 34.