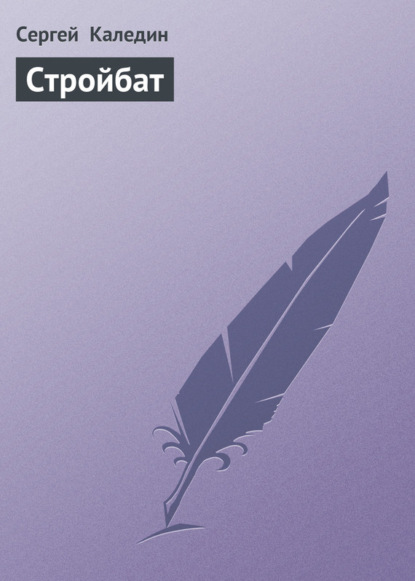- -
- 100%
- +
57 Archiv der Kommission für Zeitgeschichte, Sammlung Osterheld, Corrado Bafile, Apostolische Nuntiatur in Deutschland, Bonn-Bad Godesberg 31.7.1972, 7 Seiten.
58 Ebd., 2.
59 Ebd., 5.
60 Siehe die Meldung in KNA, Das Portrait Nr. 28-31, 24.7.1973.
61 DAB V/5-7-2, Bengsch an die Regierung der DDR, 23.7.1973.
62 Kardinal Döpfner erklärte am 21. Mai 1976 vor der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken: „Was auch immer kommen mag – wir gehören zusammen und wir bleiben zusammen. […] Wir bleiben als deutsche Katholiken, bleiben als Schwestern und Brüder zusammen.“ In: Kirchenzeitung des Erzbistums Köln, Nr. 45, 5.11.1976, 10. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz verabschiedete am 21. Juni 1976 in Würzburg ein von allen Bischöfen unterschriebenes Positionspapier, adressiert an Kardinalstaatssekretär Jean Villot. Am 13. Juli 1976 antworteten Erzbischof Casaroli und Kardinal Villot in zwei ungewöhnlich ausführlichen Schreiben, die die Aufregung aber eher noch steigerten, statt zu beruhigen, in: Sammlung Osterheld, Archiv Kommission für Zeitgeschichte Bonn.
63 Presseerklärung der Deutschen Bischofskonferenz vom 26.10.1976, Druck: M. Höllen, Loyale Distanz? (wie Anm. 49), 395f. Intern stellte Osterheld sich rasch auf die neue Lage ein. Auf seinem Entwurf für die Erklärung der CDU, in der Helmut Kohl die vatikanische Entscheidung bedauerte, notierte Osterheld handschriftlich: „Ich hatte dann selbst dafür plädiert, nachdem es gelungen war, das über die Bundestagswahl hinauszubringen, dann zwar Protest f. d. Geschichte – aber kein allzu großes Hochspielen.“ Undatierter Vermerk (vor dem 26. Oktober 1976), in: Sammlung Osterheld, Archiv Kommission für Zeitgeschichte Bonn.
64 K. Wojtyła, Unser gemeinsamer Weg, Predigt im Dom von München, 24. September 1978, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Begegnung der Konferenz des Polnischen Episkopats mit der Deutschen Bischofskonferenz in Deutschland in September 1978. Dokumentation der Predigten und Ansprachen (Stimmen der Weltkirche 4), Bonn 1978, 50.
65 Stefan Kardinal Wyszyński in der Presseerklärung vom 25. September 1978, in: Begegnung der Konferenz (wie Anm. 64), 63.
66 Kardinal Höffner in der Abschlusserklärung vom 25. September 1978, in: Begegnung der Konferenz (wie Anm. 64), 61.
67 K. Wojtyła, Ein neues Antlitz Europas, Ansprache am 22. September 1978 in Köln, in: Begegnung der Konferenz (wie Anm. 64), 30f.
68 H.-D. Genscher, Erinnerungen, Berlin 1995, 289.
69 Vgl. dazu H. Schmidt, Weggefährten. Erinnerungen und Reflexionen, Berlin 1996, 375-382; H. Soell, Helmut Schmidt 1969 bis heute. Macht und Verantwortung, München 2008, 816-818; H. Schmidt / F. Stern, Unser Jahrhundert. Ein Gespräch, München 2010, 257-259.
70 H. Schmidt, Weggefährten (wie Anm. 69), 378-381.
71 H. Schmidt, Weggefährten (wie Anm. 69), 380; vgl. auch H. Schmidt, Die Deutschen und ihre Nachbarn. Menschen und Mächte II, Berlin 1990, 467ff.
72 „Das Reich besteht weiter“, in: Der Spiegel 51, 17.12. 1979, 35-37.
73 Als Empfehlung zitiert in: „Das Reich besteht weiter“, in: Der Spiegel 51, 17.12. 1979, 35.
74 Papst Johannes Paul II., Predigt zum Thema Ehe und Familie auf dem Butzweiler Hof in Köln am 15. November 1980, in: Papst Johannes Paul II. in Deutschland (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 25), Bonn 1980, 16-22, hier 21.
75 Papst Johannes Paul II., Grußwort auf dem Flughafen Köln-Bonn am 15. November 1980, in: Papst Johannes Paul II. in Deutschland (wie Anm. 74), 12-15, hier 13.
76 Papst Johannes Paul II., Ansprache beim Empfang des Bundespräsidenten im Schloss Augustusburg, Brühl, am 15. November 1980, in: Papst Johannes Paul II. in Deutschland (wie Anm. 74), 39-44, hier 40f.
77 Papst Johannes Paul II., Abschiedswort auf dem Flughafen München-Riem am 19. November 1980, in: Papst Johannes Paul II. in Deutschland (wie Anm. 74), 200-205, hier 202.
78 Zitiert nach: M. Albus u.a. (Hg.), Ein Freund zu Besuch. Papst Johannes Paul II. in Deutschland. Tagebuch einer Reise, Aschaffenburg 1980, 78. Vgl. auch die etwas abweichende Übersetzung der in polnischer Sprache gehaltenen Ansprache in: Papst Johannes Paul II., Ansprache an Vertreter der Polen in Deutschland auf dem Domplatz in Mainz am 16. November 1980, in: Papst Johannes Paul II. in Deutschland (wie Anm. 74), 70-74, hier 72f.
79 Papst Johannes Paul II., Abschiedswort auf dem Flughafen München-Riem am 19. November 1980, in: Papst Johannes Paul II. in Deutschland (wie Anm. 74), 202.
80 J. Homeyer, Der lange Weg der Versöhnung. Ansprache beim Festakt zum 40. Jahrestag des Briefwechsels von 1965, in: Pressemitteilungen der Deutschen Bischofskonferenz 21.09.2005, 7. Von den 90,52 Millionen DM im Jahr 1982 kamen 80,43% aus Spenden, 18,27 % aus öffentlichen Mitteln und 1,3% aus dem kirchlichen Haushalt.
81 Herder Korrespondenz 1985, 528.
82 H. Maier, Polen und Deutsche im Gespräch. Ein Fazit aus 30 Jahren, in: Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Deutschland und Polen. Kirche im Dienst der Versöhnung, Bonn 1996, 27, 30. Vgl. dazu die KSZE-Konferenz und die Reden bei den Polen-Besuchen von Johannes Paul II.
83 H. Maier, Polen und Deutsche (wie Anm. 82), 30.
84 Das Geschenk der Versöhnung weitergeben. Gemeinsames Wort der polnischen und der deutschen Bischöfe aus Anlass des 30. Jahrestags des Austausches der Versöhnungsbotschaften 1965, Punkt 7, in: Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Deutschland und Polen (wie Anm. 82), 8.
85 J. Höffner, Erneuerung Europas im Geist Christi. Einführung bei der polnisch-deutschen Eucharistiefeier in Santa Maria in Trastevere am 7. Dezember 1985, in: L’Osservatore Romano, Deutsche Ausgabe 13.12.1985, 11.
86 Ebd.
87 Pater Maximilian Maria Kolbe (gebürtig Raimund Kolbe) (1894-1941) wuchs in einer einfachen Arbeiterfamilie auf und trat 1910 in den Orden der Minderen Brüder ein, wo er den Ordensnamen Maximilian Maria annahm. 1918 wurde Maximilian Kolbe in Rom zum Priester geweiht. Pater Kolbe gründete zusammen mit anderen Franziskanern die katholische Organisation Militia Immaculatae, die nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ein eigenes Missionszentrum erbaute: Niepokalanów vor den Toren Warschaus. Im Dezember 1939 wurde Pater Kolbe mit vierzig Ordensbrüdern von der Gestapo verhaftet, aber bald wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Februar 1941 wurde er erneut festgenommen, weil er in Niepokalanów 2.300 Juden und anderen Flüchtlingen Zuflucht gewährte. Er wurde schließlich in das KZ Auschwitz-Birkenau verlegt, wo er weiter als Priester und Seelsorger wirkte. Am 29. Juli 1941 wurden Männer als Vergeltungsmaßnahme für die nur vermutete Flucht eines anderen Häftlings zur Ermordung aussortiert. Als einer der Männer in lautes Wehklagen um sich und seine Familie ausbrach, bat Pater Kolbe den Kommandanten darum, dessen Platz einnehmen zu dürfen, und wurde am 31. Juli 1941 in den berüchtigten „Hungerbunker“ gesperrt. Am 14. August wurden Pater Kolbe und drei andere Verurteilte, die noch nicht verhungert waren, durch Phenolspritzen ermordet.
88 Grußwort von Kardinal Höffner an Papst Johannes Paul II. Homilie bei der Seligsprechung von Edith Stein im Stadion Köln-Müngersdorf am 1. Mai 1987, in: Predigten und Ansprachen von Papst Johannes Paul II. bei seinem zweiten Pastoralbesuch in Deutschland sowie Begrüßungsworte und Reden, die an den Heiligen Vater gerichtet wurden. 30. April bis 4. Mai 1987 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 77), Bonn 1987, 22f., hier 23.
89 EAM KDA 43/1966, 7. Notiz über das Gespräch vom 14./15. April 1960.
90 EAM KDA 43/1966 (Auseinandersetzung mit dem Kommunismus), 11f.
91 Der Text ist abgedruckt bei W. Nigg, Maximilian Kolbe. Der Märtyrer von Auschwitz, Freiburg u.a. 31983, 84f.
92 EAM KDA Konzilsakten 0710-8,1.
93 EAM KDA Konzilsakten 0710-10,1.
94 Vgl. A. Stempin, Das Maximilian-Kolbe-Werk (wie Anm. 17).
95 Die Ansprache vom 5. Oktober 1971 ist abgedruckt in: W. Nigg, Kolbe (wie Anm. 91), 88-90.
96 K. Wojtyła, Unser gemeinsamer Weg. (wie Anm. 64), 51.
97 J. Höffner, Gebet in der Todeszelle Maximilian Kolbes, in: Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Deutschland und Polen (wie Anm. 82), 75.
98 Ebd., 76.
99 Erklärung polnischer und deutscher Katholiken zum 1. September 1989, in: Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Deutschland und Polen (wie Anm. 82), 78.
100 Ebd., 76.
101 Abschlusserklärung des Bischoftreffens in Gnesen (20.-22. November 1990), in: Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Deutschland und Polen (wie Anm. 82), 80.
102 Gemeinsame Erklärung aus Anlass des 40. Jahrestages des Briefwechsels von 1965, Fulda 21.9.2005. (http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2015/2005-09-21_40.Jahrestag-Briefwechsel-Gemeinsame-Erklaerung.pdf)
103 Ebd.
104 Ebd.
105 Ebd.
VON DER LANGLEBIGKEIT EINER LEGENDE
Severin Gawlitta
Große und bedeutsame Ereignisse, die zugleich historische Wendepunkte markieren, scheinen dafür prädestiniert zu sein, dass ihnen Zufälligkeiten und/oder (un)glückliche Fügungen anhaften. Sie äußern sich meist in Anekdoten oder Anekdötchen sowie in bisweilen amüsanten Erlebnissen vom Rande des Geschehens, die der breiten Öffentlichkeit sonst verborgen geblieben wären, wenn nicht die Bedeutungsschwere der historischen Begebenheit sie ausgeleuchtet hätte. Erst im Nachgang bekannt – meist verbal durch Zeitzeugen kolportiert – erhellen sie und komplettieren sie nicht nur die Hintergrundkulissen, sondern heften dem außergewöhnlichen geschichtlichen Faktum eine alltäglichgewöhnliche und nicht selten eine banale zwischenmenschliche Note an, an der das geschichtsträchtige Momentum letztlich (oder gewiss) auch hätte scheitern bzw. ohne diese nicht hätte erfolgreich sein können. Damit ist zugleich angezeigt, dass diese Begleitgeschichten gern aufgebauscht, ausgemalt und durch frei erfundene ‚Abweichungen‘ in ihrer Relevanz überschätzt und überbewertet werden. Sie entwickeln ein Eigenleben und erfreuen sich vor allem populärwissenschaftlicher Beliebtheit; und weil ihre Authentizität kaum hinterfragt wird, entfalten sie eine überaus lange Lebensdauer.
Der Briefwechsel zwischen den polnischen und deutschen Bischöfen von 1965 bildet ein historisches Ereignis, dem ebensolche Anekdoten anhaften. Der Austausch der bischöflichen Versöhnungsbotschaften gehört inzwischen zum festen Bestandteil des historischen Kanons der deutsch-polnischen Beziehungen und gilt als einer der wichtigsten Impulse im Prozess der Verständigung und als entscheidender Anstoß zum Dialog zwischen den beiden Nachbarn. Neben der Ostpolitik Willy Brandts, die für den politischen Aspekt der Annäherung steht, symbolisiert der Briefwechsel der katholischen Bischöfe die Zusammenarbeit gesellschaftlicher, vor allem kirchlicher Kreise, ohne die die schnellen Fortschritte im deutsch-polnischen Verhältnis nach 1989 nicht möglich gewesen wären.1 Die Botschaft des polnischen Episkopats mit ihrer berühmten Formel „wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung“ gilt seither als ein Synonym für die Überwindung von nationalen Antagonismen und dient häufig als Muster, historisch belastete Beziehungen in einen Dialog zu überführen. Bereits die zentralen Protagonisten des Briefwechsels waren sich seiner historischen Tragweite bewusst. Der Initiator und Verfasser des polnischen Versöhnungsbriefes, Breslaus Oberhirte Erzbischof Bolesław Kominek, verstand den bischöflichen Briefwechsel als „eine geschichtliche und zugleich eine christl[iche] u[nd] mutige Tat“, die „die jahrhundertalte Mauer“ zwischen Deutschen und Polen „durchbrochen“ hatte.2 Ebenso sah der Erzbischof von München, Julius Kardinal Döpfner, darin eine gemeinsame geschichtliche Tat, die „sicherlich in der Vorsehung und Gnade Gottes für unsere beiden Völker“ stand.3
Seit dem Austausch der bischöflichen Botschaften behauptet auch manch eine Nebenerzählung, die zum unverrückbaren und festen Bestandteil dieses geschichtsträchtigen Ereignisses zu zählen scheint, beharrlich ihr Dasein. Im Umfeld des Briefwechsels begegnet man beinahe zwangsläufig der Legende vom Missgeschick bei der Zustellung der Versöhnungsbotschaft des polnischen Episkopates. Der Erzählung nach soll der Brief der polnischen Bischöfe erst mit Verzögerung seinen Adressaten erreicht haben, weil er unbemerkt und ungeöffnet mehrere Tage in der römischen Residenz des Kölner Kardinals Joseph Frings liegen geblieben war. Beunruhigt durch das Ausbleiben jeglicher Reaktion auf die überbrachte Botschaft, erkundigte sich der Breslauer Erzbischof Bolesław Kominek, der Hauptinitiator des bischöflichen Briefwechsels, bei Kardinal Julius Döpfner nach der ausstehenden Antwort. Völlig überrascht und desorientiert beteuerte der Münchener Ordinarius, dass er bisher kein polnisches Schreiben empfangen habe. Es stellte sich nämlich heraus – so die Erzählung weiter –, dass der sog. Versöhnungsbrief der Polen dem damaligen (noch) Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz Kardinal Joseph Frings zugestellt worden war. Da Frings jedoch einige Tage zuvor aus gesundheitlichen Gründen Rom verließ und nach Köln zurückgekehrt war, soll das Couvert zunächst auf seinem Schreibtisch in der Villa Anima ungeöffnet dagelegen haben. Als nach mehreren Tagen dies bemerkt wurde, übergab Erzbischof Kominek zwei hastig angefertigte Abschriften des Dokuments an Kardinal Döpfner und an den Berliner Erzbischof Alfred Bengsch. Erst danach konnte der deutsche Episkopat sich mit der Botschaft ihrer polnischen Amtsbrüder vertraut machen und seinerseits eine Antwort, insbesondere auf die darin enthaltene Einladung zu den polnischen Millenniumsfeiern im Mai 1966, formulieren.
Diese populäre Schilderung einer vermeintlichen Begebenheit, die auch Eingang in seriöse Forschungen fand, liegt inzwischen in mehreren Variationen und gelegentlich mit Ausschmückungen vor, wobei lediglich ihr Kern, der unbemerkte Verbleib des Briefes im Büro von Kardinal Frings, konstant bleibt.4 Doch so sehr bemüht und bisweilen amüsant diese Anekdote inzwischen auch sein mag, sie weicht letztlich beträchtlich von den Tatsachen und vom wahren Geschehen ab. Dennoch wird sie seither unkritisch und gern tradiert.
Als einer der ersten berichtete der Journalist Hansjakob Stehle, dass der Brief etwa zwei Wochen lang zwischen München, Köln und Rom zirkulierte, weil währenddessen der Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz von Frings auf Döpfner übergegangen war.5 Im Januar 1966 soll Erzbischof Kominek ihm gegenüber bestätigt haben, dass die an Kardinal Frings adressierte Botschaft fast zu lange unterwegs war, so dass die polnischen Bischöfe schon befürchten mussten, ihr Brief bleibe unbeantwortet.6 Auch deutsche Würdenträger stellten den Ablauf sehr ähnlich dar, so z.B. der Bischof von Essen Franz Hengsbach im Interview mit dem Korrespondenten der Zeit, Werner Höfer, Mitte Dezember 1965: „Völlig korrekt wollten die Polen ihre Briefe [!] dem Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz übermitteln. Das war damals schon de facto der Münchener Kardinal Döpfner, de jure aber noch der Kölner Kardinal Frings. Der war jedoch inzwischen vorübergehend nach Hause gefahren. So wanderte der Brief – immer noch völlig korrekt – zuerst an den Rhein, um auf diesem Umweg nach Rom zurückzugelangen.“7 Damit erklärten die deutschen Bischöfe nicht nur die zeitliche Verzögerung bei der Abfassung ihrer Antwort, sondern suggerierten zugleich, dass sie ihr Schreiben nicht ausreichend vorbereiten konnten, da sie nicht in den Sog des Konzilsendes geraten wollten.8
Die Aussagen der Bischöfe und ihre Publizität trugen wesentlich zur Popularisierung eines scheinbar authentischen Geschehens bei, welches kaum zu hinterfragen sich lohnte. Nur wenige Autoren verweisen kritisch darauf, dass infolge begleitender Konsultationen in der ‚kleinen‘ deutsch-polnischen bischöflichen Kommission, die Anfang Oktober 1965 gebildet worden war, um den Briefwechsel vorzubereiten, die deutsche Seite vorzeitig über den Inhalt des polnischen Briefes hätte genaue Kenntnis haben und wissen müssen, was sie zu erwarten hatte.9 Darüber hinaus gibt Edith Heller zu bedenken, dass bei einem Austausch von offiziellen Dokumenten auf so hoher Ebene die deutsche Antwort zum Zeitpunkt der Übergabe bereits fertig oder zumindest in wesentlichen Zügen ausgearbeitet hätte vorliegen müssen.10
Im Folgenden interessiert, welche Beweggründe die deutschen Bischöfe sowie Erzbischof Kominek gegenüber der Presse veranlassten, die „Story“ vom Malheur bei der Briefübergabe zu exponieren, um anschließend zu hinterfragen, ob sich dahinter womöglich mehr verbarg als nur ein alltägliches technisches Missgeschick.
1. Indiskretionen im Vorfeld der Zustellung des Briefes an die deutschen Bischöfe
Einen interessanten Einblick hinter die konziliaren Kulissen der letzten Novembertage des Jahres 1965 gewähren die täglichen Aufzeichnungen des Meißener Bischofs Otto Spülbeck. Bekanntlich gehörte Spülbeck neben den Bischöfen Franz Hengsbach und Joseph Schröffer zu den deutschen Vertretern der gemeinsamen deutsch-polnischen Kontaktgruppe und war direkt an den vorausgegangenen Besprechungen über den Briefwechsel beteiligt. „Überrascht und entsetzt“ sei er gewesen, notierte Spülbeck in seinem Konzilstagebuch, als er erfuhr, dass der polnische Brief an einige in Rom anwesende Journalisten und so an die Presse gelangte, noch bevor er den deutschen Bischöfen übergeben worden war.11 Sein Entsetzten dürfte weiter gewachsen sein, als bekannt wurde, dass inzwischen mehrere Pressevertreter im Besitz des polnischen Bischofsbriefes an den deutschen Episkopat waren.12 Einen Text erhielt u.a. der Korrespondent der parteinahen Trybuna Ludu in Rom, Ignacy Krasicki.13 Komineks Sekretär, Zdzisław Seremek, übergab Krasicki die Endfassung des Briefes mit der Empfehlung, ihn an den Parteichef Gomułka weiterzuleiten.14 Etwa zeitgleich erhielt auch die Deutsche Presse-Agentur Kenntnis vom Brief der polnischen Bischöfe.15 Bekannt ist auch, dass Erzbischof Kominek bei seinen Überlegungen, auch in schriftlicher Form, Personen seines Vertrauens konsultierte, darunter Alfred Sabisch und den Herausgeber und Publizisten Walter Dirks. Mit beiden besprach Kominek während ihrer gleichzeitigen Aufenthalte in Rom auch Fragen der deutsch-polnischen Beziehungen und gewährte ihnen Einblick in den vorbereiteten Versöhnungsbrief.16 Dirks berichtete Bischof Spülbeck über den polnischen Briefentwurf, was den Meißener Ordinarius offenbar massiv verärgert hatte, was er auch gegenüber Kominek zum Ausdruck brachte:
„Es liegt ein ziemliches Geschwätz vor von Seiten der Polen. Erzbischof Kominek wollte zuerst gar nichts davon wissen, daß er diesen Brief Walter Dirks gegeben habe, mußte aber schließlich zugeben, er hätte nur einen Entwurf ihm gegeben; im übrigen seien nur noch einige Formalitäten zu bereinigen, weil dieser oder jener Bischof nicht da sei, aber wir dürfen fest damit rechnen, daß der Brief komme.“17
Am Abend des 25. November 1965 informierte Spülbeck Kardinal Döpfner über diese Vorgänge. „Aufgeregt“ eilten daraufhin Hengsbach, Döpfner und Spülbeck zum Telefon, um „bei den Polen“ anzurufen.18 Wie aus der anschließenden Korrespondenz zwischen Kominek und Döpfner hervorgeht, warfen die Deutschen Kominek indirekt kalkulierte Indiskretion vor.19 Dies führte zu einer spürbaren Verstimmung, da nicht nur gegen das ungeschriebene Vorrecht des Empfängers zur Veröffentlichung, sondern vor allem gegen die bis dahin gewahrte Vertraulichkeit der Gespräche verstoßen wurde, denn die äußerst verschwiegen durchgeführte Vorbereitung der Botschaft wurde bis dato „wie ein Staatsgeheimnis gehütet“20. Daraufhin verabredeten die deutschen Bischöfe zu dieser Angelegenheit vorerst zu schweigen, solange das offizielle polnische Schreiben ihnen nicht vorlag.21
Mit dem Vorwurf einer bewussten Lancierung der Botschaft an die Presse konfrontiert, versuchte Erzbischof Kominek, diesem Sachverhalt nachzugehen und den Vorgang aufzuklären. Noch am selben Abend setzte er ein klärendes Schreiben an Kardinal Döpfner auf, in dem er den Vorwurf von sich wies und versicherte: „Zur Veröffentlichung wurde er niemandem übergeben, weil es höchst unschicklich wäre, ihn vor Ihnen der Öffentlichkeit zu übergeben. Man kann also, wie Sie heute sagten, nie genug diskret sein auch in diesen Dingen und besonders in diesen.“22 Am Rande des Schreibens fügte er ergänzend hinzu, dass „auch nicht der polnischen oder einer anderen Presse“ die Botschaft zugeleitet worden sei. Für Kominek handelte es sich dabei um ein Missverständnis, dem er „auf die Spur gekommen“ sei und welches erkläre, weshalb die Botschaft des polnischen Episkopats noch nicht bei Kardinal Döpfner angekommen war:
„Als die Botschaften an die Bischofskonferenzen versandt wurden, war[en] weder Kard. Wyszyński noch ich im Hause. Die Boten trugen sie in die römischen Wohnungen der Vorsitzenden der jeweiligen Bischofskonferenz nach Annuario Pontificio. Der Brief, der an Sie, Eminenz, gerichtet werden sollte, wurde bei S. Em. Kard. Frings abgegeben, weil er als Vorsitzender verzeichnet ist. Also ein ganz technischer Fehler, für den ich Sie, Eminenz, tausendmal um Entschuldigung bitte.“23
Besonderes Interesse verdient dabei Komineks anschließende Annahme, die vordergründig aus dem Zusammenhang fällt: „Wir alle waren überzeugt, dass er [der Brief – S.G.] schon seit etlichen Tagen in Ihrem Besitz ist und haben schon über ihn privat gesprochen“.24 Da dies offensichtlich nicht der Fall war und die polnische Seite nicht wissen konnte, wann Kardinal Frings zurückkehren würde, fügte Kominek seinem Schreiben an Döpfner vom 25. November eine „sehr schäbige Kopie“ der polnischen Versöhnungsbotschaft als „Quasioriginal“ bei. Mit dieser „Abschrift“, die auf den 1. November 1965 datiert ist, verband Kominek die Hoffnung, „weiteren Missverständnissen den Weg zu verlegen.“25
Zwischenzeitlich und teilweise parallel zu den oben geschilderten Vorgängen begannen Gerüchte und Mutmaßungen den Brief des polnischen Episkopats zu begleiten. Obwohl Kominek am 27. November Döpfner erneut beteuert hatte, dass „weder die polnische noch die deutsche Presse, noch irgendjemand“ ein Exemplar der Botschaft erhielt, blieb das Durchsickern des Briefes an die Medien das beherrschende Thema im Kreis der deutschen Konzilsteilnehmer.26 Daran änderte auch die am 30. November erfolgte offizielle Veröffentlichung des polnischen Einladungsschreibens durch die dpa nichts. So wurde u.a. vermutet, dass Kardinal Frings den Text der Presse zugespielt hatte. Unter dem 1. Dezember 1965 vermerkte der Kirchenhistoriker und Berater des Kölner Kardinals, Prof. Hubert Jedin, in seinem Tagebuch: „Beim Abendessen wird erzählt, dass der Brief der polnischen Bischöfe in die deutsche Presse gelangt ist – und zwar durch Frings“, was Jedin jedoch stark bezweifelte.27 In Teilen der deutschen Konzilsdelegation machte man Erzbischof Kominek für die Indiskretion verantwortlich und unterstellte ihm dabei gezielte Absicht. In einer anonymen, unter den deutschen Bischöfen kursierenden Einschätzung über die polnische Botschaft und ihre bevorstehende Beantwortung heißt es:
„Die ‚Botschaft‘ ist sicherlich das Ergebnis gründlicher Studien und sorgfältiger Überlegungen, welche den Zeitpunkt ihrer Übergabe an den deutschen Episkopat betreffen […]. Eine endgültige Antwort mit Annahme der Einladung am Tage vor dem Schluß des II. Vatik[anischen] Konzils würde zweifellos eine außerordentliche Publizität gewinnen. Von einer zu solchem Zeitpunkt gegebenen endgültigen Antwort könnte sich der Episkopat ohne entsprechenden Verlust an Ansehen nicht distanzieren. Ein Hinausschieben jeglicher Antwort kommt natürlich vor Konzilsschluß nicht in Frage, weil sonst der deutsche Episkopat als Friedensstörer erschiene. Auch dieser Eindruck könnte später kaum verwischt werden. (Vulgär gesprochen: er würde mit dem schwarzen Peter in der Hand präsentiert).“28
Der anonyme Verfasser empfahl, die Annahme der Einladung zu den polnischen Millenniumsfeiern sollte „sorgfältig überlegt werden“, was aber „bis zum 6. Dezember“, also bis zum Abschluss des Konzils „kaum möglich sein“ dürfte.29