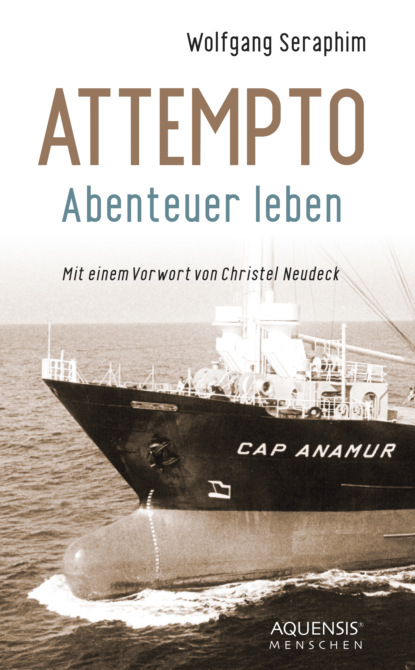- -
- 100%
- +

Es gab auch Ausflüge aus dem Freystädter Paradies. Im Sommer fuhr man zum Großvater nach Königsberg, präziser: zu seiner Residenz in Cranz, einem mondänen Badeort vor den Toren der Stadt. Ort wunderbarer Ferien für uns Kinder und Eltern in traumhaft schöner Umgebung. Auf dem Grundstück am Strand stand eine Verkaufsbude, die von einer reizenden jungen Dame, von den Kindern „Limonaden-Fräulein“ getauft, betrieben wurde. Onkel Viktor, ein hoch dekorierter Offizier, der im Ersten Weltkrieg mit seinem Doppeldecker mehrfach abgeschossen worden war, aber stets überlebte, war uns ob seiner Spendierfreudigkeit besonders ans Herz gewachsen. Er beauftragte das „Limonaden-Fräulein“, alle Wünsche zu erfüllen, was mir in schöner Regelmäßigkeit bei jedem Besuch in Cranz am ersten Tag eine limonaden-bedingte Revolte des Magen-Darmtraktes bescherte. Auch anderweitig entpuppte sich für mich ein wahres Paradies, das zu den unterschiedlichsten Entdeckungsreisen animierte. Auf dem weitläufigen Grundstück der Großeltern stand auch ein kleines Häuschen, das eine stramme Maid in den besten Jahren bewohnte, um bei allen anfallenden gröberen Arbeiten zur Hand zu gehen. An einem frühen Sommermorgen führte mein Weg an eben diesem Häuschen vorbei, dessen Türe einen Spalt offen stand. Gebannt starrte ich durch diesen Spalt auf das, was sich dem unschuldigen Kinderauge offenbarte: die rückwärtige Partie jener dort residierenden Schönheit, die nackt und bloß, wie Gott sie schuf, mit ihrer Morgentoilette beschäftigt war. Schon damals kein Freund von halben Sachen überwog die Neugier nach der dazugehörigen Vorderansicht die Furcht vor den mit der Erkenntnis eventuell verbundenen Gefahren. Auf Zehenspitzen schlich ich durch den leicht geöffneten Spalt auf das Objekt meiner Begierde zu, ohne zunächst entdeckt zu werden. Mutig hob ich die kleine Hand, stellte mich auf die Zehenspitzen und bohrte den Zeigefinger behutsam in die mir zunächst gelegene Pobacke der Dame. Nicht ohne mit schüchterner Stimme zu fragen: „Darf ich mal anfassen?“ Das Resultat der Recherche war umwerfend: Mit spitzem Schrei des Entsetzens drehte sich die junge Frau einmal um ihre eigene Achse. Ich trat nach kurzer Schrecksekunde übereilt die Flucht nach hinten an, wobei ich, in Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten, in einen schräg hinter mir stehenden Wassereimer plumpste. Für Sekunden starrten wir uns beide wie elektrisiert an. Langsam wich das Entsetzen des weiblichen Gegenübers einem befreienden Glucksen, das nahtlos in schallendes Gelächter überging. Instinktiv ahnte der kleine Entdeckungsreisende, dass damit wohl der gefährlichste Teil seines Abenteuers glücklich überstanden war. Dankbar ließ ich mich von zarter Hand aus etwas misslicher Situation, weil sehr beengt und feucht, befreien. Dabei die Gelegenheit nutzend, den ursprünglichen Ausgangspunkt meiner Forschungsreise betrachtend nachzuholen. So sehr ich mir auch in späteren Zeiten gelegentlich den Kopf zermarterte: ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, ob die gewonnenen Einblicke – genauer gesagt der Anblick – eingedenk des Schreckens, denn auch der Mühe wert gewesen waren …
Immerhin durfte ich das nach vielen Jahren einmal selbstbewusst unter der Rubrik „Früheste Einblicke und Erkenntnisse in die Anatomie am Lebenden“ subsumieren. Schließlich ein durchaus ernst zu nehmendes Unterrichtsfach jeder vorklinischen Ausbildung eines Mediziners.
Auf einer Erkundungstour entlang des Strandes stieß ich auf eine prächtig mit Muscheln verzierte Sandburg, in die ich mir mutig Eintritt verschaffte. Bereits von außen erspäht, taten sich deren Bewohner an einer großen Schüssel mit herrlichen Brombeeren gütlich. Die Mutter hatte ihrem Sohn, quasi mit der Muttermilch, schon die elementaren Regeln kommunistischen Wohlverhaltens eingetrichtert. Auf den in dieser speziellen Situation zugeschnittenen Fall bedeutete dies: Was dein ist, ist auch mein. So sahen sich die Bewohner dieser stolzen Burg plötzlich mit zweierlei konfrontiert: erstens einem zusätzlichen Esser, zweitens einem Vielfraß, der sich, in dieser ihm sehr entgegenkommenden Konstellation, häuslich einzurichten wusste. Mit langsam einsetzender Dämmerung begannen sich die gastfreundlichen, neu gewonnenen Bekannten aber auch dahingehend Gedanken zu machen, dass ihre nicht ganz freiwillige Neuerwerbung noch irgendwo ein zweites Zuhause haben muss. Nach dieser Heimstätte befragt, drehte sich der kleine Mann kapriziös mit weit ausholender Armbewegung einmal um die eigene Achse und verkündete freudestrahlend: „Da wohnt meine Mutti!“
Eben diese Mutti war mittlerweile seit über einer Stunde verzweifelt auf der Suche nach ihrem abhanden gekommenen Sprössling. Wie dieser viele Jahre später erfuhr, war seine Großmutter nach dreiviertelstündiger ergebnisloser Suche fest davon überzeugt: „Den Jungchen hat sich das Meer geholt!“ Dass sie mit dieser Einschätzung keineswegs hinter dem Berg hielt, fand die Mutter besonders „tröstlich“… Von all diesen Abläufen hatte „der Ritter von der Brombeerburg“ nicht die geringste Ahnung. Umso überraschter war er deshalb, als plötzlich die Mutter vor ihm auftauchte, um den verlorenen Sohn, in Tränen ausbrechend, in die Arme zu schließen.

Zurück nach Freystadt. Auf praktisch autofreier Hessestraße kreuzte eher gelegentlich ein Pferdefuhrwerk auf. Als Nebenprodukt fanden sich Pferdeäpfel, von mir akkurat mit kleiner Schaufel eingesammelt und dem Gartenkompost zugeführt. Das erhebende Gefühl, auf diese Weise einen bedeutenden Beitrag zu den Erträgen des Gartens zu leisten, beflügelte mich, das Sammelgebiet auf angrenzende Straßen auszudehnen. Dieser Sammeleifer weckte bei der Mutter zwiespältige Gefühle: Einerseits wurde ein gewisses sich frühzeitig entwickelndes ökologisch-ökonomisches Verständnis anerkennend registriert. Andererseits wollte das Pferdeäpfel sammelnde Kind des Arztes nicht so richtig zu dem sozialen Status passen, den man in der kleinen Stadt einnahm. Ich registrierte auf jeden Fall einen deutlichen Rückgang anfänglicher Lobeshymnen. Der Sammeleifer erlosch. Letztendlich machte ja auch das Schleuderball- und Völkerballspielen auf der Hessestraße viel mehr Spaß. Hier konnten auch gefahrlos erste Balanceakte beim Erlernen des Radfahrens erprobt werden. Im Hinterhof von Armin Winklers Wohnung wurde im Winter eine Schneeburg gebaut, um die heftige Schneeballschlachten entbrannten.
Neben dem elterlichen Schlafzimmer im ersten Stock zelebrierten die Geschwister, oft unter Assistenz von Gisel, im Bad ihre Morgen- und Abendtoilette. Gisela Hallup, ein wahrer Engel, eigentlich als Praxishelferin gedacht, war bald voll ins Familienleben integriert und lebte auch im Haus. Von diesem Bad aus führte eine zweite Türe in das sogenannte „gelbe Zimmer“, in dem an der Decke, über einer darunter aufgestellten Liege, eine Höhensonne baumelte. Auf dieser Liege wurde jeden Abend, nach väterlichen Vorgaben, Gymnastik getrieben. Neben allgemeiner Gelenkigkeit stand die Stärkung der Rückenmuskulatur im Vordergrund. Danach hieß es: Schutzbrillen auf und unter der Höhensonne einige Minuten auf den Bauch, einige Minuten auf den Rücken. Das ganze ging meist mit großem Hallo und Gelächter über die Bühne, weil z. B. die Purzelbäume recht abenteuerlich gerieten. Zur Stärkung des Fußgewölbes, also Vorbeugung gegen Plattfuß, lief man, wann immer es ging, barfuß. Außerdem wurde im sommerlichen Garten „Kieselsteinwerfen“ gespielt: Man nahm hinter einer markierten Linie Aufstellung, krallte sich einen kleinen Kiesel abwechselnd mal unter die Zehen des rechten, mal unter die des linken Fußes und versuchte, den Stein so weit wie möglich wegzuschleudern. Als Kleinster wurde mir ein Vorsprung von mehreren Zentimetern eingeräumt. Nach zahlreichen Versuchen wurde der „Kieselsteinkönig“ ermittelt.
Es war schon recht beachtlich, was im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts rein spielerisch den Kindern in Sachen Körperertüchtigung und Prophylaxe untergejubelt wurde. Zusätzlich war geplant, eine Gouvernante einzustellen. Nur dazu ausersehen, mit den Kindern Englisch und Französisch zu sprechen. Getreu dem Motto: Als Kind spielerisch, ohne Pauken von Grammatik oder Vokabeln, Fremdsprachen zu erlernen. Dabei lag die Betonung auf spielerisch leicht. Es ging keinesfalls um Heranzüchtung früh begabter Wunderkinder! Leider machte der Krieg einen Strich durch diese Planung. Es sollte ja noch so unendlich viel mehr aus der Bahn fliegen.
Nach abendlicher Gymnastik durften die älteren Geschwister noch in ihrem Bett lesen. Als Jüngster landete ich, von der Mutter liebevoll begleitet, als Erster in den Federn. Auch dies lief nach festem Ritual ab: Beginnend mit einer kurzen Gutenachtgeschichte – meist aus Grimms Märchen. Diese besondere Schule des Herzens, die schon früh den Wertewandel im Leben aufzeigt und auf den Ritt in die Dornenhecken des Lebens vorbereitet: man denke nur an „Hans im Glück“! Es folgte ein beliebter Abzählreim, bei dem jede Silbe des Reims an den Fingern beider Hände abgezählt wurde. Es endete mit einem kurzen Nachtgebet. Darin wurde, neben allen im Hause lebenden Familienmitgliedern, jeder mit eingeschlossen, der einem gerade einfiel. Um niemand leichtfertig ungewollt auszuschließen, wurden zuletzt noch „alle lieben Menschen“ mit einbezogen. Gekrönt wurde alles mit dem Gutenachtkuss der Mutter. In diesem Zusammenhang konnte ich mich später nie an den Vater erinnern. Sei es, dass ich zu jung war, um im Gedächtnis zu bleiben, oder der Vater schon im Krieg weilte.
Die Unterbringung der Kinder im Säuglingsalter gestaltete sich differenziert: Bei Ernst-Johann, dem Erstgeborenen, stand die Wiege noch direkt neben den Ehebetten. Der nächstgeborenen Margarete wurde als Schlafdomizil das dem Elternschlafzimmer angrenzende Badezimmer zugewiesen. Als letzter im Bunde, wurde ich in die entfernteste Ecke des Hauses verfrachtet. Derlei Differenzierung durfte keineswegs als Ausdruck unterschiedlicher Elternliebe interpretiert werden. Es war vielmehr die im Laufe der Jahre gewonnene Frucht der Erkenntnis, dass derlei Distanz zur elterlichen Ruhestätte dem Schlaf von Mutter und Vater förderlich und dem Gedeihen des Kindes nicht abträglich war. Leider ist es bis heute noch nicht möglich, das letzte Kind vor dem ersten zu bekommen …
Nach dem Tod des Vaters durfte ich in das Ehebett neben die Mutter schlüpfen, was mich stolz und froh machte – ich empfand es als ausgesprochenes Privileg gegenüber den Geschwistern. Trotz aller mütterlichen Liebe entwickelte ich einige Eigenarten, die – milde formuliert – als verhaltensauffällig bezeichnet werden mussten. So war es über Jahre nicht möglich, mir das Daumenlutschen abzugewöhnen. Selbst mit Bitterstoffen getränkte Daumenverbände blieben erfolglos – ich wusste mich immer wieder davon zu befreien. Unübersehbar: Die orale Phase hatte mein kindliches Dasein voll im Griff. Zudem gewöhnte ich mir auch noch das „Kullern“ an. Ein rhythmisches Hin- und Herwenden des Kopfes unter teilweisem Miteinbeziehen des Oberkörpers. So wiegte ich mich, ohne inneren Leidensdruck, über viele Jahre mühelos in den Schlaf.
Ebenso unerklärlich die mich seit dem fünften Lebensjahr vorübergehend plagenden Nabelkoliken – gemeinhin Ausdruck irgendwelcher Verlustängste, die zu vom Vegetativum gesteuerten Krämpfen der glatten Muskulatur des Verdauungstrakts führen. Diesen Ängsten fehlte für mich jeder erkennbare Realitätsbezug. Die heftig-krampfartigen Oberbauchschmerzen mit Übelkeit verschwanden wie von Zauberhand, sobald ich bei der Mutter unter der Bettdecke ihre beruhigende Hand auf meiner Bauchdecke fühlte.
Jahrzehnte später half mir dieses Erlebnis, Eltern zu erklären, dass es keineswegs ungewöhnlich ist, wenn eines ihrer Kinder über heftige Oberbauchschmerzen klagt, für die die Durchuntersuchung keinerlei klärenden Hinweis auf einen krankhaften Organbefund ergab.
Beim gemeinsamen Bad mit der Mutter wird erstmals bewusst, dass der weibliche Körper in bestimmten Einzelheiten gegenüber dem männlichen unübersehbar unterschiedlich ausgestattet ist. Lange Zeit wollte ich nicht glauben, aus der mütterlichen Brust ernährt worden zu sein; obendrein noch einst aus dem Bauch der Mama herausgeschlüpft zu sein, führte zu ungläubigem Kopfschütteln.
Im Erdgeschoss lagen, links vom Hauseingang separat, die Praxisräume des Vaters. Rechts ging es in die weitläufige Privatwohnung mit relativ dunklem Flur, von dem eine knarrende Holztreppe bogenförmig in den ersten Stock führte. Unter der Treppe ging es hinab in den Keller. Mit diesem verband ich in der Erinnerung lediglich zwei Dinge: erstens reichlich mit Einmachgläsern gefüllte Regale. Zweitens die Waschküche mit kleinem Treppenaufgang zum Garten und einer für damalige Verhältnisse supermodernen halbautomatischen Miele-Waschmaschine. „Miele, Miele sagt die Tante, die alle Waschmaschinen kannte.“ Die in heißer Seifenlauge schwimmenden Wäschestücke wurden maschinell hin und her geschleudert. Die Lauge konnte über einen Hahn am Boden des Gerätes abgelassen werden. Das sorgte für eine wohlig-warme Überschwemmung der nackten Füße auf dem kalten Steinboden, ehe die Brühe gurgelnd durch das Abflussgitter des Fußbodens in der Kanalisation verschwand. Nach dem Klarspülen folgte das recht mühsame Auswringen durch einen Wäschewringer, dessen Kurbel ich mit viel Vergnügen hingebungsvoll bedienen durfte – vorausgesetzt die Zeit drängte nicht allzu sehr. Das Gefühl, sich hier nützlich machen zu können, hob mein nicht sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein ganz ungemein. Es erfuhr eine weitere Steigerung, wenn ich, in einem kleinen Waschzuber mit dazu passendem Waschbrett Taschentücher oder Socken in der Seifenlauge bearbeiten durfte. Das anschließende Lob der Mutter als unabdingbares Sahnehäubchen musste nur selten schmollend eingeklagt werden.
Am Ende des Flurs gelangte man in die Küche, das Reich von Klara Wladrowarzek. Ein stämmiges, ungemein gutmütiges weibliches Wesen aus einfachen Verhältnissen polnischen Ursprungs. An ihrem ersten Arbeitstag eröffnete sie der Mutter treuherzig: „Manchmal bin ich etwas „muksch“, das darf Frau Doktor nicht stören. Frau Doktor müssen mich dann nur übers Knie legen und mir kräftig den Arsch versohlen, dann „funktioniere“ ich wieder!“ Die gute Seele gab aber keinerlei Anlass zu derlei drastischen Verhaltenskorrekturen. Sie hatte uns Kinder in ihr großes Herz geschlossen – Klara „funktionierte“ auch, rein verbal gesteuert, zu allseitiger Zufriedenheit.
Sie war gewohnt, kräftig zuzupacken und dementsprechend bestens für alle etwas gröberen Arbeiten geeignet, die in einem Mehrpersonenhaushalt anfielen. Wenn ich auf der Bohnerbürste sitzend von ihr mit mächtigen Stößen über den Fußboden katapultiert wurde, hatte das etwas von beglückender Rummelplatzatmosphäre. Aber auch wenn zartfühlendere Verrichtung gefragt war, z. B. das Zubinden der Schnürsenkel oder Abputzen der „vier Buchstaben“ nach erfolgreichem Toilettenbesuch, war Klara ein zuverlässiger Begleiter frühkindlicher Bedürfnisse.
Etwa 15 Jahre nach der Flucht aus Schlesien, besuchte Klara uns in der neuen Heimat Esslingen. Weiß der Himmel, wie sie die Adresse ausfindig gemacht hatte. Sie berichtete, wie sie 1945 mit ihren Eltern vor den Russen aus Freystadt geflohen war und dabei eines der Fahrräder als Fluchthilfe aus dem Hause Seraphim mitnahm. Es hatte etwas Rührendes, wie sie dabei wiederholt betonte, sonst – „auf Ehre“ – nichts aus dem Haus „entwendet“ zu haben. Wie tröstlich für all diejenigen, die später alles mitgehen ließen, was nicht niet- und nagelfest war …
Als guter Geist wirkte in der Küche auch Liesel Schütze. Für alles verantwortlich, was mit der Verproviantierung der Familie zu tun hatte. Sie besprach mit der Mutter den Speisezettel für die nächsten Tage, tätigte dementsprechende Einkäufe. Zauberte auch in Zeiten beginnender Knappheit – sprich Lebensmittelkarten – bravourös das Zepter über den Kochtöpfen schwingend, wohlschmeckende Mahlzeiten auf den Tisch. Dabei ging es, entsprechend den versorgungstechnisch schwierigen Kriegszeiten, recht spartanisch zu. Am Sonntagmorgen gab es ausnahmsweise Wurst. Für jeden zwei Scheiben Bierschinken auf eine Semmel pro Person. Sonst eben Schwarzbrot und selbst gemachte Marmelade, nur selten Käse oder Honig. Auch die wöchentliche Fleischration entfiel meist auf das sonntägliche Mittagessen. Dabei hatte ich schon bald entdeckt, dass die Fleischportion auf meinem Teller, im Vergleich zu der des Vaters, doch sehr zu wünschen übrig ließ. Es bedurfte vieler Monate, bis ich mir endlich ein Herz fasste und, leise nörgelnd, die Überlassung eines gleich großen Fleischstückes für meinen Teller beanspruchte. Überraschender Weise wurde dies umgehend zugesagt und in die Tat umgesetzt. Allerdings mit der Auflage, wie üblich, alles aufzuessen, was auf dem Teller war. Andernfalls entfiel der Nachtisch. Das Ende war vorhersehbar: Ich kaute immer noch an meinem Fleisch, als alle anderen schon längst beim Nachtisch saßen. Er wurde dieses Mal ohne eigene Mitwirkung vertilgt. Man ging aber zartfühlend mit dem Benjamin um, verlor kein Wort mehr darüber. Mutters Jüngster war um eine Erkenntnis reicher: Die Größe der mir zugeteilten Fleischportion wurde vom Fassungsvermögen meines Magens, nicht von mangelnder Elternliebe diktiert.

Zur Sommerzeit fanden in Anlehnung an eine Art „Kasperle-Dramaturgie“ Theateraufführungen statt. Von ihnen erhoffte sich die Kinderseele zahlreiche erwachsene Zuschauer. Dann zog eine ganze Kinderhorde von Haustür zu Haustür, um das bedeutsame Ereignis anzukündigen. Gleichzeitig galt es, eine bescheidene „Eintrittsgebühr“ von 10 Reichspfennig zugunsten der mitwirkenden „Künstler“ zu erbitten.
Die meist ablehnenden Reaktionen an den Wohnungstüren gaben der Kinderseele erste Einblicke in die Mentalität der dahinter lebenden Menschen. Dabei wäre es für sie sicher unterhaltsam gewesen, der Kinderschar zuzusehen. Es gab leidenschaftliche Diskussionen um die heikle Frage, wer was spielen darf. Wer gibt den Bösewicht, wer die von ihm entführte Jungfrau – in Ermangelung eines Mädchens nicht selten männlichen Geschlechts. Wer durfte der edle Ritter sein, der den Räuber zur Strecke brachte und die befreite Dulcinea in sein Schloss zurückbeförderte? Reich sind die Künstler dabei nicht geworden und in Ermangelung der erwachsenen Zuschauer mussten dafür die Kinder herhalten, die in dem Bühnenspektakel nicht zum Zuge kommen konnten. Dabei ließ man es nicht an Kreativität fehlen, möglichst viele Akteure auf die Bühne zu bekommen: Zum Beispiel als sich im Sturm biegende Bäume, die allerdings nicht selten aus der ihnen zugewiesenen Rolle fielen, weil sie meinten, in die nicht nach ihrem Geschmack ablaufende Dramaturgie des Drehbuchs eingreifen zu müssen. Ähnliches galt für die auf Kisten ans Firmament postierten Sonne und Mond, die je nach Tages- bzw. Nachtzeit der Handlung ihr Gesicht zu verhüllen hatten. Da die Künstler meist tagsüber agierten, war die Rolle des Mondes nicht sehr begehrt – schließlich wollte der ja auch etwas vom Spektakel sehen. Um diesem Missstand abzuhelfen, entschied die Regie, dass der Mond bei Tage unverhüllt auf der Kiste sitzen durfte statt zu stehen. Dafür musste der Mond die Akteure unterstützen, die als Windbläser eingeteilt waren, wenn die Regie Sturm aufziehen ließ.
Neben derlei harmlosen Kinderbelustigungen kam eins der Kinder eines Tages auf die Idee, den nicht allzu weit entfernten Eisenbahnschienen einen Besuch abzustatten. Hier fuhren nicht gerade häufig die Züge von und nach Neusalz vorbei. Eine willkommene Abwechslung in dem an technischer Dynamik nicht eben reichhaltigen Reservoir kindlichen Erlebens. In Anlehnung an Winnetou, der mit dem Ohr am Boden das noch um Kilometer entfernte Getrappel von Pferdehufen erahnen konnte, musste das auch mit dem Ohr auf der Schiene bezüglich eines herannahenden Zuges ausprobiert werden. Diese Experimente verliefen absolut enttäuschend. Vom weit entfernten Zug war effektiv nichts zu erahnen. Es wurde mangelhafter Naturverbundenheit zugerechnet. In diesem Zusammenhang tauchte auch die spannende Frage auf, wie nahe ein Zug kommen muss, bis sich dies dem Ohr auf der Schiene zweifelsfrei kundtut? So blieb es nicht aus, dass sie ihre Ohren auch noch auf die Schiene pressten, als der Zug schon in Sichtweite war. Das versetzte den Lokomotivführer in höchste Alarmbereitschaft, die sich in heftigen Pfeifsignalen Luft machte, was wiederum die Kinder begeisterte und sich bald zu einer Art Sport entwickelte. Er wurde mit der Mutprobe verbunden, wer seinen Kopf am längsten vor dem herannahenden Zug auf der Schiene behielt.
An dieser Stelle kam der Beruf von Armins Vater ins Spiel: Einem der Lokomotivführer, der diesem Sport keinerlei Unterhaltungswert abgewinnen mochte, erinnerte sich daran, dass der Schrankenwärter einen Sohn hatte, dessen Alter gut zu dem der von ihm wiederholt gesichteten Kindern passte. Er kontaktierte Armins Vater. Der wiederum unterzog seinen Sprössling einer hochnotpeinlichen Befragung, der Armin auf Dauer keinen Widerstand entgegenzusetzen vermochte. So endete dieser Ausflug in das prickelnde Abenteuer mit einem häuslichen Donnerwetter und bei mir zusätzlich zu einer Abkommandierung in die für derlei Entgleisungen kindlichen Wohlverhaltens vorgesehene Ecke im Esszimmer. Hier hatte ich mich, mit dem Rücken zum Esstisch, für mindestens fünf Minuten zu postieren, um „sich zu schämen“… In diesem, wie in den meisten anderen Fällen dieses Zwangsaufenthaltes, hielt sich die Scham sehr in Grenzen. Warum diese Prozedur trotzdem zu einem gewissen Grade gefürchtet war, lag an der damit verbundenen gähnenden Langeweile. Der Mutter ging dabei die im Minutenabstand wiederholte Fragerei nach dem Ende der Strafaktion auf die Nerven. Nach meiner Erinnerung stand ich nicht sehr häufig in dieser Ecke. Was aber nicht unbedingt dafür spricht, ein besonders braves Kind gewesen zu sein. Bestrafungen waren für die Mutter eine nicht gern ergriffene Maßnahme. Sie hielt mehr von eingehender Ermahnung. Der Rubikon war allerdings überschritten, wenn zum Beispiel versucht wurde, im Nachbargarten bei Rektor Wehner mit einem in den Baum geworfenen Ast Süßkirschen zu ernten und bei dieser, mit untauglichem Objekt durchgeführten Prozedur, der Ast in der klirrend zerbrechenden Scheibe der Speisekammer des Rektors landete. Solch gravierende Vorkommnisse führten zu einer Verlängerung der Strafaktion um zehn Minuten …
Wenn die Witterung das Spiel vor der Tür nicht zuließ, gab es im ersten Stock des Hauses genügend Räumlichkeiten, sich auszutoben. Im Flur waren eine höhenverstellbare Schaukel und eine ebenfalls in der Höhe variable Reckstange montiert. Direkt daneben ein großes Spielzimmer, an dessen Fensterseite zum Balkon eine mehrere Meter lange Spielplatte angebracht war. Daran angrenzend eine große Wandtafel, die nach Herzenslust mit bunter Kreide zur Bemalung einlud. Rechtwinklig dazu eine Sprossenwand zum Klettern und Turnen. Eine Fundgrube für Kreativität und ungebremstem Bewegungsdrang. In diesem Kinderparadies konkurrierte Holzspielzeug mit Schaukelpferd, einem Kaufladen und einer Puppenküche. Hier brutzelten auf kleinem beheizbarem Herd sogar kindgerechte Portionen. Zum Klassiker avancierten Pfannkuchen, die sich so großer Beliebtheit erfreuten, dass sie gelegentlich in unerwünschte Konkurrenz zu der von der Mutter gekochten Hauptmahlzeit gerieten.

Das Esszimmer hatte einen erkerartigen Ausbau Richtung Garten. Hier hielt sich die Mutter gerne zu Näharbeiten auf. Im Nähkörbchen lag das Mutterkreuz, das der „reinrassig deutschen Frau“ namens des tausendjährigen Reichs ab der Geburt einer mir nicht mehr bekannten Zahl von Kindern mit „Heil Hitler“ unterzeichnetem Begleitschreiben zugestellt wurde. Mit ein wenig Stoff und buntem Metall glaubte man offensichtlich, Deutschlands Frauen die Bereitstellung von Kanonenfutter für die kriegerischen Expansionspläne eines „Volks ohne Raum“ schmackhaft machen zu können. Ich fand es später gut, dass dieser Orden, meines Wissens von der Mutter verschmäht, nie getragen wurde.
Für mich ist die Sitzgruppe im Erker um eine Schulbank erweitert worden. Von ihr versprach sich die Mutter eine in doppelter Hinsicht nützliche Funktion. Erstens die stramme aufrechte Haltung, zweitens eine damit verbundene bessere Konzentration bei der Bewältigung der Schulaufgaben. Beides ließ offensichtlich zu wünschen übrig. Ausdruck einer früh zutage tretenden Problematik: Mutters Jüngster und die Schule! Aufschlussreich, dass derlei Aufwand bei beiden älteren Geschwistern nicht für notwendig erachtet wurde. Wo unsereins mühsam ackern musste, lief bei ihnen alles wie am Schnürchen.