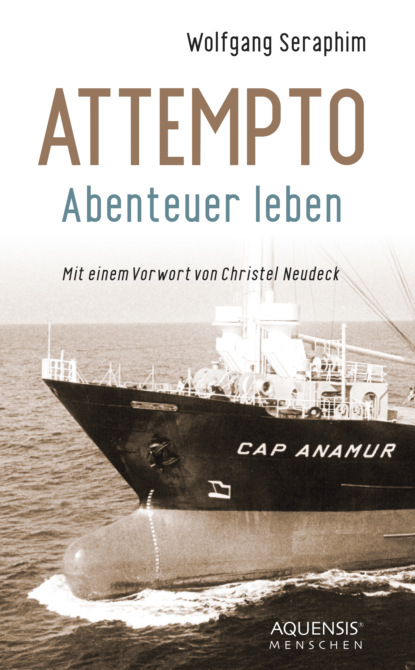- -
- 100%
- +
Mit acht Jahren, 1944, bekam ich Hitlers „Mein Kampf“ in die Hände. Noch gut in Erinnerung ging es schwerpunktmäßig um zwei Dinge. Erstens „Volk ohne Raum“ und zweitens „das Judentum als Kern allen Übels“. Das erste erschien so eindrücklich begründet, dass man keinen Widerspruch dagegensetzen mochte. Es war, bei dem mir als Kind sehr begrenzten Zugang zur Realität, zumindest nachvollziehbar. Es schien dringend geboten, das Großdeutsche Reich baldmöglichst größer werden zu lassen als es schon war. Punkt zwei blieb dafür umso rätselhafter. Daraus machte ich auch gegenüber der Mutter keinen Hehl. Ihre Replik war kurz und knapp: „Das wirst du erst verstehen, wenn du älter bist!“ Später verstand ich, warum die Mutter damals nicht wagte, eindeutig Stellung zu beziehen: Es wäre viel zu gefährlich gewesen, mir recht zu geben. Kinder neigen nun einmal dazu, am falschen Ort das Richtige zu sagen … Wenn es in Freystadt Juden gegeben haben sollte, war es mir nicht bekannt. Auch von deren tatsächlicher Verfolgung erfuhr ich erst, nachdem das Tausendjährige Reich bereits seinen Geist aufgegeben hatte. Den ganzen Umfang der Gräuel sogar erst 1955 – ein Jahr vor meinem Abitur! – als im Rahmen des Geschichtsunterrichts Filme gezeigt wurden, die Amerikaner 1945 nach der Eroberung von Konzentrationslagern gedreht hatten. Das Bildmaterial machte vor Entsetzen sprachlos. Die Eltern waren sich der Gefahr, die Juden damals drohte, durchaus bewusst: Seraphim, unser Familienname, konnte als hebräischer Plural durchaus ein Hinweis auf jüdische Abstammung sein. Grund genug für Vaters Bruder, Erhardt Seraphim, sich in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts intensiv mit Ahnenforschung zu beschäftigen. Das Ergebnis seiner Bemühungen: Die Familie sei im 12. Jahrhundert, im Rahmen der Ostkolonisation, vom Rheinland aus auf Wanderschaft gegangen. Dabei hat sich der Stamm gespalten: Eine Linie ging nach Nordosten, eine nach Südosten. Inzwischen sprach alles für das Reset: Zurück auf Anfang – eine baldige Wanderung zurück Richtung Westen …
Dementsprechend gab es im Inneren des Hauses Hessestraße 3, um den Januar 1945, auffällige Veränderungen. Der Geschützdonner der Ostfront war Anlass, meine Schlafstatt vom ersten Stock in das wohl für sicherer gehaltene Damenzimmer im Erdgeschoss zu verpflanzen. Im Nebenzimmer stapelten sich zusammengerollte Teppiche. Wofür das alles? Man wollte wohl für eine schnelle Evakuierung mit Sack und Pack vorbereitet sein. Diese lief schon seit Wochen auf vollen Touren. Aus Ostpreußen wälzten sich lange Trecks von Pferdefuhrwerken durch Schlesien. Eine Karawane des Elends mit vermummt auf dem Wagen schwankenden, unglücklichen Gestalten. Zugedeckt mit ihrem Bettzeug, dennoch nur unzureichend geschützt der bitteren Winterkälte ausgesetzt. Es kursierten bedrückende Erzählungen von erfrorenen Säuglingen, die man im Schnee längs der Straße abgelegt zurückgelassen auffand. Ein hart gefrorener Boden verhinderte die Bestattung vor dem Weiterziehen. Zusammen mit der Schwester folgten wir einer vom Roten Kreuz angekurbelten Hilfsaktion und schmierten im Akkord Schmalzbrote für die durchziehenden Flüchtlinge.
Die Mutter hatte schon 1944, mehr oder weniger freiwillig, an der Heimatfront mitgewerkelt. Sie lötete an Schalttafeln, die in die Elektronik deutscher Flugzeuge „für den Endsieg“ eingebaut werden sollten. „Sie lötete für Deutschland“ wie Vetter Jörg einmal so nett, anlässlich einer Geburtstagsfeier der Mutter Jahrzehnte später, formulierte. Die Klimmzüge an der Heimatfront waren gleichermaßen vielfältig wie rührend und ineffektiv. Das Winterhilfswerk, kurz WHW genannt, wurde ins Leben gerufen: Man sammelte Winterbekleidung für die Truppen an der Ostfront. Alle Skiausrüstungen sollten abgegeben werden – zur angeblich besseren Mobilität der deutschen Soldaten in Russland.
Über der Kreissparkasse in Freystadt prangte ein großes Transparent mit einem Aufruf, der an den ersten Weltkrieg erinnerte: „Gold gab ich für Eisen.“ Eines Nachts hatte jemand das Transparent entfernt und stattdessen ein anderes Plakat angebracht: „Der Adler ist ein kluges Tier, er frisst das Gold und scheißt Papier“ stand da zu lesen. Natürlich wurde dieses „Dokument übelster Volksverhetzung“ umgehend beseitigt und eine Belohnung von tausend Reichsmark für denjenigen ausgesetzt, der Angaben für die Ergreifung der Übeltäter machen konnte. Doch schon wenige Tage später prangte erneut ein im Schutze der Nacht angebrachtes Plakat an gleicher Stelle: „Tausend Mark was heißt’s? Von dem was er frisst oder von dem was er scheißt?“ Die Initiatoren dieses „Plakatkrieges“ kann man nur bewundern. Einerseits ob ihres sarkastischen Humors, der sie in dieser ernsten Zeit nicht verlassen hatte, andererseits ob ihres Mutes, denn sie mussten sich darüber im Klaren sein, dass man sie umgehend standrechtlich erschossen hätte, wäre man ihrer habhaft geworden.
Mit dem rollenden Geschützdonner war es um die Ruhe in der verträumten kleinen Kreisstadt im Januar 1945 geschehen. Der Kampf im Osten tobte am Oderübergang, nur 14 km von Freystadt entfernt. Eine Kakophonie aus johlenden Stalinorgeln und dem Trommelfeuer deutscher Geschütze. Da tauchte eines Abends, unvermittelt wie ein Bote aus fremden Sphären, eine gespenstische Gestalt auf. Ein Landser, hereingeschneit aus winterlicher Kälte, rieb sich die klammen Finger auf dem Küchenstuhl neben dem Herd. Unrasiert und abgerissen mit aschfahlem Gesicht und unendlich müden, tief in den Höhlen liegenden Augen. Sie wirkten erloschen und schienen in der Ferne etwas zu suchen, das unerreichbar jenseits des Raumes lag. Auf die Frage nach dem Woher und Wohin strich er sich langsam die wirren Haare aus der Stirn – und schwieg. Nach einigen Minuten – so als müsse er sich jedes einzelne Wort überlegen: „Bin mit meiner Knarre nach unten zwischen russischen Panzern durchgelaufen. Haben mich überhaupt nicht registriert. Dauert nicht mehr lange, dann sind sie da.“ Wie ein monolithischer Eisblock taute er langsam in der Wärme der Küche und der spürbaren familiären Geborgenheit ihrer Bewohner auf. Nur stockend berichtete er vom fast ungeordneten Rückzug der deutschen Truppen. Während ihm die Mutter in aller Eile Spiegeleier briet, stellte sie die Frage, die sie schon seit Wochen umtrieb: „Wohin soll ich mit meinen Kindern?“ Er zuckte hilflos mit den Schultern, beugte sich langsam vor, machte eine müde, weit ausholende scheinbar ins Unendliche deutende Armbewegung. Flüsternd, kaum hörbar aber doch eindringlich, stieß er hervor: „Abhauen, in Richtung Westen, so schnell wie möglich“, um nach kurzer Pause hinzuzufügen: „Solange das noch geht.“ Mehr war nicht aus ihm heraus zu holen. Er verschlang in wenigen Minuten sein Essen. Dann wankte er wortlos in Begleitung seiner abgewetzten Umhängetasche, an der die Feldflasche neben einem leeren Kochgeschirr baumelte, zu der rasch für ihn im ersten Stock zubereiteten Schlafstatt. Am nächsten Morgen war er, so wie gekommen, still und geheimnisvoll verschwunden. Wieder untergetaucht in einer für mich irrealen Welt, die in nichts mit einem behüteten Kinderdasein in Deckung zu bringen war. Es gibt Begegnungen, die sich unauslöschlich in die Festplatte eines Menschen einprägen. Die dazu passenden Worte fand schon vor Jahrhunderten Erasmus von Rotterdam: „Dulce bellum inexpertis“ – Süß ist der Krieg nur für jene, die ihn nicht kennen.

Es muss in den frühen Morgenstunden Anfang Februar zwischen 5 und 6 Uhr gewesen sein. Die Türe zur Schlafstätte wurde jäh aufgerissen, das helle Deckenlicht fast gleichzeitig blendend eingeschaltet. So roh und obendrein zu noch nachtschlafender Zeit hatte mich die Mutter noch nie aus dem Schlaf gerissen. Außerdem war sie sofort wieder aus dem Zimmer gelaufen, hatte mich nicht, wie sonst morgens üblich, liebevoll auf der Bettkante sitzend, wach geküsst. Der achtjährige Junge spürte sofort: Hier war alles auf Alarm gebürstet. Eine völlig neue Erfahrung. Kontrastprogramm zur bisher so behüteten Kindheit. Ein Bündel dicker Winterkleider flog auf die Bettdecke, ehe die Mutter weiter hastete. „Aufstehen! Anziehen!“, rief sie schon im nächsten Raum entschwindend. Da schwang viel gebieterischer Druck in ihrer Stimme. Völlig neu und zusätzlich zur Prozedur des ungewöhnlichen Weckvorganges so verwirrend, dass mein anfänglich aufkeimender Unmut umgehend erlosch. Während des Anziehens tauchte die Mutter erneut auf: „Wir müssen weg! Der Russe kommt!“ Kurz daraufhatte sich die ältere Schwester gähnend neben der Mutter am Esstisch eingefunden. Vor ihnen stand dampfend eine in Windeseile mit Brühwürfeln zubereitete Nudelsuppe. „Junge, trödle nicht rum. Fraglich wann wir wieder etwas zwischen die Zähne bekommen!“ Der Junge stocherte lustlos in dem vor ihm stehenden Suppenteller. Die Aufregung schnürte den Magen zu. Ich wickelte mich in die letzte Zwiebelschale der warmen Winterkleidung, die zuvor noch auf der Bettdecke gelegen hatte. Dabei entdeckte ich auf der Kommode einen kleinen Zettel – Relikt der Ski-Spende für das „Winterhilfswerk“ zugunsten „unserer tapfer kämpfenden Truppen an der Ostfront“. „Soll der hier liegen bleiben?“ Die Mutter schaut den Jungen verstört an: „Sonst keine Sorgen?“ Das Gesicht der Mutter, eine einzige Mischung aus Angst und gehetzt sein. Vor einer halben Stunde hatte man an die Haustür geklopft: In wenigen Stunden verließ der letzte Zug Freystadt in Richtung Westen. Vielleicht die letzte Möglichkeit, den Russen auf dem Schienenweg zu entkommen. Vor wenigen Tagen war spät abends so schemenhaft der desertierte, unrasierte und unendlich müde Landser in abgerissener Wehrmachtsuniform aufgetaucht. Am nächsten Morgen so unvermittelt verschwunden, wie zuvor hereingeschneit.
Beim Gang zur Haustüre tragen die beiden Kinder je einen kleinen, die Mutter einen großen Rucksack. Ich habe zusätzlich einen Zettel in Cellophan um den Hals: mit Namen, Geburtsdatum, Herkunft und als Reiseziel Süddeutschland. „Falls wir uns verlieren – man kann ja nie wissen.“ Ich fühlte mich kindlich entmündigt und begehrte gegen die fürsorgliche Plakatierung auf. Doch die Mutter blockte energisch jede Diskussion ab. Sie zieht die Haustüre von außen zu, verharrt einen Moment unschlüssig auf der obersten Stufe, den Blick auf den Schlüssel in ihrer Hand gerichtet. Abschließen? Offen lassen? Für wen? Dann gibt sie sich einen Ruck, steckt entschlossen den Hausschlüssel in das Schloss ohne abzuschließen. Als sie sich umdreht, huscht ein kurzes wehmütiges Lächeln über ihr Gesicht. Es erscheint plötzlich um Jahre gealtert. Die Oberlippe zittert. Der Schlüssel in ihrer Hand: Symbol einer von Endgültigkeit geprägten Entscheidung. Besiegelt der unwiederbringliche Verlust einer stolzen Epoche. Willkommen in ungewisser Zukunft!
1945
Auf der Flucht
Dann stapften drei vermummte Gestalten mit ihren Rucksäcken die Hessestraße hinunter, Richtung Bahnhof. Nach wenigen Metern ging die Mutter noch einmal in das Haus zurück. Die Schwester lief langsam weiter Richtung Bahnhof, ich sollte warten. Es dünkte eine Ewigkeit, bis die Mutter endlich zurückkam. Zum ersten Mal seit Vaters Tod sah ich wieder Tränen in ihren Augen. Sie hatte wohl vergeblich nach irgendwelchen Dokumenten gesucht. Auf dem Bahnhof gab es keinen Personenzug, sondern ausschließlich einen Güterzug mit unter Dampf stehender Lok. „Der geht Richtung Westen“, so der Stationsvorsteher. Mehr wusste auch er nicht; weder Abfahrtszeit, geschweige denn sein Ziel im Westen. Also kletterte man mit vielen anderen Freystädtern in die mit Stroh ausgelegten Viehwaggons und harrte dort, auf dem Boden sitzend, der Dinge, die da kommen sollten.
Langsam setzte sich der Zug ruckelnd in Bewegung. Die Türe des Waggons war einen Spalt weit offen geblieben. Der Blick schweifte über die im Sonnenlicht vorbeifliegende, glitzernde Schneelandschaft. Ich fand alles nur noch spannend. Mit einem Personenzug war man ja schon oft unterwegs gewesen. Aber ein Viehwaggon mit während der Fahrt halb geöffneter Tür, das hatte schon was Besonderes, war Abenteuer pur. Immer wieder wurde, oft auf freier Strecke, angehalten und somit das Problem des „Spatenganges“ gelöst. Man schlug sich seitwärts in die Büsche, ehe der Transport nach ausgedehntem Pfeifkonzert des Lokführers wieder Fahrt aufnahm. Irgendwann war dann an einem Bahnhof Endstation. Es begann die Zeit des Wartens. Die Züge schienen alle nur noch Richtung Westen programmiert. Als ob man gewiss sein dürfte, was dort zu erwarten sei. Aber es galt wohl als Ausdruck stiller Übereinstimmung: alles, nur nicht den Russen in die Hände fallen! Auf den Bahnsteigen herrschte atemberaubendes Gedränge, gepaart mit Ungewissheit. Wann fährt welcher Zug wohin? Wenn es überhaupt Lautsprecherdurchsagen gab, waren sie in dem Tumult kaum zu verstehen und obendrein sehr vage. Im Bahnhof stehende Züge waren bis auf die Trittbretter völlig überfüllt, Mütter riefen verzweifelt die Namen ihrer abhandengekommenen Kinder. Wenn ein leerer Zug einlief, wurde dieser nach allen Regeln der Kunst gestürmt. Koffer blieben zunächst auf dem Bahnsteig stehen und wurden anschließend durchs offene Fenster nachgereicht, ehe man auf gleichem Weg folgte.
Irgendwann bei Kattowitz tauchte ein Mädchen, ca. 14 Jahre alt, im Zugabteil auf. Ihre Augen flackerten in tief liegenden Höhlen und mit zittriger Stimme bat sie um ein Stück Brot. Dabei schwankten die Hände weit ausgestreckt flehentlich von einem Mitreisenden zum nächsten. Die Mutter griff in ihren Rucksack, zauberte einen Brotlaib hervor, schnitt einen Ranken ab und legte ihn wortlos in die Hände des Mädchens. Das blasse Gesichtchen verschwand fast vollkommen hinter dem Brot. Vor meinen staunenden Augen war das Brot nach wenigen Minuten mit beiden Händen gierig in den Mund geschoben und herunter geschlungen. Eine Mitreisende murmelte betroffen: „Mein Gott, wir wissen ja selber nicht, wann wir uns irgendwo wieder etwas zu essen besorgen können.“ Damit traf sie den Nagel auf den Kopf. Die Mutter war die einzige geblieben, die sich von einem Teil der Notration für sich und die Kinder getrennt hatte. Ich spürte instinktiv: Was bisher als spannendes Abenteuer erlebt wurde, barg auch bedrohliche Aspekte, die ich bisher gnädig aus meinem kindlichen Gemüt verdrängt hatte. Gleichzeitig damit verbunden geriet die Mutter neben mir zum unerschütterlichen Fels in der Brandung. Vorsorgend gegen alle Gefahren gewappnet.
In Leipzig war vorübergehend wieder Endstation. Die Rumpffamilie – der Bruder befand sich ja noch in Breslau – landete in einem Bunker. Hier kampierten, wieder in drangvoller Enge, auf Notliegen Hunderte von Flüchtlingen in gespenstischem Halbdunkel. Die Luft zum Schneiden dick. Angstschweiß entwickelt eine besondere Duftnote. Hier geriet sie zu unverkennbarer Dominanz. Das Rote Kreuz sorgte für Nudelsuppe. Sie wurde von der Mutter vorsorglich, nach dem Motto: „Zucker sparen grundverkehrt, der Körper braucht ihn, Zucker nährt“, mit diesem Kräfte spendenden Zaubermittel aus ihrer Notration angereichert. Diese Kombination war gewöhnungsbedürftig. Aber es gab zu jener Zeit noch ganz andere Dinge, an die sich zu gewöhnen erheblich mehr Überwindung kostete … Bis auf den heutigen Tag keine Nudelsuppe, ohne den Gedanken an diesen Zuckergeschmack auf der Zunge und an diesen Bunker in Leipzig. Für ein Kind geriet dieses Szenarium bald zu einer ätzend langweiligen Komponente seines Abenteuers. Für mich nicht mehr erinnerlich, wie lange sich dieser Abschnitt der Flucht hinzog. Auf jeden Fall war ich der Mutter sehr dankbar, als sie eine innere Unruhe ergriff, uns Kinder bei der Hand nahm, um wieder dem Abenteuer Bahnhof zuzustreben.
Der Rest der Reise ist im Gedächtnis nicht mehr abrufbar. Ich erinnere mich aber noch sehr deutlich daran, plötzlich energisch wach gerüttelt worden zu sein. Es war stockdunkel. Immer noch hundemüde stolperte ich an der Hand der Mutter durch die bitterkalte Februarnacht. Ein vor Heißhunger brennendes Feuer in der Magengegend. Da standen wir, frühmorgens gegen vier Uhr vor einem Haus neben dem Marktplatz in dem kleinen schwäbischen Städtchen Murrhardt bei Backnang. Die Mutter drückte auf eine der zahlreichen Klingelknöpfe eines großen Hauses. Schlotternd vor Kälte spähte man gebannt in die Nacht. Rührt sich was? Noch heute sehe ich beim Blick in einen klaren Sternenhimmel die Giebelumrisse dieses Hauses unter den in der Kälte flimmernden Sternen. Wer um alles in der Welt nimmt zu nachtschlafender Zeit eine unbekannte Mutter mit zwei Kindern bei sich auf!? Am liebsten hätte ich mich auf der Stelle hingelegt. Schlafen und nicht mehr aufwachen, der einzige Wunsch. Dann kam alles ganz anders. Die Mutter rief zu einem sich oben öffnenden Fenster hinauf. Es schloss sich, nachdem von dort nur ein einziges Wort zu hören war: „Allmächtiger!“ Lichter gingen an, und eine Stunde später lagen die drei Wanderer zwischen den Welten mit einer großen Portion Grießbrei im Bauch in den noch warmen Betten zweier mir völlig unbekannter alter Damen. Ein Erlebnis, das in der Seele eines achtjährigen kleinen Jungen tiefe Spuren hinterlässt. Gerührt von so viel Hilfsbereitschaft beschloss ich: Sollte ich später einmal zu Geld und Einfluss kommen, will ich notleidenden Menschen wieder ein wenig von dem zurückgeben, was eben dankbar empfangen wurde. Erst am nächsten Tag wird realisiert, dass die zwei alten Damen der Mutter gar nicht so unbekannt waren. Die beiden Schwestern, Edith und Marta Horn, waren der Mutter in ihrer jugendbewegten Wandervogelzeit begegnet. Damals, so erfuhr ich später, hatten sich die beiden Schwestern Horn in den Bruder der Mutter unglücklich verliebt. Es war ein meine Zukunft prägendes Erlebnis. Ich konnte nicht ahnen, zu welchen Ufern dies später noch tragen sollte. Auf jeden Fall stand ich an der Schwelle eines völlig neuen Lebensabschnitts.
Willkommen in Schwaben
Wir waren bei den Schwestern Martha und Edith Horn in einer recht abgelegenen Ecke des Schwabenlandes, dem kleinen verträumten Murrhardt mit ein paar tausend Einwohnern gestrandet. Inhaber eines geradezu klassischen Tante-Emma-Ladens. Damals noch ein nicht wegzudenkender Anker des täglichen Bedarfs in einem Ozean des Mangels. In dem Geschäft „Horn am Markt“ lagerten neben einem bescheidenen Fundus an Grundnahrungsmitteln wie Mehl und Zucker für die Einwohner auf Lebensmittelkarten, Reste von Stoffballen, Häkeldecken, Nähseide, Wolle, Stricknadeln, Reinigungsmittel für den Haushalt. Unter anderem ein Pulver zur Zahnreinigung in kleinen Pappschachteln, auf dem ein Tiger mit grellweiß blitzenden Zähnen um die Gunst des Kunden buhlte. Dieser Tiger mit der Pappschachtel hatte es mir besonders angetan. Schon nach wenigen Tagen machte ich mir zur Aufgabe, den etwas schleppenden Umsatz dieses Wohltäters der Zahngesundheit anzukurbeln. Sobald ich durch das Fenster der Ladentüre einen Kunden erblickte, öffnete ich von innen und hieß ihn mit freundlichem Diener willkommen. In den ersten Tagen sorgte das für einen meist dankbar registrierten Überraschungseffekt. Später begegnete man sich mit einem freundlichen Lächeln des Wiedererkennens. Beim Verlassen des Ladens kam der Moment der Bewährung: Noch ehe ich erneut die Ladentüre öffnete, fragte ich mit einem Lächeln, das mindestens ebenso viel Zahn zeigte wie der Tiger auf der Schachtel: „Haben der Herr/die Dame auch noch einen Vorrat dieses vorzüglichen Zahnreinigungsmittels?“ Neben dem nicht zu leugnenden Klein-Jungen-Charme verfehlte das Wörtchen „Vorrat“ in einer Zeit des Hamsterns nicht seine Wirkung. Der Verkauf florierte, eine telefonische Zusatzbestellung beim Großhändler wurde fällig und ich sah mich schon als den großen Zampano, der den Laden zu ungeahnten Höhenflügen führt. Leider währte dieses Glück der Selbstbestätigung nicht lange: Entweder putzten sich Murrhardts Bürger zu selten die Zähne, oder der Schachtelinhalt war vom Hersteller zu großzügig bemessen. Vielleicht krankte es auch an der geringen Einwohnerzahl. An der Konkurrenz konnte es nicht liegen – „Horn am Markt“ war konkurrenzlos! Wie auch immer, der Umsatz stagnierte alsbald deutlich. Für mich das Signal, sich nach einer anderweitigen Spielwiese umzusehen.
Gegenüber vom Wohn-Geschäftshaus, in dem man Obhut gefunden hatte, stand die Volksschule, aus der die Schüler – immer wenn die Sirenen „akute Luftgefahr“ signalisierten, in Scharen herausströmten. Dabei ertönte aus Dutzenden von Kehlen ein „sauet, sauet!“, worauf ich mir keinen Reim machen konnte. „Des hoißt so viel wie reufla“, wurde ich von den Geschwistern Horn beschieden, was den Tatbestand nicht transparenter machte. Die Mutter half nach: „Lauft schnell“ war die Devise und die wurde zu damaliger Zeit fast täglich ausgegeben.
Wann immer sich feindliche Flugzeuge Murrhardt näherten, wurde dieser Mechanismus in Gang gesetzt. Sehr sinnvoll war das nicht, denn es handelte sich immer um Bomberverbände, die mittlere Großstädte mit nennenswerten Industrie- und Rüstungsanlagen zum Ziel hatten. Mit beiden Attributen konnte Murrhardt erfreulicherweise nicht dienen. So geriet die häufige Unterbrechung des Unterrichts zu einer Art Happening, was die Schüler freute. Der Rest der Bevölkerung nahm das Sirenengeheul gar nicht mehr zur Kenntnis.
Diese Sorglosigkeit sollte sich eines Tages als trügerisch erweisen. Es war zur Zeit der Schlüsselblumen, als ich zusammen mit einem Spielkameraden, auf einer Wiese oberhalb von Murrhardt, sogenannte „Judenstrickle“ rauchte. Auf Fingerlänge zurechtgeschnittene trockene Lianen, deren Rauch die Schlüsselblumenblüten beim Durchblasen braun färbten. Wieder einmal zog einer der Bomberverbände über Murrhardt hinweg, als sich plötzlich ein begleitendes Jagdflugzeug aus dem Verband löste, um sich wie ein Habicht auf eine im Bahnhof unter Dampf stehende Lokomotive zu stürzen. Die Bordgeschütze ratterten und schlugen Löcher in den Kessel der Lok, aus denen der Dampf zischte. Fasziniert starrten wir auf das Geschehen. Der Jäger drehte ab, zog nach oben und raste bei diesem Manöver auf die Wiese zu, auf der wir saßen. Plötzlich trat die Bordkanone erneut in Aktion. Die Geschossgarbe, eine Spur aufspritzender Erde vor sich her treibend, schoss in rasender Geschwindigkeit auf uns zwei Jungen zu. Reflexartig warfen wir uns rechts und links zur Seite. Wie vom Lineal gezogen hatte die Garbe genau die Mitte unseres ursprünglichen Sitzplatzes durchpflügt. In panischer Angst rannten wir dem Waldrand entgegen. Der Jäger raste noch einmal auf die Wiese zu. Inzwischen war aber der rettende Wald erreicht; wir warfen uns mit zitternden Knien auf den Boden, minutenlang unfähig, auch nur einen Ton von uns zu geben. Betreten und immer noch vor Angst schlotternd, schlichen wir nach Hause. Man verabredete, nichts von dem Vorfall zu erzählen. Ich, um der Mutter nicht noch nachträglich Angst einzujagen. Mein Spielkamerad befürchtete Prügel wegen Herumtreibens bei „akuter Luftgefahr“.
Die Geschwister Horn, von den beiden Kindern Tante Edith und Tante Martha genannt, bildeten ein etwas altjüngferliches, aber liebevolles Paar. Edith war die Fröhlichere von beiden. Martha meist leicht fröstelnd, mit häufig laufender Nase und unvermeidlicher Wolljacke nebst Schal ausstaffiert. Sie vermittelte immer einen Hauch von Autorität ausstrahlender Unnahbarkeit. Die Ernährung, den allgemeinen Umständen entsprechend recht spartanisch, wurde zusätzlich durch eine kräftige Prise naturverbundenen Gedankengutes angereichert. Neben Kathreiner spielten verschiedenste Teeaufgüsse und die Lehre des Sebastian Kneipp eine oft gerühmte und auch praktizierte Rolle im Tagesverlauf. Auf der lausig kalten Toilette baumelten an gebogenem Draht, sorgsam in handliche Quadrate geschnitten, ältere Ausgaben des „Murrhardter Boten“. Gelegentlich, etwas weniger benutzerfreundlich, auch Werbebroschüren auf Hochglanzpapier aus dem Laden. Daneben gemahnte ein Plakat mit der Aufschrift „Schließlich tuet jeder klug, wenn er wieder füllt den Krug“ für rechtzeitigen Wassernachschub nach Erledigung eines umfangreicheren Geschäftes Sorge zu tragen. Woraus sich ergibt, dass es sich bei der vorhandenen Toilette um einen fortschrittlichen Donnerbalken handelte, bei der Abfallgrube und Toilettenschüssel durch einen mit Handgriff zu betätigenden Metalldeckel getrennt war. Das garantierte, insbesondere in der wärmeren Jahreszeit, eine als durchaus angenehm empfundene Verringerung der Geruchsbelästigung.
Nach dem recht regelmäßig praktizierten sonntäglichen Kirchgang in der nahe gelegenen schönen alten romanischen Walterichskapelle galt es, die im Laden eingesammelten, in Pappkartons aufbewahrten Abschnitte der Lebensmittelkarten getrennt nach Nahrungsmittel mit Kleister zu bepinseln und auf Papier zu kleben. Die Abgabe dieser Bögen im Rathaus war Voraussetzung für den Lebensmittelnachschub im Laden.