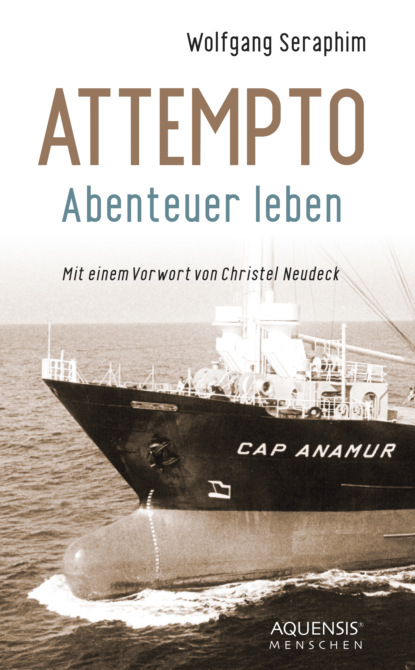- -
- 100%
- +

Es ließ sich wohl nicht vermeiden, dass eines Tages meine Anmeldung in der gegenüberliegenden Schule nicht länger zu umgehen war. Nach eingehender Ermahnung zu Fleiß und Gehorsam übergab mich die Mutter hoffnungsvoll an der Klassenzimmertüre einer Lehrerin, die gerade einen Aufsatz schreiben ließ. Das Thema prangte in großen Druckbuchstaben an der Tafel: „Wie schüre ich meinen Ofen?“ Inzwischen hatte ich zwar schon etwas intensivere Einblicke in die ortsübliche Sprache gewonnen, aber „schüren“ war mir noch nicht begegnet. Immerhin reichte der Grips schon so weit, um sich auszurechnen, dass es sich dabei wohl um das Anfeuern des Ofens handeln müsse. Was sollte man sonst auch schon mit einem Ofen, schulaufsatztauglich betrachtet, anderes anstellen?
Ob meine Ausführungen vor der Lehrerin Gnade fanden, war später nicht mehr erinnerlich. Wohl aber der zusätzliche Sprachgewinn bei der Tage darauf erfolgten Rückgabe der Aufsätze. Hier erschloss sich mir erstmals, dass „Spächtele“ aus in Kleinstteilen zerlegten Holzscheiten gewonnen werden, und was in Schlesien raucht in Schwaben „ruaselet“. Wie auch immer: Hochdeutsch war offensichtlich nicht das bevorzugte Idiom dieser Stätte kindlicher Wissensvermittlung … Mir sollte es recht sein: Auf diese Weise beschleunigte sich die sprachliche Integration des Kindes mit Migrationshintergrund, wie man dies, medientauglich-geschliffen, später einmal formulieren würde. Auch das zwischenmenschliche Miteinander gedieh prächtig – Kinder sind sehr flexibel, wenn man sie nur lässt.
Schräg hinter der Schule stand eine Baracke, in der – es muss wohl Anfang März 1945 gewesen sein – ein Trupp amerikanischer Kriegsgefangener untergebracht war. Bewacht von einigen deutschen Angehörigen des Volkssturms. Deutschlands verzweifeltes letztes Aufgebot an Rentnern, Asthmatikern und sonstigen nicht mehr wehrtauglichen Rettern des „Großdeutschen Reiches“. Die Bewachten fielen durch ihre hervorragende Ausrüstung auf: Die Schuhe mit hohen Profilsohlen und aus widerstandsfähigem Leder bildeten einen grotesken Kontrast zum ärmlichen Schuhwerk ihrer Bewacher. Es war auf den ersten Blick erkennbar: Das war eine Qualität, von der der deutsche Volksgenosse nur träumen konnte. Sie lagen meist in einer weit geöffneten Tür, die einem überdimensionalen Garagentor ähnelte, und blinzelten mit seltsamen permanenten Kaubewegungen, die verdächtig an Kühe auf der Weide erinnerten, in die ersten Strahlen der Frühjahrssonne. Sie sahen sehr gelassen in ihre Zukunft. Allen war klar: Es war nur eine Frage von kurzer Dauer, bis aus den Bewachten Bewacher werden würden. Hier sah ich auch zum ersten Mal Menschen schwarzer Hautfarbe leibhaftig vor mir. Das Rätsel mahlender Kaubewegungen sollte sich erst später lüften.

Etwa zu gleicher Zeit tauchte, wie Zieten aus dem Busch, auch der ältere Bruder auf, womit so schnell niemand gerechnet hatte. Gebannt lauschte ich den Schilderungen über seine Odyssee als Flakhelfer in Breslau zum sicheren Murrhardt. Er hatte wirklich mehr Glück als Verstand. Die meisten Mitschüler seiner Klasse waren ebenfalls zu den Flakhelfern nach Breslau abkommandiert worden. Er mit Abstand der kleinste und schmächtigste von allen. Es sollte seine Rettung werden. Eines Tages baute sich der Kompaniechef beim Morgenappell vor ihm auf und sagte: „Mensch, du bist ja so klein, dass du nicht mal über den Schützengraben rausgucken kannst, da brauchen wir ja eine extra Leiter für dich. Du bist uns hier nur im Weg, sieh dass du heimkommst zu Muttern!“ Sprach’s und stellte ihm einen vorläufigen Entlassungsschein nach Leipzig aus. Dort meldete er sich als Deutschlands letzte Wunderwaffe im Aufgebot gegen den Volksfeind auch brav auf der Ortskommandantur. Ein zufällig anwesender Feldwebel nahm sich seiner dankbar an: „Du kommst gerade recht, wir stellen eben eine Einheit zusammen, die an die Ostfront verlegt wird.“ In diesem Augenblick klingelt das Telefon. Der Feldwebel, den Hörer am Ohr, schlägt die Hacken zusammen: „Jawohl Herr Major, komme sofort Herr Major!“, wirft den Hörer auf die Gabel und befiehlt beim Verlassen des Zimmers barsch: „Du wartest hier!“ Kurz darauf betritt ein Hauptmann das Zimmer; er betrachtet den Dreikäsehoch in Uniform ausgiebig von oben bis unten: „Was in aller Welt willst du denn hier?“ „Ich soll an die Ostfront verlegt werden, Herr Hauptmann.“ Der Offizier lässt sich auf den Stuhl hinter dem Schreibtisch fallen. „Du lieber Himmel, jetzt sollen wir schon mit Kindern den Krieg gewinnen! Wo steckt denn die Familie?“ Minuten später verlässt der Bruder mit einem Entlassungsschein nach Stuttgart in Windeseile die Kommandantur, ehe es sich irgendein Endsieg-Enthusiast noch einmal anders überlegen könnte. Breslau war inzwischen zur Festung erklärt worden. Von allen Schulkameraden, letztendlich ja alles noch Kinder wie er, sollte keiner überleben. Sie waren einfach ein paar Zentimeter zu groß …
Natürlich kannte der Jubel in Murrhardt keine Grenzen. Die Mutter war in Tränen aufgelöst; erst ganz allmählich wich die Anspannung der letzten Monate: Nur nicht neben dem Mann auch noch den Sohn im Krieg verlieren!
Ende April schlugen auch in Murrhardt die letzten Stunden des Großdeutschen Reiches. Die Amerikaner näherten sich dem kleinen Städtchen – eigentlich ja nur eine zu vernachlässigende Randerscheinung ihres schnellen Vormarsches. Unglücklicherweise lagen aber in den Wäldern um die Stadt versprengte Einheiten der Waffen-SS. In heroischer Nacht- und Nebelaktion sprengten sie ein wenige Meter langes Brückchen, das über die Murr führte. Dieses Rinnsal war eigentlich das ganze Jahr über bequem auch zu Fuß zu durchwaten, ohne dass das Wasser die Knöchel nennenswert überspült hätte. Kurzum, die strategische Bedeutung dieses Brückchens nebst Bach stand in keinerlei Verhältnis zu der Hingabe, mit der sich die SS dieser absurden „Verteidigungsmaßnahme“ annahm. Dafür fiel die Antwort der Amerikaner für Murrhardt umso drastischer aus: Das Städtchen wurde mit Brandgranaten beschossen. Währenddessen saß die Familie nebst den Geschwistern Horn bei Kerzenlicht im Keller und zuckte bei jedem Granateneinschlag zusammen. Es war das ungute Gefühl, völlig machtlos dem ausgesetzt zu sein, was da von draußen jeden Moment auf jeden einzelnen zukommen könnte: Qualvolles Leiden, schneller Tod oder nichts von allem? Nach einigen Stunden ließ der Beschuss nach, verebbte schließlich ganz. Der Bruder hatte sich nach draußen gewagt und kam bald mit der Nachricht zurück: Murrhardt brennt. Löschversuche hatte er nicht beobachtet. Man entschloss sich umgehend, noch in der Nacht mit dem nötigsten Gepäck hinauf in den kleinen bäuerlichen Weiler Waltersberg, oberhalb Murrhardt, zu begeben. Die Geschwister Horn kannten dort einen Bauern, der ihnen schon in der Vergangenheit mit seinen landwirtschaftlichen Produkten immer wieder ausgeholfen hatte, wenn ihr Lebensmittelkartendeputat erschöpft war. Diese Flucht in der Nacht mit Blick zurück auf das lichterloh brennende Murrhardt mit krachend einstürzenden Dachgiebeln und grell in den Nachthimmel aufschießenden Flammen und Funkenregen war ebenso unvergesslich wie der beißende Gestank nach verbranntem Holz, der in dichter Wolke über dem Städtchen hing. All das war so schaurig faszinierend, dass die Mutter die Kinder immer wieder antreiben musste, nicht stehen zu bleiben. Als Jahre später im Geschichtsunterricht der von Nero angezettelte Brand von Rom erörtert wurde, kam ich nicht umhin, in Erinnerung an die nächtlichen Bilder vom Brand in Murrhardt, diesem Despoten ein beachtliches Maß an Sinn für schaurig schöne Inszenierungen zuzubilligen.
Am nächsten Morgen sah man von Waltersberg aus immer noch den Rauch über der Stadt im Tal. Die Amerikaner waren rasch weitergezogen, man ging wieder zurück in das praktisch unbeschädigte Haus am Markt. Nur ein vom Granatsplitter durchbohrtes Eisenblech an der Eingangstüre zum Wohntrakt war am Haus selbst wie ein Wundmal von den Ereignissen der vergangenen vierundzwanzig Stunden zurückgeblieben. Wenige Meter vom Haus entfernt, auf der Seite zur Schule, riss eine Granate einen tiefen Trichter auf und einige Häuser am Markt waren bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es herrschte eine gespenstische Stille, allerdings nur von kurzer Dauer. Die Amerikaner waren bis auf einige wenige verbliebene Posten abgezogen. Ihnen folgten Franzosen, sogenannte De Gaulle’sche Vergeltungstruppen, die sich zunächst über die restlichen Weinvorräte im Städtchen, dann – von Siegesrausch und Alkohol beflügelt – vereinzelt auch über einige Frauen der Bevölkerung hermachten. Dabei hatten die Gastwirte, in weiser Voraussicht, schon Tage zuvor, die meisten Weinvorräte kostenlos an die Murrhardter ausgeschenkt. Noch gut in Erinnerung, dass ich mehrmals mit einer Milchkanne bewaffnet, beim Gasthaus „Zum Engel“ am Marktplatz auf Anweisung der Geschwister Horn zwecks Unterstützung der Alkoholvernichtung aufgekreuzt bin. Damals allerdings noch unfähig, diese großzügige Spende gebührend zu würdigen: Das Gebräu schmeckte furchtbar! Den Geschwistern Horn war das um weitere Ingredienzien wie Honig und Nelken angereicherte Naturprodukt, leicht erhitzt im Sinne einer Art Glühwein, als Hausmittel sehr willkommen.
Die Herren aus Frankreich erwiesen sich zunächst nicht sehr chevalresque. Sie begannen zu plündern und vereinzelt in unsinniger Zerstörungswut Möbel aus den unbeschädigt gebliebenen Häusern auf die Straße zu werfen. Die ältere Schwester auf dem Dachboden zu verstecken erschien unter diesen Gegebenheiten keine übertriebene Vorsichtsmaßnahme. Kurz darauf betraten auch schon einige französische Offiziere das Haus und erklärten die Wohnräume im Erdgeschoss für beschlagnahmt: Rekrutiert für eine Art Ortskommandantur. Man wusste die wenigen Französischbrocken, die der ältere Bruder aus dem Gymnasium herübergerettet hatte, durchaus zu schätzen. Dass er einmal als Soldat eingezogen worden war, kam ihnen gar nicht in den Sinn: Sie mussten sich ja geradezu zu ihm herunterbücken, wenn sie ihre Hand auf seinen Kopf legen wollten. Die Einquartierung erwies sich bald in mehrfacher Hinsicht als vorteilhaft. Jetzt waren Haus und Laden vor Plünderungen sicher. Eine kleine, an die Hausecke gemalte Trikolore diente als Zeichen des Sonderstatus, den das Haus ab sofort genoss. Nach wenigen Tagen hatten sich alte und neue Bewohner bei „Horn am Markt“ soweit aneinander gewöhnt, dass sich der Umgang zunehmend freundlicher gestaltete. Neben einigen Schokoriegeln wechselte ein ganzes Päckchen Kaugummi den Besitzer. Damit lüftete sich endlich das Rätsel um die dem Hornvieh ähnelnden permanenten Kaubewegungen, die ich Tage zuvor bei den gefangen genommenen Amerikanern noch nicht einzuordnen wusste.
Solch sich behutsam entwickelnden zarten Triebe erster Völkerverständigung zwischen Siegern und Besiegten ließen den Entschluss reifen, das Mädchenversteck aufzugeben. Dies natürlich nicht ohne ausgiebige verbale Vorbereitung. Die Offiziere fanden das alles sehr lustig, als die Schwester aus der Versenkung auftauchte und man war natürlich froh, dass sie das Versteckspiel nicht übel nahmen.

Eines Tages fuhr vor dem Hotel „Sonne-Post“ eine stattliche Anzahl von Nobelkarossen mit Mercedes-Stern auf der Kühlerhaube vor. Zum damaligen Zeitpunkt ein an Zahl und Glanz höchst ungewöhnlicher Aufmarsch deutscher Präzisionsarbeit. So drückten sich alsbald zahlreiche Kindernasen an deren Autoscheiben platt. Es sollten viele Monate vergehen, bis die Öffentlichkeit erfuhr, dass damals – mit Einverständnis der Alliierten – einige kluge deutsche Köpfe hier zusammentrafen, um die Grundzüge der neuen Verfassung des Landes Württemberg auszuarbeiten. Unter ihnen neben Carlo Schmid auch ein junger Mann namens Huber. Später Landrat des Ostalbkreises. Ich besuchte ihn kurz vor seinem Tod im Aalener Krankenhaus. Es gelang, dem müden alten Mann noch ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, als die Rede dies historische Ereignis streifte. Eine kleine Messingtafel erinnert an jenem Haus in Murrhardt an diese für das Land Württemberg historisch bedeutsame Zusammenkunft.
Die „Sonne-Post“ war damals aus noch ganz anderen Gründen bedeutsam. Es war der einzige Gasthof weit und breit, in dem zu jener Zeit wenigstens ab und zu – auf Lebensmittelmarken versteht sich – einigermaßen preiswert eine Mahlzeit eingenommen werden konnte, die diesen Namen ehrlich verdiente. Das heißt, es gab dort eine Bratwurst, die zwar höchstens zu etwa zehn Prozent aus Wurst bestand, aber die restlichen neunzig Prozent Brot, Kartoffeln und Quark waren so hervorragend gewürzt, dass man mindestens eine halbe Stunde anstehen musste, ehe man in der Gaststube einen Platz eroberte, um diesem Wunder schwäbischen Erfindungsgeistes die Ehre erweisen zu können. Es lag in der Natur damaliger Rationierungszwänge, dass dieses Bratwurst-Event beileibe nicht täglich und wenn, dann auch nur zeitlich sehr begrenzt zelebriert werden konnte. Da fügte es sich glücklich, den gleichaltrigen jüngeren Sohn des Wirtes als Spielkameraden zu haben. Es garantierte einen nicht zu unterschätzenden Informationsvorsprung bezüglich der Speisekarte. Beide Söhne dieses Wirtes namens Bofinger blieben in der Tradition der Familie und bewirtschafteten später im Neubau einen ganz hervorragenden, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Landgasthof. In diesem, aber auch schon zuvor im alten Gasthof, beobachtete ich gelegentlich einen Herrn namens Hans Bayer, wie er gemütlich vor einem Glas Rotwein sitzend, eifrig und gelegentlich schmunzelnd, mit einem Bleistift Notizen zu Papier brachte. Als seltsame Marotte war dessen Stammplatz regelmäßig durch eine bunte Kordel isoliert von jedweder Nachbarschaft abgegrenzt. In kindlicher Unbekümmertheit sprach ich die alte Frau Bofinger hinter der Theke auf dieses Kuriosum an. Noch heute präsent, der aus ihrem Dirndl wogende gewaltige Busen der alten Dame, als sie sich zu mir herunterbeugte, um zu erklären: „Bua, des verstoscht du net – der schreibt für Deutschland!“ Nun war ich um einen feuchten Traum reicher, aber, die Kordel betreffend, arm an Erkenntnis wie zuvor. Bekannt wurde der so sorgsam Eingehegte unter seinem Künstlernamen Thaddäus Troll. Mit unnachahmlich trockenem schwäbischem Humor schuf er so wunderbare Bücher wie „Deutschland, deine Schwaben“ oder „Der Entaklemmer“. Humorist und Clown haben nicht selten gemeinsam, dass es in ihrem Inneren gar nicht so lustig aussieht wie man vermuten möchte. Das galt auch für diesen Literaten, der als Nationalsozialist sich später nie verziehen hat, diesem Ungeist mutig entgegengetreten zu sein. Ihn plagten furchtbare Depressionen. Da sich Antidepressiva nicht mit Alkohol vertrugen, verbot ihm seine Ärztin den regelmäßigen Schoppen Rotwein. Am 5. 7. 1980 setzte sich dieses Denkmal deutscher Literatur mit einer Überdosis Schlaftabletten selbst ein Ende. Keiner hat den Schwaben, scharf beobachtend, bissig formuliert mit so viel Herz eingewickelt porträtiert wie er. In seinem Abschiedsbrief bat er, statt um Blumen oder Nachrufe, um eine Spende für „Pro Asyl“. Auf dem Sitzplatz hinter der Kordel in der „Sonne-Post“ zu Murrhardt war ich einem Mensch begegnet, von dem ich nicht ahnen konnte, wie viel uns im Geist miteinander verband. Ein Geist, der Jahrzehnte später Europa und teilweise auch meine geliebten Schwaben spalten sollte. „Arschlöcher gibt’s überall!“ wäre vermutlich sein freimütiger Kommentar dazu gewesen.
Obwohl sich 1945 die Versorgung mit Lebensmitteln in diesen ländlichen Regionen ungleich unproblematischer gestaltete als in den Großstädten, war auch im Hause „Horn am Markt“ diesbezüglich die Situation alles andere als rosig. Die Ankunft des Bruders verschärfte das Problem. Es bot sich deshalb an, den vielköpfigen Neuzugang dort unterzubringen, wo man in der Nacht des Feuerüberfalls schon einmal Zuflucht gefunden hatte: beim Bauern Bay in Waltersberg. Dieser stimmte zu und damit begannen für mich so etwas wie wie Ferien auf dem Bauernhof.
Ferien auf dem Bauernhof
„Zur rechten Zeit am rechten Ort, das schützt vor Hunger, Kälte, Mord“
Alte Spruchweisheit
Es war ein florierender Hof mit Kühen, Ochsen, Schweinen, Hühnern, Gänsen und sogar einer bescheidenen Nutriazucht in einem kleinen See hinter dem Wohnhaus. Technische Gerätschaften beschränkten sich ausschließlich neben Pflug und Egge auf einen Traktor, der sich aber gut in Schuss präsentierte – in damaliger Zeit eher ungewöhnlich. Dennoch verließ man sich bei der Fahrt auf die nicht weit voneinander entfernten Felder lieber auf die biologische Zugmaschine in Gestalt des Ochsens Herrmann. Ein Prachtexemplar von einem Tier, der alle anderen Vierbeiner im Stall an Größe deutlich überragte und gleichermaßen bedächtig, gutmütig sowie zuverlässig alle ihm gestellten Aufgaben erledigte. Herrmann hatte im Laufe seines Ochsendaseins gelernt mitzudenken. Er war in der Lage, ohne besondere Dienstanweisung aus seinem Erfahrungsschatz abzurufen, was von ihm erwartet wurde. Klapperten zum Beispiel die Milchkannen beim Aufladen hinter ihm auf dem Wagen, setzte er sich automatisch nach einem kurzen „Hüscht!“ in Richtung Murrhardt in Bewegung. Es bedurfte dann keiner weiteren Anweisungen. Er trottete quasi im Alleingang zielsicher rechts oder links abbiegend bis vor die ca. drei Kilometer entfernte Milchsammelstelle, wo er an der Rampe stehen blieb, um geduldig das Abladen der Kannen abzuwarten. Nach erneutem „Hüscht!“ trat er ebenso gewissenhaft wieder gemächlich den Heimweg an. Das war eine Beschäftigung so recht nach meinem Herzen: Hinten auf dem Wagen sitzen, still vor sich hin träumend mit dem Gefühl, zu etwas nutze zu sein. In diesen Zeiten aufregender Veränderungen ein Hort der Ruhe und Entspannung – die unverhoffte Win-Win-Situation schlechthin.
Insgesamt war aber für Erwachsene die Arbeit hart und anstrengend. Die Bäuerin heizte spätestens morgens um fünf Uhr den Herd in der Küche an, setzte einen Topf mit Kartoffeln auf und begab sich zum Melken der Kühe in den Stall. Wenn sie mit einem Eimer frischer, noch warmer Milch zurückkam, waren die Kartoffeln gekocht, alle anderen hatten mittlerweile um den Küchentisch Platz genommen. Eine Prise Salz auf dem Teller verhalf der ungeschälten Kartoffel in der Hand zu zusätzlichem Geschmack. Dazu trank man die noch warme Milch aus großen Bechern. Es ging meist sehr schweigsam zu, in dieser Morgenstunde. Ich empfand das tägliche Ritual als ausgesprochen wohltuend. Vergleichbar mit einer Art Morgenandacht, als Einstimmung auf die vor mir liegende Arbeit. Eine schweigende Gemeinschaft, in der sich alle noch einmal darauf besannen, was der Bauer am Abend zuvor beim Nachtmahl für den kommenden Tag an Arbeit vorgegeben hatte.
Nach dem Melken und Füttern der Kühe ging es mit dem Wagen hinaus zur Feldarbeit. Im Morgentau lässt sich das Gras besser mähen als in den Mittagsstunden. Ich lernte schnell den Umgang mit der Sense, war aber doch vorwiegend dafür verantwortlich, dass der vergorene Most in den mitgeführten Zinnkannen immer schön im kühlen Schatten lag. Das Vesper in Form von Speck, selbst gemachter Butter, Käse und im Holzofen gebackenem Brot, stand stets zur allgemeinen Verfügung. Man könnte auch sagen: Ich war für die Futterage zuständig. Essen wie Trinken und Wolfgang, eine lebenslänglich verlässliche Liaison. Garant für eine sichere Bank, die Leib und Seele zusammenhält. Die orale Phase, kein auf kindliches Daumenlutschen begrenztes Event. Bedenkt man, dass die Schule auf unbestimmte Zeit ihre Tore geschlossen hatte, wird nachvollziehbar, warum ich mich im Gras auf dem Rücken liegend und den blauen Himmel betrachtend, wie im Paradies fühlte. Genieße froh die Tage, des Lebens holde Gunst – auch wohldosierte Faulheit ist ein Stück Lebenskunst. Was für eine Insel der Seligen inmitten eines Ozeans von Zerstörung, Mangel, Leid und Verzweiflung! Getreu dem Motto, die Dosis macht das Gift, griff ich auch dann und wann zum Rechen, um das Gras zu wenden, oder mich sonst nützlich zu machen. Am späten Vormittag verließ die Bäuerin das Feld, um das Mittagessen vorzubereiten: Häufig mit Gurken angereicherter Kartoffelsalat, kaltem Braten, selbst gemachter Wurst oder Fleisch in Dosen aus eigener Schlachtung; manchmal aber auch nur eine Rinderbrühe mit abgeschmälzten Zwiebeln, Kartoffeln oder altbackenem Brot. Obligatorisch aber der sonntägliche Hühnerbraten mit Spätzle, der für Schwaben unvermeidlichen Soße und grünem Salat. Letzterer ebenso wie Bohnen, Tomaten, Kohl, Kartoffeln und Küchenkräuter aus eigenem Anbau. Es war das reinste Schlaraffenland ohne Lebensmittelkarten. Obendrein lieferten die zahlreichen Streuobstwiesen nicht nur Obst für den täglichen Gebrauch und zum Einmachen. Viel wurde zu Obstschnaps gebrannt, der dem Bauern zu einem schwunghaften Tauschhandel mit den französischen Besatzern verhalf. Im Gegenzug gab es Bohnenkaffee, Schokolade, Orangen, Bananen. Dinge, die ich bisher vorwiegend aus Bilderbüchern kannte.
Immer wieder klopften ausgehungerte Gestalten an die Tür; sie hofften – leider oft vergeblich – auch einen Zipfel von diesem Paradies zu erhaschen. Bevorzugtes Tauschangebot waren Teppiche, von denen der Bauer schon in kurzer Zeit so viel entgegengenommen hatte, dass er mit ihnen auch noch den Kuhstall hätte auslegen können. Erstaunlich früh dämmerte dem Achtjährigen: Zur rechten Zeit am rechten Ort, das schützt vor Hunger, Kälte, Mord.
Trotz des längeren Weges bestand die Mutter auf regelmäßig sonntäglichem Kirchgang. Anschließend trieb ich mich gerne noch ein bisschen in Murrhardt herum, während der Rest der Familie den Geschwistern Horn einen kurzen Besuch abstattete. Der Rückweg nach Waltersberg wurde deshalb oft getrennt angetreten. Dabei benutzte man einen abkürzenden Fußweg durch den Wald. So auch ich an einem sonnigen Spätvormittag, als rechts von mir, hinter dichtem Gebüsch, unvermittelt lautes Stöhnen drang, das in seufzendes Röcheln überging. Vor Schreck gelähmt blieb ich wie angewurzelt stehen. In meiner Phantasie sah ich einen von mörderischer Hand dahingestreckten, bedauernswerten Menschen in seinem Blute schwimmen. Alles gleichermaßen überraschend wie Furcht einflößend. Der erste Reflex stellte das Signal auf sofortige Flucht – doch es überwog die kindliche Neugier. Auf Zehenspitzen näherte ich mich dem Gebüsch und schob so geräuschlos wie möglich die Zweige auseinander. Da stand in all seiner Pracht, nackt wie Gott ihn schuf, ein Mann mittleren Alters inmitten eines riesigen Ameisenhaufens. Er machte Anstalten, auch noch sein Gesäß nebst Zubehör ungeschützt in den Bau der in ihrer Ruhe aufgescheuchten Tierchen zu versenken. Ich hatte genug gesehen. Es konnte sich nur um einen Geisteskranken handeln, der allerdings einem anderen Bauern aus Waltersberg sehr ähnlich sah. So schnell meine Füße trugen, hastete ich nach Hause und berichtete von meinem Abenteuer im Walde. „Des ka bloß der Anton von gegaüber gwä sei. Der jommert doch älleweil wega seim Rheuma,“ wurde ich beschieden. So wandelte sich der Geisteskranke in einen vom Schmerz geplagten Naturheilkundigen, der sich seine Ameisensäure direkt vom Erzeuger abholte. Die Schwierigkeiten beim Erwerb von Linderung versprechenden Substanzen standen damals denen der Lebensmittelbeschaffung in nichts nach….
Der enge Kontakt mit der Natur und ihren Produkten, bot noch viel Abenteuer mit bisher Unbekanntem. Beim Schlachttag im Herbst tat mir das dafür auserkorene Schwein leid und bei seiner Tötung wollte ich keinesfalls zusehen. Die anschließende Verarbeitung verschaffte neue Eindrücke in die Anatomie. Staunend lernte ich, dass es beinahe nichts gab, was an diesem nützlichen Tier nicht zu verwerten war. Bauchspeck und Würste nahmen sich auf dem frisch gekochten Sauerkraut ganz allerliebst aus und schmeichelten dem Gaumen ungemein. In unbewachtem Augenblick gelang mir ein kräftiger Schluck aus der mit Obstler gefüllten Flasche. Ein erster Einblick in die verdauungsfördernde Eigenschaft dieses Wässerchens, das zusätzlich rote Bäckchen und allgemeine Fröhlichkeit schenkend, mir wie eine Allzweckwaffe vom lieben Gott erschien. Tage zuvor war bei der Kartoffelernte die geschmackliche Qualität der ersten, in der Glut auf freiem Feld gegarten Kartoffeln getestet worden. Eine völlig neue Welt! In ihrer Unbekümmertheit noch einmal vergleichbar mit einem Blick zurück, auf die für mich gleichermaßen glückliche Freystädter Kindheit.