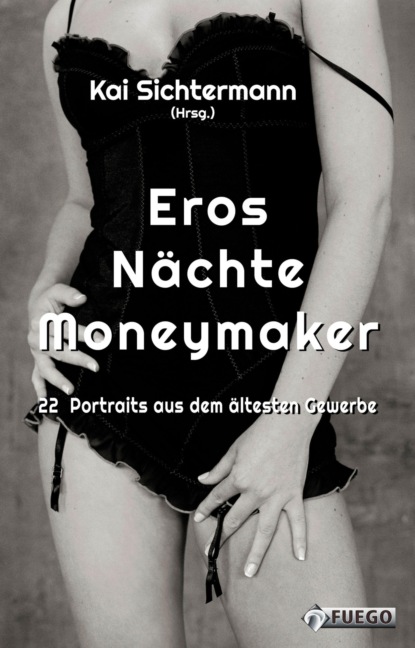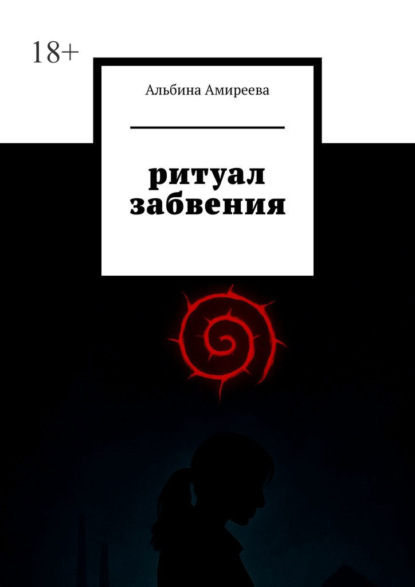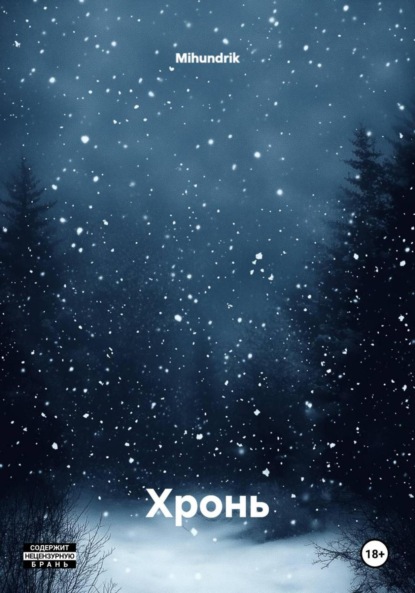- -
- 100%
- +
Interessanterweise ist dieser Stoff literarisch und auch musikalisch bearbeitet worden. Der Lyriker Börris Freiherr von Münchhausen hat 1898 einige Bilder für Rahabs Lied dem Hohenlied entnommen. Jojada ist hier der Kundschafter:
Mein Freund ist wie ein Büschel Myrrhen,
Das zwischen meinen Brüsten hängt,
In meiner Seele letzte Tiefen
Sich Tag und Nacht sein Name drängt,
Und blind bin ich, seit ich ihn sah,
Jojada, Jojada!
Sein Arm lag unter meinem Haupte,
Die rechte Hand liebkoste mich,
Die Palmenstadt schlief rings im Tale,
Und süß ihr Atem uns umstrich,
Der Himmel war so nah, so nah,-
Jojada, Jojada!
Doch über meiner Seele Saiten
Schrillt jäh ein Ton, zerrissen, wild,
Vom Himmel fallen alle Sterne,
Und Blut aus allen Wolken quillt:
Mein Vaterland verriet ich ja,
Jojada, Jojada!
Verflogner Duft der Palmen
Strich her von irgendwo. –
Tot hing am roten Seile
Rahab von Jericho.
Ein bayerischer Opernkomponist hat diesen Stoff Anfang des 20. Jahrhunderts für die Oper entdeckt. Es war Clemens Freiherr von Franckenstein, der in dieser Zeit auch Intendant der bayerischen Staatsoper in München war. Die Oper selbst wurde 1911 fertiggestellt. Das Libretto stammt von Oskar F. Mayer, der daraus eine Liebesgeschichte entwickelte. Der Kundschafter heißt in dieser Geschichte Hiram. Er wird von den königlichen Soldaten entdeckt und gejagt, bis er blutbespritzt vom Kampf ins Haus der Rahab kommt. Viel Zeit für Erklärungen gibt es nicht, also versteckt Rahab den Kundschafter in ihrem Schlafgemach. Soldaten rücken an und durchsuchen das gesamte Haus. Das Schlafgemach verteidigt Rahab mit einem Messer in der Hand. Die Soldaten lassen von ihr ab. Sie wollen kein Blutvergießen provozieren, denn sie wissen von Rahabs einflussreichen Beziehungen. Nachdem die Soldaten verschwunden sind, öffnen die Sklavinnen, wie sie in der Oper genannt werden, dem Kundschafter Hiram die Tür, sodass er aus dem Versteck heraustreten kann. Er geht auf Rahab zu, die ihm ihre Zuneigung gesteht. Ihre Sklavin Nahalal allerdings will Rahab davon abbringen, sich mit dem fremden Kundschafter einzulassen. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung, bei der Rahab ihre Sklavin aus Liebe zu Hiram, der sonst verraten wäre, ersticht. Hiram ist beeindruckt. Immerhin wurde er von einer Frau gerettet, deren Stadt er ohne Rücksicht auf Verluste einnehmen wollte. Die Oper endet in dem Moment, als der Kundschafter seinen Gott ruft, um ihn um Schonung zu bitten, für ihn selbst, für Rahab und für ihre Familie. Hier bleibt das Ende offen.
Matthäus schreibt im Neuen Testament, dass Rahab später einen hochrangigen Fürsten aus dem Stamme Juda geheiratet und ihm den Sohn Boas geboren hatte. Dadurch ist sie in den Stammbaum Jesu hineingekommen und ihr voriges Sündenleben war vergeben. Matthäus stellt hier eine Rahab vor, die durch ihren Glauben einen Neuanfang macht: Sie ist nicht mehr die Dirne Rahab, sondern die Mutter Rahab, die Mutter von Boas.
von Sema Binia
Quellen:
Ruth Lapide, „Biblische Gestalten - Rahab, die Dirne von Jericho”, Gespräch mit Walter Flemmer, Bayerischer Rundfunk, München 2001
Volkhard Spitzer, „Die ganze Wahrheit über die Hure Rahab”, Predigt in Bibel-TV, Hamburg 2010
Magda Motté, „Esthers Tränen, Judiths Tapferkeit. Biblische Frauen in der Literatur des 20. Jahrhunderts”, Darmstadt 2003
CID - christliche internet dienst GmbH, Berlin, Website: http://bibel-online.net
Georg Fohrer, „Zürcher Bibelkommentare. Das Buch Jesaja”, Band 2, Zürich-Stuttgart 1966
Frank Hossfeld, Erich Zenger, „Die neue Echter-Bibel. Kommentar zum Alten Testament mit Einheitsübersetzung” Würzburg 1993
Ambapali
Buddhas Mango - Eine freie Unternehmerin
Es war so etwa im Jahre 495 vor unserer Zeitrechnung in der Stadt Vesali in einem Land im Nordosten Indiens, dem heutigen Bihar, das von der Adelsfamilie namens Licchavi beherrscht wurde, als ein Gärtner sein Tagewerk im königlichen Park beendet und seinen Heimweg über eine schmale Brücke nimmt, an einem Mangobaum vorbei. Sein Herz ist schwer, gerade ist ihm und seiner Frau ein spät geborener Sohn gestorben. Da hört er ein Wimmern, und ja, da liegt doch etwas unter dem Mangobaum, es bewegt sich. Es ist ein Neugeborenes in ein Tuch gehüllt. Sollten die Götter ihm ...? Er lupft das Tuch – ein Mädchen. Mädchen wirft man in den Fluss. Die Kleine öffnet die Augen, sie quietscht. Er nimmt sie mit nach Hause und legt sie der Frau in den Arm. “Ein Mädchen – auch das noch, wo hast du sie gefunden?“ „Unterm Mangobaum.“ Da lächelt der Winzling. Sie seufzt und legt das Baby an die Brust, sie hat noch keine Tochter aufgezogen. „Wir werden sie Ambapali (das heißt Mangoblatt) nennen.“
Es war schon über 1000 Jahre her, dass die Arier von Norden in die Indusgegend eingedrungen waren, sich dann weiter östlich und südlich ausgebreitet und die alten Kulturen verdrängt hatten, die womöglich eine Göttin verehrt und vielleicht auch Frauen einen würdigen Platz in der Gesellschaft zugestanden hatten. Sollte das je der Fall gewesen sein, so wusste das nun niemand mehr. Zur Zeit der Licchavi hatte die Aufteilung der Menschen in hierarchisch gegliederte Kasten schon lange Einzug gehalten, und wenngleich dieses System noch nicht derart verfestigt war wie heute, so machte es doch die Gesellschaft undurchlässig und wertete Frauen ab. Mädchen waren eine Last. Es ist dieselbe Zeit, in der ein alter Mann mit einer Schar von Mönchen durch die Lande zieht, der einst als Prinz Siddharta Gautama gelebt hatte und zurzeit von Ambapalis Geburt schon weithin bekannt ist als der Erwachte, der Buddha.
Die Findeltochter wird dem Gärtnerehepaar viel Freude machen. Sie ist früh aufgeweckt und bewegt sich graziös, sie ist gehorsam und doch eigenwillig, dabei immer freundlich und gutherzig. Ein hübsches Kind ist sie und nach ein paar Jahren geht ein wunderschönes junges Mädchen mit dem Vater durch die königlichen Anlagen und wird gesehen. Die Eltern halten die wissbegierige Tochter nahe am Haus. Sie spürt, dass sie besonders ist, nicht nur ihre Anmut zeichnet sie aus, sie weiß auch, sie ist klüger als ihre Eltern und Brüder und als jeder Mann, dem sie begegnet ist. Die jungen Prinzen stellen ihr nach, Höflinge versuchen, sie zu verlocken. Es wird geredet. Die Eltern hören mit Schrecken von Krach und Streit im Palast. Es geht um ihr Mangomädchen, jeder will sie haben – aber nicht als Ehefrau, versteht sich. Müssen sie schon einen Ehemann für sie suchen, um sie in Sicherheit zu bringen? Sie ist doch erst zwölf oder 13 Jahre alt und sie möchten sie gern noch um sich haben. Da kommt aus dem Palast ein hoher Beamter zum Haus des Gärtners und macht einen Vorschlag: Ambapali solle Ganika werden – ob dieser Name für eine geachtete Edelkurtisane bei Hofe schon gebräuchlich war, lassen wir offen; Überlieferungen über die 64 Künste, die eine Ganika beherrschen musste, stammen aus späterer Zeit. Für ihre Ausbildung werde gesorgt, sie werde gut bezahlt, ein eigenes Haus werde für sie eingerichtet.
Der Hinduismus war wohl schon damals dem diesseitigen Leben und der Sexualität zugewandt und nicht erst zur Zeit des Kamasutra, dem heiligen Buch der Liebe, das etwa 1000 Jahre später verfasst wurde. Doch wir liegen sicher nicht falsch mit der Annahme, dass dies eher für das höfische Leben galt und weniger für das der einfachen Leute. Das Gärtnerpaar steht stumm vor Schreck und Ratlosigkeit, als ihre Tochter hinzutritt. Sie hat zugehört, sie weiß, dass sie hier und jetzt ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen kann. Sie erlebt einen Moment der Hellsicht: Da ist ihr Leben als gute Tochter braver Eltern, bald wird sie verheiratet werden. Weil sie schön ist, wird ein wohlhabender Mann sie nehmen, doch als Ehefrau ist ihr Platz im Haus. Sie wird der Willkür und Missgunst einer Schwiegerfamilie ausgeliefert und fortwährend schwanger sein. Dabei sehnt sie sich nach Bildung, nach Wissen, nach Poesie, Musik und schönen Dingen. Sie sieht in diesem Moment der Erleuchtung, was Liebreiz und Klugheit ihr eröffnen: die einzige Selbstständigkeit, die in ihrer Welt für eine Frau denkbar und akzeptabel ist. Sie wird unabhängig sein von Familienbanden. Gebildet und wohlhabend wird sie für die Eltern sorgen und den Armen helfen, sie wird die Herrin ihres Lebens sein.
Ja, spricht sie, meine Eltern nehmen das Angebot an. Und ich gehorche ihnen.
Doch eine Bedingung stelle ich: Meinen Preis bestimme ich selbst.
Ihre Ausbildung wird von kundigen Frauen und Männern geleitet. Sie lernt mehr als Schminken und Körperbemalung, bald kann sie lesen und schreiben, sie studiert Tanz und Gesang und die Musikinstrumente der Zeit. Ambapali spielt die Bogenharfe, die Flöte und Trommel mit Freude und Hingabe. Sie wird Poesie verfassen und für ihr tänzerisches Können gepriesen werden. Wir können wohl sicher sein, dass eine Ganika auch die Kunst lernte, nicht schwanger zu werden. Und dennoch bekommt sie später einen Sohn, dessen Vater der König des Nachbarstaates gewesen sein soll. Ambapalis Ruf war weit über die Grenzen der Adelsrepublik der Licchavi hinaus gedrungen und hatte auch zum Ruhm und Reichtum des Landes beigetragen, denn selbstverständlich nahm der Staat von ihr Steuern ein. König Bimbisara von Rajagaha, der eigentlich im Krieg mit den Licchavi lag, war neugierig auf diese nützliche Einrichtung der Ganika und besuchte Ambapali. Er sei, heißt es, in Liebe zu ihr entbrannt. Hat sie ihn wohl auch geliebt oder begehrt, hat sie sich ein Kind gewünscht? Vielleicht gehen all diese romantischen Vorstellungen fehl. Vielleicht ist es eine Legende, dass Ambapali ihren Geliebten zum Friedensschluss mit ihren Herren bewegt habe.
Doch die Geschichte geht weiter. Ambapali nennt ein großes Haus mit Dienerschaft und viel Land ihr eigen und hat, um ihre Herkunft zu ehren, einen großen Mangogarten anlegen lassen, ein teures Unterfangen, aber Geld hat sie genug und als Gärtnerstochter glaubt sie an Investitionen in die Landwirtschaft.
Sie sitzt eines Mittags in ihrem schattigen Salon und übt sich im Flötenspiel, als ein Diener angerannt kommt und atemlos stammelt, im entfernten Ende des Gartens habe sich eine Gruppe Mönche im Schatten der Mangobäume niedergelassen, unter ihnen sei ihr Meister, der Erhabene, der Erleuchtete – der Buddha.
Ambapali schaut hinaus über ihr Land. Und wieder weiß sie, dass der Moment da ist, in dem sie ihrem Schicksal eine Wende geben kann. Sie schickt den Diener fort, um den Wagen anzuspannen, legt ihr kostbar besticktes Gewand und den Goldschmuck ab, zieht ein schlichtes Kleid und solide Schuhe an. Mit Pferd und Wagen lässt sie sich durch den Garten fahren, doch weiß sie auch, wo sie anhalten und zu Fuß weitergehen muss. Sie betritt die Lichtung – und da ist er, der alte Buddha umgeben von seinen Mönchen. Ambapali weiß um ihre Wirkung. Wenn sie auch keine Zeichen des Reichtums an sich trägt, so verrät doch ihr Gang sie als die Herrin des Ortes. Und das soll auch so sein. Sie verbeugt sich bescheiden und respektvoll und setzt sich ein wenig abseits nieder, um der Lehrrede zu lauschen, die als Ambapali Sutta in die Lehrbücher eingehen wird. Der Buddha spricht über die vier Wege der Achtsamkeit, die sich auf den Körper, die Sinne, den Geist und das Dharma richten solle.
Er steht im Ruf, Frauen nicht gemocht zu haben. Doch immerhin hatte er die Gründung eines Nonnenordens zugelassen, in dem auch seine Stiefmutter, die Königin Mahapajapati, seine Halbschwester und seine frühere Ehefrau der Erleuchtung zustrebten. Und kann man sich einen Erwachten vorstellen, der sich misogynen Animositäten hingibt? Der Buddha wendet sich ihr zu, sieht sie, erkennt ihre Absichten und spricht auch zu ihr über die Überwindung von Schmerzen und Anhaften.
Wir wollen hier gern annehmen, dass der alte Weise schon lange jenseits moralischer Werturteile gegenüber Frauen war, die für das Geld bekommen, was andere für Schläge tun müssen, und weiterhin wollen wir annehmen, dass es nur die kleinlich denkenden unter seinen Nachfahren sind, die darüber spekulieren, welche böse Tat diese Frau in ihrem früheren Leben wohl begangen haben mag, um mit dem Beruf der Kurtisane bestraft zu werden. Es mag auch sein, dass er sich in dem Moment, da er ihrer gewahr wurde, sehr wohl bewusst war, was ein Religionsstifter zu tun hat, wenn er einer Prostituierten begegnet.
Als er endet, nutzt sie die Gelegenheit, die ganze Gruppe zum nächsten Tag zum Essen in ihr Haus einzuladen. Es heißt, der Buddha habe durch Schweigen zugestimmt, wie es seine Art war. Sie eilt davon. Als sie auf dem Rückweg im Wagen sitzt, kommt eine prächtige Kutsche angebraust mit aufgeputzten Prinzen darin, auch sie wollen den großen Lehrer zum Essen laden. Das aber hat Ambapali ihren Kunden weggeschnappt. Sie bieten ihr Gold, damit sie ihnen den berühmten Gast abtritt, doch sie lacht nur, nein, das verkaufe sie nicht. Sie hat andere Pläne. Und der Alte hält sein schweigendes Wort und schlägt die Einladung in den Palast aus. Etliche Mönche mögen gegrummelt haben, denn sie hätten gern bei Fürsten und lieber dort als bei einer Kurtisane gespeist. Aber er war der Meister und so mussten sie sich schicken. In Ambapalis Haus wird gekocht und gebacken, und als am nächsten Tag die Schar der Mönche mit ihren Bettelschalen im Hof steht, trägt sie ihnen selbst ein gutes Essen auf. Und wieder hält der Buddha eine Lehrrede, er spricht zu seiner Schar und zu ihr über die Vergänglichkeit. Ambapali betrachtet derweil ihren jungen Sohn, der auf einer Treppe sitzend aufmerksam lauscht. Was soll aus ihm werden, diesem Sohn eines Königs und einer Ganika? Sie ist jetzt eine geachtete wohlhabende Frau auf der Höhe ihrer Anziehungskraft. Ihr Charme und ihr funkelnder Geist werden noch eine Weile die schlaffer werdende Haut wettmachen. Doch ihr muss niemand erzählen, dass Schönheit vergeht, und damit auch Ruhm und Einfluss schwinden. Sie weiß, dass der geistige Weg ihrem Sohn mehr Freiheit und Achtung eintragen wird als die Beamtenlaufbahn bei Hofe und sie ist entschlossen, ihm diesen Weg vorzubereiten. Als der Buddha schweigt, erhebt sie sich und bietet ihm und dem Orden ihre Mangoplantage als Geschenk an.
Die Geschichte geht gut aus, der Sohn tritt wirklich dem Orden bei und erlangt alsbald Vollkommenheit. Es heißt, er habe dann seine Mutter unterrichtet, sodass sie Nonne werden konnte, um ihrerseits die Leiden des irdischen Daseins zu überwinden und Heiligkeit zu erreichen, indem sie sich in die Vergänglichkeit des Körpers als Objekt ihrer Meditation vertiefte. Mit ihrem Lied zeigt sie allen Frauen nach ihr den Weg zum würdigen Altern. So beginnt die zweite Strophe:
... Mit Blumen bedeckt, verströmte mein Haupt.
Einen würzigen zarten Duft.
Wegen meines hohen Alters riecht es heute.
Wie das Fell eines Hundes ...
von Marie Sichtermann
Quellen:
Nils Johan Ringdal, „Die neue Weltgeschichte der Prostitution”, München 2006
Lothar Nestler, Rösrath, Internet, www.der-erwachte.de/frauen.htm
Horst Gunkel, „Ambapali – Kurtisane und Heilige”, www.kommundsieh.de/Ambapali.html
Wilfried Westphal, „Königinnen der Nacht”, Essen 2004
Neaira
Die griechische Hetäre
Woher Neaira kam, ist unbekannt. Es gibt darüber nur vage Vermutungen; manche meinen, sie könnte ein Findelkind gewesen sein, andere halten es für wahrscheinlicher, dass sie aus einem der Randgebiete Griechenlands stammte, möglicherweise aus Thrakien. Ihr Geburtsjahr war um 400 vor Christus. Gesichert ist die Erkenntnis, dass sie als Kind im jungen Alter von nur zwölf Jahren auf einem Sklavenmarkt von einer Bordellbesitzerin gekauft und zu einer Luxus-Hure, einer Hetäre ausgebildet wurde. Über ihr Leben wissen wir nur deshalb etwas, weil sie durch einen Prozess zur tragischen Figur wurde. Sie geriet zwischen die Fronten eines Streites zweier Männer: auf der einen Seite Stephanos, mit dem Neaira zusammenlebte, und auf der anderen Apollodoros – beide führten eine langjährige Dauerfehde. Nachdem Stephanos seinem Gegner eine gerichtliche Niederlage zugefügt hatte, sann der Verlierer auf Rache und verklagte seinerseits seinen Intimfeind. Apollodoros behauptete nun, Stephanos, als freier Athener Bürger, hätte mit Neaira eine Fremde geehelicht, was per Gesetz verboten war. Außerdem hätte das Paar so versucht, für ihre Kinder das Athener Bürgerrecht zu erschleichen. Dazu erstellte Apollodoros eine lange Anklageschrift über die angeblich sündhafte Lebensgeschichte Neairas. Diese Klageschrift wurde zwischen 343 und 340 v. Chr. gehalten und ist uns als Gerichtsrede überliefert. Sie bildet das Grundwissen über Neaira.
Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus hatte Griechenland demokratische Gesellschaftsstrukturen und gilt deshalb bis heute als das Mutterland der Demokratie. Das griechische Wort Demokratie heißt übersetzt „Volksherrschaft”. Doch da schon in der Vokabel „Herrschaft” das Wort „Herr” steckt, verwundert es kaum, dass es zwischen Männern und Frauen keine Gleichberechtigung gab. Die Männer im Griechenland der Antike hatten ein anderes Demokratieverständnis als wir bei uns heute. In der Volksversammlung von Athen hatten nur männliche Bürger ein Stimmrecht. Ebenso ausgeschlossen waren die Sklaven. Wer also eine Frau und obendrein noch Sklavin war, hatte ziemlich schlechte Karten. Eine Möglichkeit ihr Blatt zu verbessern, bestand für Frauen darin, den Weg einer Hetäre zu wählen. Das Wort Hetäre ist altgriechisch und stammt von „hetaire” ab, das bedeutet „Freund” oder „Genosse”; sinngemäß wäre „Gefährtin” eine passende Übersetzung. Eine Hetäre zu sein, brachte zwar kein Wahlrecht, dafür aber soziale Anerkennung und eine verbesserte Lebenssituation. Einfache Huren hatten es dagegen deutlich schlechter, wie die Wörter, mit denen sie belegt wurden, vermuten lassen: „öffentlicher Durchgang”, oder gar „Zisterne”, als Andeutung zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten, so der griechische Lyriker Anakreon in diesem Kontext.
Doch der Weg des Aufstiegs war schwierig. Obwohl es später sogar Hetärenschulen gab, mussten sich Hetären innerhalb der Gesellschaft nach oben kämpfen, sie erkauften sich die Freiheit, eroberten die Literatur und trainierten ihre Körper. Das gelang ihnen mithilfe der einflussreichsten Männer ihrer Zeit, führt Nils Johan Ringdal in seinem Buch „Die neue Weltgeschichte der Prostitution” aus, und beschreibt sie als gebildete, elegante und sexuell freizügige Frauen, die mehr Freiheit als die Ehefrauen der Bürger hatten und in der Öffentlichkeit allgemein bekannt waren. Auch ihr erworbenes Wissen über Kunst und Philosophie unterschied sie von bürgerlichen Ehefrauen, was besonders zeitgenössische Künstler schätzten, die sich nicht selten von ihnen inspirieren ließen. Trotz all dieser Vorzüge gab es auch einen Nachteil, wie Lukian von Samosata, ein griechischer Satiriker in seinem Werk „Hetärengespräche” zu berichten wusste: Ungeachtet dessen, dass der Hetärenstand gewissermaßen privilegiert war, so war er doch, nicht weniger mit einem bürgerlichen als sittlichen Makel behaftet.
Die bekanntesten griechischen Hetären lebten alle im 4. Jahrhundert vor Christus. Sokrates, einer der großen griechischen Philosophen, suchte die Nähe der Hetäre Aspasia, von der manche behaupten, sie sei weniger eine Hetäre, als vielmehr die Konkubine – eine Ehefrau ohne Trauschein – des Staatsmannes Perikles gewesen. Alexander der Große ließ sich bei seinem Feldzug gegen Persien von der Hetäre Thaïs begleiten. Von Phryne wird berichtet, sie sei eine so wunderschöne Hetäre gewesen, dass der attische Bildhauer Praxiteles sie als Modell für keine Geringere als die Liebesgöttin engagierte, um seine berühmte Statue „Aphrodite von Knidos” zu erschaffen. Und von Lamia, einer Hetäre aus Athen erzählt man, dass sie die Geliebte von zwei Königen gewesen sei, zuerst in Alexandria, später dann in Mazedonien.
Korinth, ein Handelszentrum am Isthmus, war damals zusammen mit Athen und Sparta eine der größten Städte in Griechenland und galt als Hochburg der Prostitution. Dort lebte Nikarete, jene Bordellbesitzerin, die Neaira gekauft hatte. In ihrem Haus empfing sie überwiegend gut situierte Kunden und führte sie ihren Liebesdienerinnen zu. Um dem Ansehen ihres Hauses alle Ehre zu machen und damit Höchstpreise zu erzielen, bildete sie ihre Sklavinnen zu Hetären aus, denn die kosteten bis zu hundert mal mehr als ihre Kolleginnen niedrigeren Standes. Zudem gab Nikarete Neaira und andere junge Frauen für ihre Töchter aus, was deren Ansehen und damit den Preis noch einmal steigerte.
Zur „Hetären-Ausbildung” gehörten neben den erwähnten künstlerischen Fertigkeiten natürlich auch verschiedene Sexpraktiken sowie Schönheits- und Körperpflege. Neaira war gelehrig und erreichte bald den Status einer begehrenswerten Hetäre, die viele Männer anlockte, von denen einige ihre Stammkunden wurden, unter ihnen Dichter und Schauspieler. Doch sie blieb eine Sklavin ohne Rechte. Nicht nur ihre Dienstleistungen waren eine Ware, die gekauft werden konnte, auch sie selbst konnte verkauft werden.
Im Jahre 376 – es mochten wohl zwölf Jahre vergangen sein, in deren Verlauf Neaira erfolgreich als Hetäre im Korinther Bordell tätig war – überlegten sich die beiden Stammkunden Timanoridas und Eukrates, ob es auf Dauer nicht billiger wäre, Neaira zu kaufen, als sie nur zu mieten. Da das Objekt ihrer Begierde seine Jugendblüte bereits verloren hatte, war Nikarete bereit, ihre Sklavin zu verkaufen. Allerdings verlangte sie den stolzen Preis von 3000 Drachmen, zehnmal so viel, wie bei gewöhnlichen Sklaven. Diese hohe Summe betrug mehr als das fünffache Jahreseinkommen eines einfachen Arbeiters. Trotzdem schlugen Timanoridas und Eukrates ein. Für Neaira begann nun ein angenehmeres Leben. Sie war die Privatsklavin wohlhabender Besitzer, und das war auf jeden Fall besser, als in einem Bordellbetrieb anschaffen zu müssen. Doch da Eigentum verpflichtet, erkannten die neuen Herren nach zwei Jahren, das eine Hetäre zu unterhalten, auch nicht gerade billig war. Sie boten daher ihrer Sklavin an, sich für 2000 Drachmen freizukaufen, unter der Bedingung, dass sie Korinth für immer verließe. Denn auf Dauer litt auch der sittliche Ruf von Timanoridas und Eukrates, und als sie selbst heiraten wollten, erklärten sie Neaira, sie wollten nicht, dass sie, die Hetäre gewesen war, dieses Gewerbe sichtbar in Korinth ausübe, so Apollodoros in seine Rede. Neaira willigte ein, trieb mit Unterstützung einiger Ex-Liebhaber die geforderte Summe auf und kaufte sich frei. Den größten Batzen steuerte der Stammkunde Phrynion bei, mit dem sie zusammen nach Athen ging.
Neairas Leben in Freiheit verlief wohl nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte. Apollodoros berichtet, dass Phrynion einen verschwenderischen Lebenswandel führte, und Neaira sehr unzüchtig und schamlos benutzte, überall mit ihr zu Gelagen zog, wo immer er zechte, und sie an all den Umzügen der Zecher teilnahm. Auch hatten viele Gäste Geschlechtsverkehr mit ihr, als sie betrunken war, sogar die Sklaven. Im Winter 373/372 hatte sie wahrscheinlich von ihrem einstigen Gönner und dessen Ausschweifungen genug, denn sie packte manches seiner Habe aus dem Haus ein, drunter all die Kleidung und den Goldschmuck, den sie von ihm erhalten hatte, nahm dann zwei Sklavinnen mit, und lief nach Megara davon.
In Megara, einer Hafenstadt, nicht weit von Athen gelegen, arbeitete sie wieder als Hetäre, um zu überleben. Doch es waren unruhige, kriegerische Zeiten, und die Geschäfte liefen schlecht. Am liebsten wäre sie nach Athen zurückgekehrt, aber sie fürchtete dort den Zorn des geprellten Phrynion. Da muss Neaira die Begegnung mit Stephanos gerade recht gekommen sein. Apollodoros: Als dann dieser Stephanos hier in Megara eintraf, kehrte er bei ihr als einer Hetäre ein und kam ihr nahe, machte ihr Mut, dass es dem Phrynion schlimm ergehen solle, wenn er Hand an sie lege: Er aber wolle sie als seine Frau halten und auch ihre Kinder, die sie damals hatte, und sie zu Bürgern machen. So geschah es. Stephanos nahm Neaira mit in seine Heimatstadt und natürlich kam es dann zwischen Stephanos und Phrynion zu der befürchteten Auseinandersetzung. Doch nach einigen Verhandlungen konnten sie sich letztendlich mithilfe privater Schlichter friedlich einigen.
Hoffen wir für Neaira, dass die nächsten zweieinhalb Jahrzehnte, in denen sie mit Stephanos und den drei Kindern in gutbürgerlichem Haushalt zusammenlebte, nicht so verliefen, wie sich aus den Worten Apollodoros vermuten lässt: Aus zwei Gründen hatte Stephanos Neaira mit nach Athen gebracht: erstens, um ohne alle Kosten eine schöne Hetäre zu haben, und zweitens, damit sie ihm durch ihr Gewerbe seinen Unterhalt verschaffe und das Haus erhalte. Er hatte nämlich sonst keine Einkünfte. Zweifel an dieser Aussage sind angebracht, denn Apollodoros wollte natürlich seinen Widersacher und dessen Lebensgefährtin in möglichst negativem Licht erscheinen lassen. Leider ist der Ausgang des Prozesses nicht überliefert, auch nicht, wie es Neaira später noch erging. Doch immerhin verdanken wir der Dauerfehde zweier Athener Bürger, dass Apollodoros seine Anklage verfasste. Und dieser hat zu Lebzeiten sicher nicht geahnt, dass er Neaira damit zu einer der berühmtesten Hetären des Altertums machte.