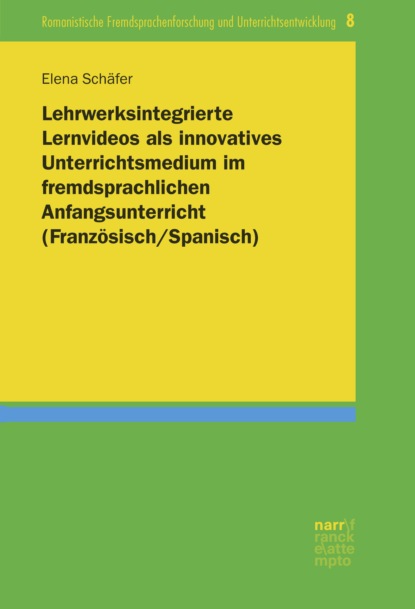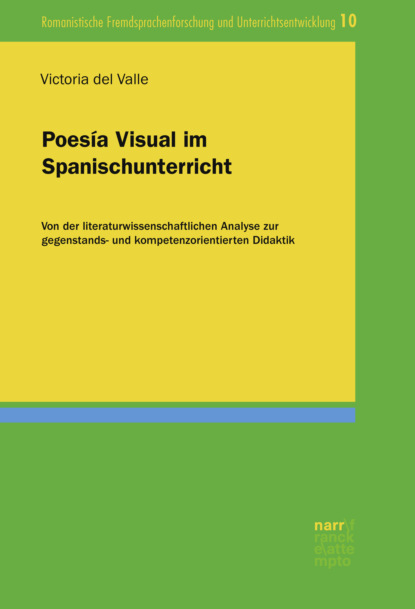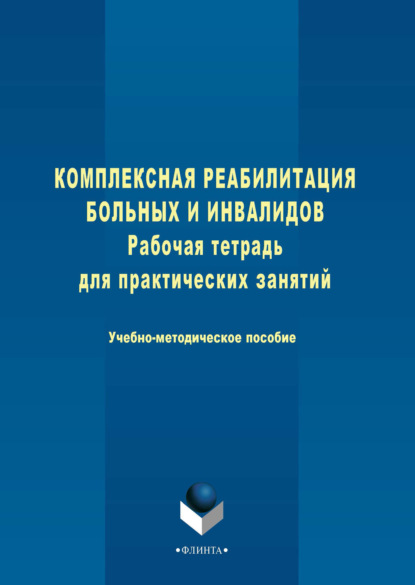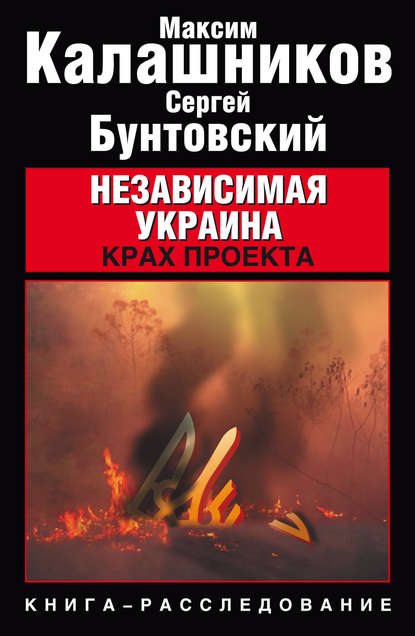Gesprochenes Portugiesisch aus sprachpragmatischer Perspektive
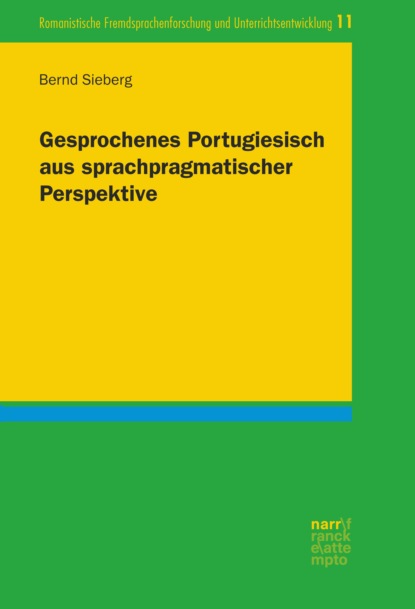
- -
- 100%
- +
Die Aufnahmen zu diesen Korpora19 erfolgten in allen oben genannten Städten zwischen 1970 und 1978 und erfassten einen für diese Zeit und ihre technischen Möglichkeiten gigantischen Korpus von 1.870 Interviews. An seinem Zustandekommen waren 2.356 weibliche und männliche Gewährspersonen beteiligt. Insgesamt kamen so 1.570 Stunden Sprachaufnahmen zusammen (Castilho 2015,12). Als Bedingung für die Datenerfassung – man denke an den Namen des Projekts Norma Linguística Culta – wurde vorgegeben, dass es sich um Gewährspersonen verschiedenen Alters (davon 30 % zwischen 25 und 35, 45 % zwischen 36 und 55, und 25 % mit mehr als 56 Jahren) mit einer höheren Schulausbildung (nível superior de escolaridade) handeln musste. Die Aufnahmen setzten sich aus verborgen aufgenommen ‚spontanen Dialogen‘ (10 %), Gesprächen zwischen zwei Gewährspersonen (40 %), Interviews mit einer Reihe vorher festgelegter Fragen (40 %) sowie aus monologischen Texten für den phonetischen Teil der Untersuchung (10 %) zusammen (Silva 1996, 85).
Die Transkriptionen der Korpora bildeten den folgenden Schritt zur Erstellung des Gesamtkorpus. Sieht man sich als Beispiel für die vorhandenen Transkriptionen das Korpus von Rio de Janeiro an, fällt auf, dass es sich um ‚literarische Transkriptionen‘ handelt, die allerdings von der Standardorthographie abweichende Aussprachen zumindest teilweise in ihren alternativen Formen (einschließlich der entsprechenden Graphemik) transkribieren, wie z.B. den Satz Também não dá pra ter em apartamento (Inquérito 0120 / tema ‚animais e rebanhas‘ / ano da gravação 1972)20. In dieser Hinsicht besteht ein wichtiger Unterschied zu den in Portugal vom CLUL bereitgestellten ‚literarische Transkriptionen‘ wie denen des ‚C-ORAL-ROM-Korpus‘, die phonetische Abweichungen ignorieren und den Regeln der Standardorthographie anpassen. Ungefähr zeitgleich mit der Datenerhebung und Anfertigung der Korpora zwischen 1970 und 1978 – je nach Stadt dauerte die Erstellung der Transkriptionen unterschiedlich lange – erschien eine Reihe von Untersuchungen zum brasilianischen Portugiesisch (Castilho 2007, 100). Aber erst seit Mitte der 80er Jahre setzte eine wahre Flut von Veröffentlichungen ein, die sich zu einem erheblichen Anteil – wenn auch nicht ausschließlich – der gesprochenen Variante des brasilianischen Portugiesisch widmete. Entsprechend äußert sich ein anderer bedeutender brasilianischer Sprachwissenschaftler, Luiz A. Marcuschi21 (2001, 345): „Até então quase inexistentes estudos sistemáticos sobre a fala, a escrita e as relações de ambas no Brasil. Hoje esse campo conta com algumas centenas de trabalhos nas mais diversas linhas teóricas sobre os mais variados aspectos“.
Die zweite Phase des NURC Projekts begann mit einer systematischen Auswertung des Korpus unter Berücksichtigung der bis dato neu veröffentlichten Literatur zum Thema, wobei die Gruppe um Castilho in dieser Phase auf mehr als 50 Mitarbeiter aus 15 brasilianischen und ausländischen Universitäten zählen konnte. Der Titel dieses Projekts Projeto de Gramática do Português Falado (PGPF) ist allerdings irreführend, weil im Zentrum des Projekts nicht ausschließlich – wie das Attribut ‚falado‘22 vermuten lässt – die GS, sondern eine Beschreibung des standardsprachlichen oder ‚hochsprachlichen‘ brasilianischen Portugiesisch stand, wenn man diesen letzteren zumindest in der europäischen Forschungstradition archaisch anmutenden und für die deskriptive Linguistik negativ konnotierten Begriff verwenden will.
Das Team um Castilho, zu dem unter anderen Margarida Basílio, Rodolfo Ilari, Mary Kato, Ingedore Villaça Koch, Maria Helena Moura Neves, Maria Bernadete Marques Abaurre und Ângela Rodrigues gehörten – um nur eine der wichtigsten Namen zu nennen –, begann ab 1990 mit der ersten Ausgabe der insgesamt acht Bänden der Gramática do Português Falado, die zunächst beim Verlag ‚Unicamp‘ der Universität von Campinas im Staat São Paulo erschien23. Dabei handelte es sich im Grunde genommen nicht um eine Grammatik im engeren Sinn dieses Begriffs, sondern zunächst um eine Sammlung lose miteinander verbundener Artikel zu den verschiedenen Bereichen einer Grammatik. Dazu gehören sowohl Beiträge zur Schriftsprache als auch solche, die sich spezifischen Erscheinungen der Mündlichkeit widmen.
Dieser Mangel und eine weitere Flut von Veröffentlichungen führte ab 2004 zu einer Phase der „Consolidação“ (Castilho 2007, 100). Neben einer Aktualisierung bedeutete die Umgestaltung insbesondere, dass man thematisch zusammengehörige Beiträge zu Gruppen zusammenfasste. Am Ende dieses Prozesses stand die Veröffentlichung einer ‚runderneuerten‘ Grammatik, der man den Titel Gramática do Português Culto Falado no Brasil verlieh. Diese Reihe bestand zunächst aus fünf Bänden, wurde dann aber umorganisiert und auf insgesamt sieben Bände verteilt, wobei die originalen Beiträge der fünfbändigen Ausgabe wortgetreu erhalten blieben. Diese Umverteilung war sinnvoll, weil der ursprünglich zweite Band dieser Version der Grammatik mit weit über 1000 Seiten zu umfassend ausgefallen war – für die neue Herausgabe wurde ‚Band II‘ in drei Einzelbände aufgeteilt – und preislich so hoch lag, dass sich sein Verkauf als schwierig erwiesen hatte.
Die (vorläufig) neueste Ausgabe der aus sieben Bänden bestehenden Gramática do Português Culto Falado no Brasil erschien zwischen 2013 und 2016, nun bei dem Verlag ‚Editora Contexto‘ in São Paulo, und setzt sich folgendermaßen zusammen: Band I wurde 2015 von Clécila Spinardi Jubran unter dem Titel A Construção do Texto Falado herausgebracht. Ihm folgte noch im selben Jahr 2015 Band II von Mary Kato und Milton do Nascimento mit dem Titel A Construção da Sentença. Band III von Rodolfo Ilari mit dem Titel Palavras de Classe Aberta war bereits 2014 erschienen, und ebenfalls von Ilari wurde dann 2015 Band IV mit dem Thema Palavras de Classe Fechada herausgegeben. 2016 folgte Band V mit dem Titel A Construção de Orações Complexas von Neves, Helena Maria de Moura. Ângela Rodrigues und Ieda Maria Alves organisierten Band VI A Construção Morfológica da Palavra, der 2015 veröffentlicht wurde, und die Herausgabe des bereits 2013 erschienenen Bands VII A Construção Fonológica da Palavra leitete schließlich Maria Bernadete Abaurre.
Obwohl auch bereits die sieben Bände dieser Grammatik zahlreiche Beiträge24 zur GS des brasilianischen Portugiesisch enthalten – man erinnere sich an den ursprünglichen Plan, dem zufolge das Projekt sowohl Sprechen als auch Schreiben erfassen sollte –, sind die Artikel, die Dino Preti zusammen mit anderen Autoren in den zehn Bänden seines ‚Projetos Paralelos‘ veröffentlicht hat, spezifisch auf den Forschungsbereich der GSF zugeschnitten und folglich für die hier vorliegende Arbeit von größerer Bedeutung. Dino Preti ist Initiator und einer der verantwortlichen Organisatoren dieser Reihe Projetos Paralelos, die beim Verlag ‚Humanitas‘ erschienen ist. Zusammen mit anderen Autoren, zu denen u.a. Antônio Marcuschi, Hudinilson Urbano, Gaston Hilgert oder Marli Quadros Leite gehören – um nur einige wenige der wichtigsten Namen zu nennen –, hat Preti in den zehn Bänden dieser Reihe Projeto Paralelo zahlreiche Artikel zur GSF verfasst bzw. herausgebracht. Die mir bekannte letzte Ausgabe dieser Reihe datiert auf 2009. Zu ihr gehören im Einzelnen: Volume 1 – Análise de textos orais von 1993 / Volume 2 – O discurso oral culto von 1997 / Volume 3 – Variações e confrontos von 1998 / Volume 4 – Fala e escrita em questão von 2001 / Volume 5 – Interação na fala e na escrita von 2002 / Volume 6 – Léxico na língua oral e na escrita von 2003 / Volume 7 – Diálogos na fala e na escrita von 2005 / Volume 8 – Oralidade em diferentes discursos von 2006 / Volume 9 – Cortesia verbal von 2008 / Volume 10 – Oralidade em textos escritos von 2009.
Wie sehr sich diese Veröffentlichungen und die von ihnen fokussierten Themen mitsamt der Vielfalt und Aktualität der dabei zur Geltung gebrachten Konzepte und Methoden von den wenigen portugiesischen Untersuchungen unterscheiden, wird bereits bei einem Blick auf einige der Artikel deutlich, die ich an dieser Stelle nur exemplarisch vorstellen kann: Aus der vierten Ausgabe von 1999, Análise de Textos Orais (Vol. I des ‚Projeto Paralelo‘), ist u.a. der Aufsatz Marcadores conversacionais von H. Urbano (Seite 81–103) hervorzuheben oder der Beitrag Procedimentos de reformulação: a paráfrase von G. Hilgert (Seite 103–129). Im gleichen Band erschien ebenfalls ein Artikel mit dem Titel A sintaxe na língua falada (Seite 169–189) von Corrêa Dias de Moraes und o processo interacional (189–215) von Beth Brait. Obwohl man im Zusammenhang dieses Projeto Paralelo noch zahllose weitere Forschungsarbeiten nennen könnte, sei wenigstens noch auf den Beitrag Hilgerts A construção do texto falado por escrito na Internet in Band IV Fala e Escrita em Questão (2001) hingewiesen, in dem der Autor die Nähe kommunikativer Praktiken der ‚keyboard-to-screen communication‘ zur medial mündlichen Kommunikation ins Spiel bringt. Schließlich handelt es sich dabei um eine Analogie, die auch in der vorliegenden Arbeit thematisiert wird.
Wenn man sich dazu noch die zahlreichen Arbeiten zum Bereich der GSF anschaut, die außerhalb des ‚Projeto Paralelo‘ an brasilianischen Universitäten – besonders der USP in São Paulo – erschienenen sind, bekommt man einen Eindruck von der Quantität und Qualität der entsprechenden Forschungsarbeiten, deren noch ausführlichere Beschreibung aber an dieser Stelle nicht meine Aufgabe sein kann. Hervorzuheben wäre an dieser Stelle die besondere Situation, aus der heraus die bemerkenswerte Geschwindigkeit und Dynamik der Entwicklung entstehen konnte. Ich beziehe mich dabei auf den glücklichen Umstand, dass das NURC Projekt in den 70er Jahren bei seinen Forschungen zum brasilianischen Portugiesischen sozusagen bei Null anfangen musste, aus der Not eine Tugend machte, und der Erforschung des gesprochenen Brasilianisch von Beginn an eine gleichwertige Stellung einräumte.
Zur germanistischen GSF weist die brasilianische GSF – im Unterschied zu der eigentlich kaum in Erscheinung tretenden portugiesischen GSF – durchaus Ähnlichkeiten und Überschneidungen auf. Zu diesem Schluss gelangt man, wenn man sich die Quantität und Qualität sowie die zur Anwendung gelangte Vielfalt von Forschungskonzepten und Themen vor Augen hält, die die brasilianische GSF seit Mitte der 80er Jahre im Umfeld des NURC Projekts und des Projeto Paralelo charakterisiert.
Im Zusammenhang mit den bereits oben vorgestellten Fakten möchte ich einige der Grundpositionen, die beide Forschungstraditionen der GSF miteinander verbinden, wie folgend zusammenfassen: (a) Priorität deskriptiver Methoden und Korpus basierter Forschungen sowie der damit verbundenen Abkehr von normativ-präskriptiven Vorstellungen bei der Sprachbeschreibung, (b) ein Konzept von ‚Sprache‘, das neben dem schriftlichen Gebrauch des verbalen Codes dem ‚Sprechen‘ eine zumindest ebenbürtige Rolle zuerkennt: „a língua é um somatório de usos concretos“ (Castilho 2007, 101), (c) die Einbeziehung der sozialen Dimension sprechsprachlichen Handels: a língua como uma atividade social, […]e agimos sobre o outro (Castilho 2007, 101), (d) die Diskursbezogenheit der Untersuchungen zur GS, ohne die viele Erscheinungen der GS nicht erklärt werden könnten: „A língua se manifesta através da conversação, considerada como a articulação discursiva fundamental“ (Castilho 2007, 102), (e) die situative und damit raumzeitliche Gebundenheit sprechsprachlichen Agierens und ihre Auswirkung auf sprachliche Ausdrücke und Strukturen, (f) die Abhängigkeit der Bedeutung und der Funktionen sprechsprachlicher Einheiten von ihrem (selbst geschaffenen) textinternen Kontexten, aber auch von textexternen Kontexten und Präsuppositionen, (g) die Vorstellung eines dynamischen Dialogverlaufs in Analogie zu den Erkenntnissen der ‚Interaktionalen Linguistik‘25, durch den sich Bedeutungen und Funktionen der beteiligten Elemente erst im Diskursverlauf konstituieren, (h) die Einbeziehung von kommunikativen Praktiken konzeptioneller Mündlichkeit aus dem Bereich peripheren Nähesprechens, wie sie u.a. Hilgert mit seinem Begriff „texto falado por escrito na Internet“ (2000) vorschlägt etc.
Um die Grenzen möglicher Aussagen über die GS möglichst weit auszudehnen, verzichteten die beteiligten brasilianischen Linguisten in der Phase epistemologischer Reflexionen bewusst26 auf die Anwendung einer einzigen Methode und wählten einen ‚Methodenpluralismus‘, der u.a. die ‚Gesprächsanalyse‘, eine Beschreibung von Vorgängen der ‚Grammatikalisierung‘, ‚Freges Bedeutungstheorie‘, die ‚kognitive Linguistik‘, ‚den Funktionalismus der Prager Schule‘ sowie Labovs Erkenntnisse zur Soziolinguistik‘ mit einschließt (Castilho 2007, 102).
Esses pesquisadores deixaram deliberadamente de aderir à aplicação de uma teoria única, operando com princípios de variada ordem, num leque em que se incluem a Análise da Conversação, as idéias gramaticais de Halliday, Dik e Givón, a Semântica de Frege e a Semântica Cognitiva.
Ohne den Verdienst schmälern zu wollen, den sich die brasilianische GSF in einem relativ kurzem Zeitraum erworben hat, und zu dem besonders die Öffnung zur konzeptueller und methodischer Vielfalt beigetragen hat, scheint es m.E. durchaus sinnvoll, noch zusätzlich ein anderes Konzept wie das des Modells des ‚Nähe- und Distanzsprechens‘ mit in die Forschung hineinzunehmen. Dieses würde es erlauben, viele Einzelerkenntnisse, deren Zusammenhang und übergreifende Bedeutung sich durch die Heterogenität der angewendeten Untersuchungsmethoden dem Betrachter verschließt, aus der Sicht dieses Modells im Zusammenhang zu erschließen. Beispiel: die in eine gleiche Richtung zielende funktionale Bedeutung von sprachlichen Erscheinungen wie ‚tópicos marcados, ‚construções de clivagem‘ und ‚Operatoren in Operator-Skopus-Strukturen‘ wird erst wirklich verständlich, wenn man sie aus einer gemeinsamen Perspektive betrachtet, die verdeutlicht, dass sich in all diesen sprachlichen Merkmalen das universale Diskursverfahren einer ‚aggregativen Rezeptionssteuerung‘ (cf. Kapitel 5.3) manifestiert. Das bedeutet, mittels dieser Ausdrücke und Strukturen gelingt Sprechern eine Beeinflussung der Dekodierung und damit der möglichen Folgehandlungen ihrer Gesprächspartner, an die sie ihre Äußerungen richten.
3. Benutzte Korpora, Transkriptionen, Abkürzungen und weitere Hinweise zur Erleichterung der Lektüre des Buches
Der weitaus überwiegende Teil der Transkriptionen, die in der vorliegenden Studie als Beispiele herangezogen werden, wurde mir freundlicherweise von Mitarbeitern des CLUL kostenfrei zur Verfügung gestellt1. Sie entstammen dem ‚C-ORAL-ROM-Korpus‘ (Integrated Reference Corpora for Spoken Romance) des CLUL. Bei den Beispielen handelt es sich um 152 Gespräche mit rund 300000 Wörtern, die in den Jahren 1970 und 1998, aber zum überwiegenden Teil im Jahr 2001 aufgenommen wurden. Die spontan geführten Gespräche finden zwischen zwei oder mehr Gewährspersonen statt, die sich über verschiedene alltägliche Themen unterhalten. Das abschließende Korpus wurde im Jahre 2001 von einer Arbeitsgruppe der CLUL bearbeitet und transkribiert2. Nähere Informationen zum Korpus und seiner Entstehung sowie der für die Transkription verwendeten Transkriptionszeichen findet man in den online einsehbaren Aufsätzen von Cresti et al. (2002) und Mendes et al. (2003) 3. Die in der vorliegenden Untersuchung benutzten Beispiele stützen sich unter Ausrichtung am Untersuchungsziel dieser Arbeit ausschließlich auf die literarischen Transkriptionen des Korpus, die im ‚txt-Format‘ vorliegen. Beispiele aus diesem Korpus werden in folgender Form gekennzeichnet: (1) C-ORAL-ROM ‚pnatco02.txt‘ – Religion und Persönlichkeitsentwicklung. Durch die in Klammern stehenden Nummern werden die Beispiele zu einem Themenbereich durchnummeriert, während nach dem Gedankenstrich am Ende das im Gespräch fokussierte Thema genannt wird.
In den folgenden Paragraphen werden die Transkriptionszeichen, die ich aus den Originaltranskriptionen übernommen habe, aufgelistet und erklärt. Im Hinblick auf die pragmatische Ausrichtung des Konzepts des Buches und die Einteilung der thematisierten sprachlichen Merkmale auf der Basis unterschiedlicher universaler Diskursverfahren des Nähe- und Distanzmodells von Ágel / Hennig wurden die Originaltranskriptionen der Beispielsätze des ‚C-ORAL-ROM-Korpus‘ so weit wie möglich vereinfacht und alle gemessen an dieser Zielsetzung überflüssigen Symbole und Transkriptionszeichen4 weggelassen, um die Leserlichkeit der Textbeispiele zu erhöhen:
L, T, S, … etc.: Mittels von Großbuchstaben abgekürzte Namen der Personen – künftig auch als ‚Gewährspersonen‘ bezeichnet, die an einem Gespräch teilgenommen haben. L entspricht Luís, T steht für Teresa, S für Sara etc. Zusätzliche Informationen: Ergänzende Informationen zu den Aufnahmesituationen, den Gewährspersonen und behandelten Themen, füge ich in Form von Abkürzungen den Transkriptionen hinzu. Zum Beispiel bedeutet die Buchstabenfolge ‚ptelpv11.txt‘ ‚Dialog am Telefon‘, ‚ppubdl10.txt‘ steht für ‚Dialog‘ und ‚ppubmn07.txt‘ kennzeichnet eine ‚monologische Gesprächssequenz‘. Zusätzlich habe ich noch in Stichworten angemerkt, worüber sich die Personen jeweils unterhalten und alle Informationen wie im folgenden Beispiel annotiert: (13) C-ORAL-ROM ‚pfamcv02.txt‘ – Anwälte und Kleiderordnung. / : Ein Schrägstrich markiert eine kurze Pause in einer Intonationseinheit, die aber noch nicht an ihr Ende gelangt ist5. Die Länge einer solchen Pause wird nicht objektiv (z.B. in Sekunden oder Sekundenbruchteilen) angegeben. Stattdessen dient als Kriterium dieser Definition das subjektive Empfinden eines kompetenten Sprechers des Portugiesischen. // : Zwei nebeneinander stehende Schrägstriche bedeuten, dass ein Sprecher seine Intonationseinheit beendet hat. Außerdem weisen sie auf eine zeitlich ausgedehntere Pause zwischen Äußerungen, wobei aber exakte, objektiv nachvollziehbare Aussagen über die Länge der jeweiligen Pausen fehlen. … : Drei hintereinander gestellte Punkte stehen für eine vom Sprecher nicht zu Ende geführte Äußerung. Einen möglichen Grund dieses Abbruchs sehen die Autorinnen des CLUL z.B. darin, dass es sich bei der begonnenen Äußerung um ein Sprichwort handelt, das darum nicht beendet wird, weil jedem kompetenten Sprecher des Portugiesischen das passende Ende bereits bekannt sein dürfte, wie águas passadas não… 6. Man sollte aber ausdrücklich hinzufügen, dass es sich nicht um Anakoluthe handelt, deren Erscheinen in einer diskursiven Sequenz auf andere Gründe verweist7. […] : Diese in eckige Klammern gesetzten Punkte ersetzen Textstellen, die aus den Originaltranskriptionen herausgenommen werden. Ich lasse sie weg, wenn sie für die Veranschaulichung und Interpretation der thematisierten sprachlichen Erscheinung unerheblich sind. < > : Eckige Klammern bedeuten, dass die sich zwischen ihnen befindlichen Teile der Sprechsequenz teilweise oder gänzlich mit Teilen der Äußerungen des Gesprächspartners überschneiden. [<] < > : Dieses Zeichen verweist darauf, dass ein Sprecher die Äußerung seines Gegenübers weiterführt – es handelt sich also um eine Form der Adjazenz –, wobei diese Weiterführung parallel zur Äußerung des Gesprächspartners verläuft.Im Laufe meiner Arbeit hat das ‚Mike-Davies-Korpus‘8 mit der Bezeichnung O Corpus do Português, das über die vergleichsweise riesige Zahl von 450 Millionen (Género / Histórico) bzw. 1 Billionen (Web /Dialetos) Wörtern verfügt, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Bei der ersten Variante dieses Korpus handelt es sich um ein ‚kleineres‘ Korpus, das durch Sprachwandel verursachte Veränderungen der Wörter erfasst und sich mit Wörtern aus dem 13. bis hin zum 20. Jahrhundert besonders für die historische Erforschung der portugiesischen Sprache anbietet. Das zweite wesentlich umfangreichere Korpus hingegen, dessen Einträge in den Jahren 2013 und 2014 gesammelt und aufgearbeitet wurden, berücksichtigt sprachgeographische Varianten des Portugiesischen aus Brasilien, Angola und Mozambique und eignet sich darum besonders für synchrone Studien. Weil diese Korpora aber keine Visualisierung dialogischer Strukturen ermöglichen, sondern ausschließlich monologische Passagen als jeweilige Kontexte eines Lemma angegeben sind, habe ich diese Korpora nur zur Ergänzung und zur Analyse sprachlicher Ausdrücke und Erscheinungen benutzt, deren Interpretation ohne die Berücksichtigung dialogischer Kontexte auskommt. Im Text werden Übernahmen aus diesem Korpus mittels der Abkürzung MD gekennzeichnet.
Einige Beispiele aus monologischen Diskurssequenzen stammen aus dem Korpus von Maria de Fátima Viegas Brauer-Figueiredo. Dabei handelt es sich um Transkriptionen mit insgesamt 154584 Wörtern als Ergebnis von Interviews, die in den Jahren von 1984 bis 1994 stattgefunden haben. Die Autorin hat dieses Material und ihre auf Deutsch verfassten Interpretationen in dem Buch „Gesprochenes Portugiesisch“ (1999) veröffentlicht. Ursprünglich handelte es sich um den Versuch, die Zweisprachigkeit portugiesischer Immigranten der zweiten Generation in Hamburg zu analysieren. Dabei gelangte die Autorin aber schließlich zu der Erkenntnis, dass die erzielten Ergebnisse generelle Aufschlüsse über Charakteristika des gesprochenen Portugiesisch ermöglichen. Mit der Veröffentlichung „Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch“ von Koch / Oesterreicher im Jahre 1990 und vor dem Hintergrund der Ergebnisse und der benutzen Methode dieser Arbeit änderte Viegas Brauer-Figueiredo schließlich das Untersuchungsziel ihrer Arbeit und wertete sie als Versuch, das von Koch / Oesterreicher benutzte Konzept auf die Untersuchung des gesprochenen Portugiesisch anzuwenden. So erfasst das Korpus nach Aussagen der Autorin insgesamt 3.459 Ausdrücke und Strukturen, die charakteristisch für diese Variante sind. Entsprechend vergrößerte Viegas Brauer-Figueiredo auch den vom Korpus erfassten Kreis der interviewten Personen sowie der berücksichtigten kommunikativen Praktiken. Dazu gehören: (a) Interviews und Gespräche mit portugiesischen Immigranten der zweiten Generation in Hamburg, (b) Gruppengespräche und Interviews mit Studierenden von drei verschiedenen portugiesischen Universitäten, (c) Interviews von Personen unterschiedlicher Sozialschichten, Berufen und Altersgruppen, die auf dem portugiesischen Festland, auf den Azoren sowie auf den Kapverden durchgeführt wurden, (d) Auszüge aus Vorträgen, Diskussionen und Gesprächen zwischen Schriftstellern, Moderatoren und Personen aus dem Publikum in Hamburg, (e) Auszüge aus Vorlesungen, Seminaren und Kolloquien von portugiesischen Gastprofessoren an der Universität Hamburg und (f) Mitschnitte aus portugiesischen Fernsehsendungen.
Die resultierende Heterogenität dieses Korpus sowie der Umstand, dass die dialogischen Abläufe von Dialogen nicht visualisiert werden, wie es z.B. das gesprächsanalytische Transkriptionssystem GAT mit seiner „Textnotation“ (üblich bei Transkriptionen des IDS) ermöglicht, schränkt die Benutzung dieses Korpus für die in dieser Studie definierten Ziele entscheidend ein. Diese Transkriptionen werden an dieser Stelle darum ausschließlich zur Erklärung von sprachlichen Erscheinungen benutzt, die sich auch aus den monologischen Strukturen der erfassten Diskurssequenzen erschließen. In der vorliegenden Arbeit sind die wenigen Beispiele aus diesem Korpus mittels der Kürzel VBF. Zusätzlich hinzugefügte Zahlen geben jeweils die Seite des Buches an, aus dem das Beispiel stammt.