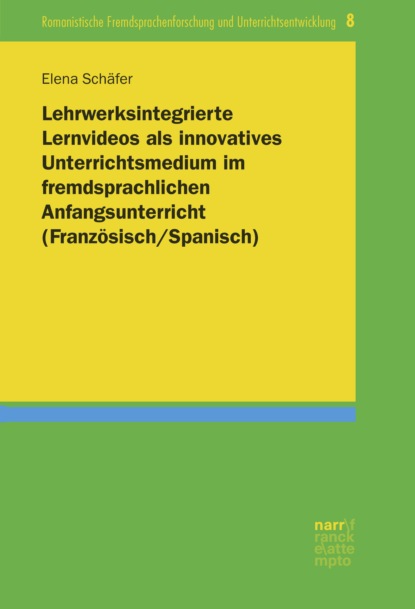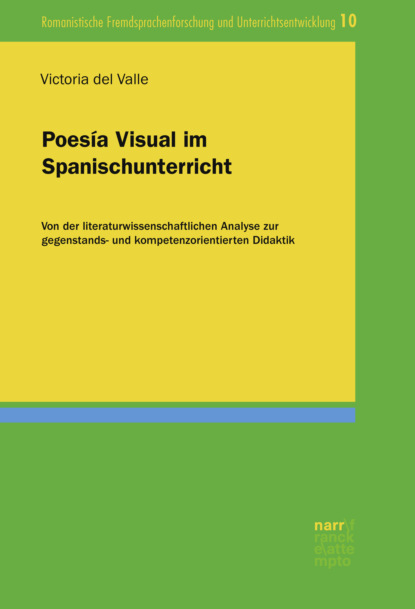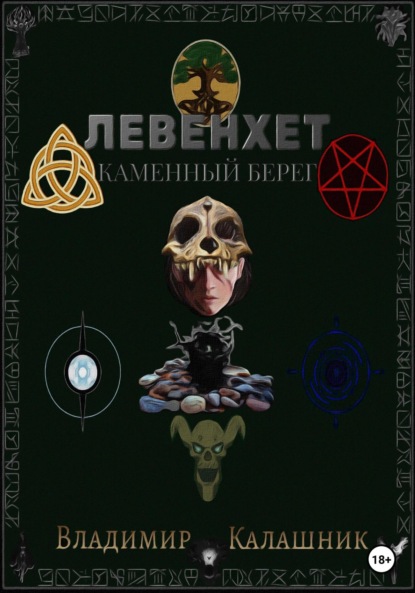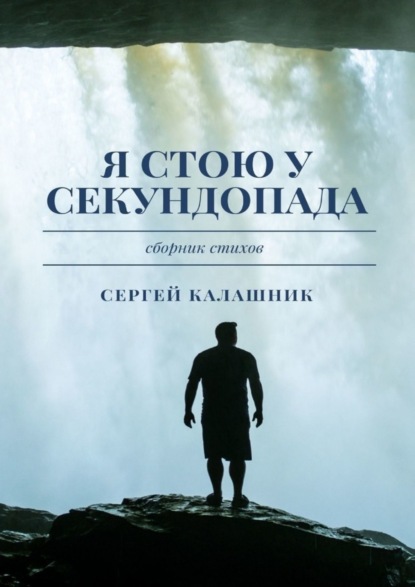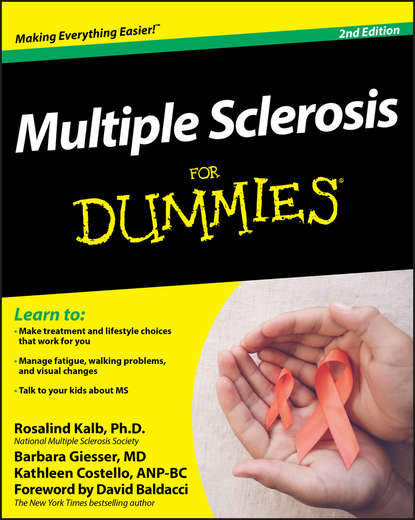Gesprochenes Portugiesisch aus sprachpragmatischer Perspektive
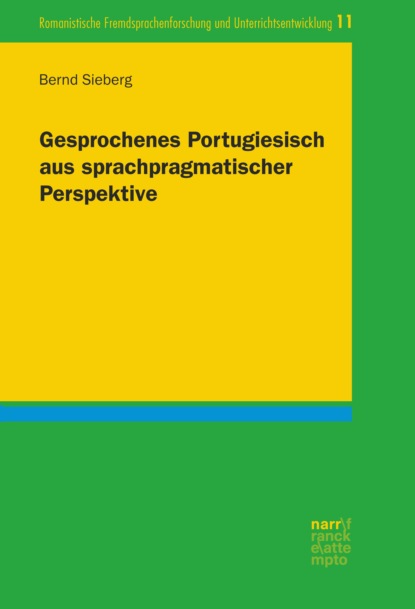
- -
- 100%
- +
Die Beispiele aus dem Bereich „keyboard-to-screen communication“ (Jucker / Dürrscheid 2012, 40) stammen aus einer von mir verfassten Studie aus dem Jahre 2013 zur Kommunikationsplattform ‚Twitter‘ (Sieberg 2013b). Es handelte sich um das internationale Forschungsprojekt „Microblogs global“, das an der Universität Hannover und mittels des Internetportals „mediensprache.net“9 unter Leitung von Siever und Schlobinski durchgeführt wurde. Damals wurden die kommunikative Praktik des Twitterns sowie die Rahmenbedingungen und sprachlichen Besonderheiten ihrer Nutzung aus der Perspektive von zehn Sprachen und elf Ländern – Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, und Spanisch – untersucht. Dabei fiel mir die Rolle zu, die Funktionsweise dieser Kommunikationsplattform und die beim Twittern benutzte Sprache für Portugal zu analysieren. Das Ergebnis dieser Arbeit liegt in Form des Artikels „Microblogs global: Portugiesisch“ des oben erwähnten Buches (Siever / Schlobinski 2013, 231–253) vor. Die Datenerhebung, Zusammenstellung und Auswertung der Tweets erfolgte in den Jahren 2010 und 2011 und umfasst insgesamt 640 Tweets in portugiesischer Sprache, mit insgesamt 8156 Wörtern aus 64 Accounts. Bei den Twitterern handelte es sich zur Hälfte um weibliche und bei der anderen Hälfte um männliche ‚User‘. Im Gegensatz zum ‚C-ORAL-ROM-Korpus‘ wurden die vorgefundenen sprachlichen Ausdrücke in ihrer ursprünglichen Form belassen. Unberücksichtigt blieb dabei, dass die von den Twitterern benutzen Formen oft von der Standardorthographie und den graphostilistischen Normen der portugiesischen Schriftsprache abwichen. Die am Projekt beteiligten Forscher waren sich des Umstandes bewusst, dass es insbesondere diese ‚Fehler‘ sind, die Aufschlüsse darüber liefern, wie ‚User‘ den verbalen Code unter Ausnützung der spezifischen Möglichkeiten der Kommunikationsplattform Twitter zur Informationsübermittlung einsetzen.
Die entsprechenden Quellen für die analysierten Beispiele zum Portugiesischen werden im Text folgendermaßen gekennzeichnet: (5) Korpus Sieberg (2013b) – Microblogs global: Portugiesisch. Einige wenige Beispiele wurden, wenn erforderlich, auch dem von mir aufgestellten Korpus zum Sprachgebrauch in portugiesischen Weblogs (Sieberg 2006b) entnommen. Die entsprechende Kennzeichnung erfolgt mittels der Markierung Korpus Sieberg (2006b) – Weblogs in Portugal.
Der Grund, warum diese Computer vermittelten Kommunikationsformen mit in die vorliegende Untersuchung einbezogen werden, liegt hauptsächlich an der oft dialogischen Form der sequentiellen Abläufe dieser peripheren Formen des Nähesprechens, die sprachliche Ausdrücke und Strukturen hervorbringen, die denen der prototypischen Formen des Nähesprechens – Alltagsdialoge in all ihren Varianten – ähneln. Ich denke in diesem Zusammenhang u.a. an das Vorkommen von ‚Reaktiven‘, von Varianten einer ‚aggregativen Rezeptionssteuerung‘ sowie von ‚adjazenten Strukturen‘ und die aus ihnen resultierenden ‚elliptischen Ausdrucksweisen‘ etc.
Die relativ beschränkte Zahl von Korpora und Transkriptionen, die bei der vorliegenden Studie als Beispiele genannt werden, lässt sich dadurch rechtfertigen, dass ich mit dieser Arbeit nicht die Intention verbinde, statistisch erhärtete Nachweise für die Gültigkeit von Hypothesen hinsichtlich des Vorkommens bestimmter sprachlicher Phänomene aufzustellen. Im Fokus des Interesses stehen vielmehr generelle Aussagen zum mündlichen / nähesprachlichen Gebrauch des verbalen Codes im Portugiesischen sowie der Veranschaulichung und Erläuterung von sprachlichen Erscheinungen, die diese Verwendungsweise charakterisieren bzw. erst ermöglichen.
Bei Zweifeln hinsichtlich der im Text verwendeten Begriffe wird den Lesern empfohlen, das Glossar, das sich am Ende des Buches befindet, als Verständnishilfe heranzuziehen.
Für die Zitate – ausgenommen diejenigen, in denen die ursprüngliche Schreibweise nicht verändert wurde – übernehme ich bei Sätzen auf Portugiesisch die Regeln der Orthographiereform – Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa –, die in Portugal seit 2009 offiziell gelten10.
Wenn in den folgenden Kapiteln wiederholt von ‚Referenzgrammatiken des Portugiesischen‘ die Sprache ist, sind folgende Grammatiken gemeint: (a) „Gramática da Língua Portuguesa“ von Mateus et al. (72006); (b) „Gramática do Português“ (Vol. I und II) von Raposo et al. (2013), (c) die „Portugiesische Grammatik“ von Hundertmark-Santos Martins (32014) und (d) die „Nova Gramática do Português Contemporânea“ von Celso Cunha und Lindley Cintra (172002). Die bibliographischen Angaben werden nicht bei jeder Erwähnung dieser Referenz explizit aufgeführt, finden sich aber noch einmal ausführlich in den „Bibliographischen Hinweisen“ am Ende des Buches.
Einfache deutsche Anführungszeichen ‚ ‘ werden zur Hervorhebung bestimmter Schlüsselworte der vorliegenden Arbeit benutzt, wie z.B. des Begriffs ‚O-SK-ST‘ oder bei aufeinanderfolgenden Wörtern, die sich dadurch von ihrem Umgebungstext unterscheiden, dass sie eine begriffliche Einheit darstellen, wie z.B. ‚Sprecher 4‘. Solche Ausdrücke kann man als zusammengehörige Wortgruppen auffassen, ohne dass es sich hierbei um Zitate im engeren Sinne des Wortes handelt. Auch sehr oft wiederholte Fachtermini und Begriffe, deren Quelle bereits vorher angegeben wurde, stehen in einfachen Anführungstrichen.
Kursivschrift wird ausschließlich zur Kennzeichnung portugiesischer Texte genutzt – also zur Kennzeichnung der Objektsprache der Arbeit –, die in Beispielen und Zitaten vorkommen.
Für die Gliederung des Textes werden arabische Zahlen in der Form 1. 2. 3. 3.1 (ohne Punkt hinter der letzten Zahl) benutzt; im Fließtext dienen hingegen in Klammern gesetzte Buchstaben (a), (b), (c), etc. einer erforderlichen Textgliederung.
Durch Unterstreichungen werden nur Wörter oder Wortgruppen aus den Beispielsätzen (Transkriptionen) hervorgehoben, die bei den anschließenden Interpretationen thematisiert werden.
Wenn ein Zitat mindestens drei oder mehr Zeilen umfasst, wird es aus dem Fließtext hervorgehoben und durch einen größeren Abstand zu beiden Seitenrändern sowie einen engerem Zeilenabstand gekennzeichnet. In diesem Falle werden die Zitate nicht in Anführungszeichen gesetzt.
Abkürzungen oder grobe orthographische (authentische) Schnitzer, die insbesondere in den kommunikativen Praktiken der ‚keyboard-to-screen communication‘ das Verständnis erschweren, wurden nur in den Fällen verbessert, in denen die entsprechenden Ausdrücke unleserlich oder zweideutig sind. Ansonsten werden Wortspielereien und graphostilistische Abweichungen von den üblich geltenden Normen des schriftsprachlichen Ausdrucks in ihrer originalen Form belassen.
Die Namen der Gesprächsteilnehmer an kommunikativen Praktiken der ‚keyboard-to-screen communication‘ werden durch die ‚groß‘ und in ‚Fettdruck‘ geschriebenen Anfangsbuchstaben dieser ‚User-Namen‘ abgekürzt, um ihre Anonymität zu gewährleisten.
Um die Leserlichkeit des Fließtextes nicht durch die Angaben umfangreicher Quellen aus dem Internet zu beeinträchtigen, werden die entsprechenden URL jeweils in Fußnoten angegeben. Im Fließtext verbleiben als Referenz nur passende Schlüsselwörter – z.B. mediensprache.net –, die dem Leser einen ersten Hinweis auf die Quelle liefern.
Den Regeln der CLUL zufolge werden alle Wörter sowie ihre entsprechenden Varianten transkribiert, wenn sie als Lemmata in einem portugiesischen Wörterbuch registriert sind (z.B. mostrar/amostrar, louça/loiça, cacatua/catatua).
Den Regeln der CLUL zufolge werden Eigennamen in den Transkriptionen groß geschrieben.
Den Regeln der CLUL zufolge werden Namen von Filmen, Büchern, Zeitungen und Zeitschriften, Fernseh- und Radioprogrammen, Musikbands, Musiktitel etc. klein geschrieben und in Anführungsstriche gesetzt, wie z.B. „crónica dos bons malandros“, „pixote“, „requiem“, „expresso“, „feira franca“, „big brother“ etc.
Den Regeln der CLUL zufolge werden Fremdwörter den orthographischen Regeln ihrer Herkunftssprachen entsprechend wiedergegeben. Diese Regelung betrifft allerdings nur die Fälle, in denen ihre Aussprache der Originalaussprache annähernd entspricht (ex. cachet, feeling, free-lancer, stress, voyeurs, workshop). Wenn es sich hingegen um Lehnwörter handelt, die sich weitgehend der portugiesischen Aussprache angepasst haben, werden diese Wörter so geschrieben, wie sie in den einschlägigen portugiesischen Wörterbüchern verzeichnet sind, wie z.B. shortezinho, stressado, videozinho etc.
Den Regeln der CLUL zufolge werden sowohl die zunächst falsch ausgesprochenen als auch die nachträglich korrigierten Wörter transkribiert, wie z.B. lugal/lugar, sau/céu etc. In den Fällen hingegen, in denen ein Sprecher ein falsch ausgesprochenes Wort nicht nachträglich verbessert und seine Äußerung fortsetzt, wird ausschließlich die korrekte Form transkribiert.
Den Regeln der CLUL zufolge werden Onomatopoeia und parasprachliche Elemente, die sich nicht in einem Wörterbuch finden, in den Transkriptionen so wiedergegeben, dass sie sich so weit wie möglich der Aussprache der Sprachaufnahmen annähern, wie z.B. pac-pac-pac, pffff, tanana, tatata, uuu etc.
Den Regeln der CLUL zufolge werden Interjektionen den gültigen lexikographischen Regeln entsprechend transkribiert.
Den Regeln der CLUL zufolge werden Akronyme und Abkürzungen in Großbuchstaben und ohne zwischengestellte Punkte wiedergegeben (z.B. TAP statt T.A.P.). Wenn aber die entsprechenden Akronyme bereits in einem portugiesischen Wörterbuch registriert sind, werden sie kleingeschrieben, wie z.B. sida oder radar.
Den Regeln der CLUL zufolge werden alle nicht standardsprachlichen oder von der Gewährsperson erfundenen Ausdrücke so transkribiert, dass sie sich so weit wie möglich der Aussprache dieser Gewährspersonen anpassen. Für die Leser dieses Buches habe ich entsprechende Verständnishilfen in Fußnoten beigefügt, sollte zu erwarten sein, dass Leser diese Ausdrücke nicht verstehen.
Den Regeln der CLUL zufolge werden durch die Gewährspersonen abgekürzte Wörter in dieser Form beibehalten, wie z.B. Prof.
Den Regeln der CLUL zufolge werden alle Zahlen einschließlich Kalenderdaten und in Prozentangaben enthaltene Zahlen bis einschließlich der Zahl ‚zwölf‘ ausgeschrieben.
Im Buch benutzte Abkürzungen:
GSF Gesprochene-Sprache-Forschung: Gemeint ist die in den 70er Jahren in der germanistischen Sprachwissenschaft entstandene Forschungsrichtung, die zusammen und in gegenseitiger Ergänzung mit der ‚Gesprächsanalyse‘ der ‚Interaktionalen Linguistik‘ und der ‚Construction Grammar‘ Erscheinungen des mündlichen Gebrauchs des verbalen Codes bzw. des Nähesprechens untersucht. GS Gesprochene Sprache GSFP Diese Abkürzung bezeichnet die Gesprochene-Sprache-Forschung des Portugiesischen. IDS Abkürzung für Institut für Deutsche Sprache m.E. meines Erachtens O-SK-ST Operator -Skopus-Struktur FLUL Faculdade de Letras de Lisboa UL Universidade de Lisboa CLUL Centro de Linguística da Universidade de Lisboa4. Theoretisch-methodischer Rahmen der Untersuchung
Um die konzeptionell-methodischen Grundlagen, ihre Begriffe und die benutzte Terminologie zu verdeutlichen, die aus der germanistischen GSF stammen und als Basis dieses Buches und seines Ziels einer Beschreibung der portugiesischen gesprochenen Sprache aus der Sicht der Sprachpragmatik dienen, setzt dieses Kapitels mit einer Erläuterung des Begriffs der „konzeptionellen Mündlichkeit“1 ein. Diesen hat der Romanist Ludwig Söll (1985) Mitte der 80er Jahre in die GSF eingeführt und dadurch ihren weiteren Weg entscheidend beeinflusst2, weil dieser Begriff es erlaubt, die Einseitigkeit der Dichotomie ‚medial mündlich‘ versus ‚medial schriftlich‘ aufzuzeigen. Die ursprüngliche Unterscheidung in ‚gesprochen versus geschrieben‘ entspricht zwar dem ‚gesunden Menschenverstand‘ und erlaubt zudem eine eindeutige Unterscheidung zwischen zwei Gruppen von Textsorten – bzw. meiner Terminologie folgend von „kommunikativen Praktiken“3 –, doch bekommen Sprachwissenschaftler mit dieser Unterscheidung Probleme, wenn sie erklären sollen, warum viele Praktiken medialer Schriftlichkeit wie ‚Einträge in Tagebücher‘, ‚Grußkarten‘ oder insbesondere die aktuellen Praktiken der ‚keyboard-to-screen communication‘ von ihren sprachlichen Merkmalen her große Ähnlichkeiten mit medial mündlichen Praktiken aufweisen, und es umgekehrt medial mündlich basierte Kommunikationsformen wie ‚Predigten‘ oder ‚Begrüßungsansprachen‘ gibt, die von ihren sprachlichen Charakteristika eher der Gruppe schriftlich vermittelter Texte zuzuordnen sind.
Die Auflösung dieses Dilemmas leistet Sölls Begriff der „konzeptionellen Mündlichkeit“ (Söll 1985). Er stellt nicht die Medialität einer kommunikativen Praktik in den Vordergrund, sondern geht zum Zweck ihrer kategorialen Bestimmung von einem Bündel von Kriterien aus. Zu ihnen zählen ‚Dialogizität, ‚Spontanität‘, ‚Situationseinbindung‘, ‚Grad der Expressivität‘ etc. Aus der Anwendung dieser Kriterien resultiert die Vorstellung eines Kontinuums zwischen dem Pol einer extrem ‚konzeptionellen Mündlichkeit‘ und dem einer extrem ‚konzeptionellen Schriftlichkeit‘, in das sich Textexemplare4 bzw. kommunikative Praktiken entsprechend ihrer jeweiligen sprachlichen Charakteristika einordnen lassen. Auf dieser graduell verlaufenden Skala nehmen sowohl medial mündlich als auch medial schriftlich basierte Kommunikationsformen ihren Platz ein, wie die folgende Skizze5 verdeutlicht. Auf der folgenden Skala, die ausschließlich einer idealisierten, exemplarischen Veranschaulichung dient, findet der Leser allerdings nur einige wenige Praktiken, weil sie nicht mit dem Anspruch entworfen wurde, die Ergebnisse tatsächlich durchgeführter Analysen zu verdeutlichen 6:
Konzeption Nähepol ←–––––––––––––––––––→ Distanzpol konzeptionell mündlich konzeptionell schriftlich medial schriftlich Chatbeitrag Tweet Eintrag in ein Tagebuch Liebesbrief medial mündlich Alltagsdialog mit Freunden Interview in öffentlichen Medien FesttagsredeZu dieser Skala ist noch anzumerken, dass der dem Nähepol zugewandte Bereich überwiegend von medial mündlich basierten kommunikativen Praktiken des prototypischen Nähesprechens, wie z.B. von Alltagsdialogen, eingenommen wird, während periphere und schriftlich basierte Praktiken der Nähekommunikation eine Verortung näher hin zum ,Distanzpol‘ nahelegen.
Koch / Oesterreicher (1985 und 1994) nutzen dieses Konzept Sölls. Sie führen zusätzlich zur terminologischen Bezeichnung dieses Gegensatzpaares die Begriffe „Sprache der Nähe“ und „Sprache der Distanz“ ein, verfeinern darüber hinaus das Raster der Kriterien zur Verortung eines Textes bzw. einer kommunikativen Praktik im Kontinuum der Skala zwischen Nähe und Distanz – den Autoren folgend gehören diese Kriterien entweder den „Kommunikationsbedingungen“ oder den „Versprachlichungsstrategien“ an – und gelangen so zu ihrem über die Grenzen der Romanistik und germanistischen GSF bekannt gewordenen Modell des ‚Nähe- und Distanzsprechens‘.
Das an dieser Stelle benutzte Modell des Nähe- und Distanzsprechens von Ágel / Hennig greift zwar das Basiskonzept des ursprünglichen Modells auf, entwickelt es aber im Sinne einer Homogenisierung und strengen Hierarchisierung weiter. Diese Optimierung betrifft in erster Linie eine Korrektur der Kriterien, die Koch / Oesterreicher ursprünglich zur Bestimmung der Nähesprachlichkeit eines Textes im Kontinuum der Skala zwischen Nähe- und Distanzpol benutzt hatten. Dabei werden in der neuen Version des Modells alle von Koch / Oesterreicher benutzten Kriterien weggelassen, die sich nicht direkt aus dem Axiom „Zeit und Raum der Produktion = Zeit und Raum der Rezeption einer Äußerung“ ableiten lassen. So haben nach Meinung von Ágel / Hennig Kriterien wie „Vertrautheit der Partner“, „Spontanität“, „Grad der Öffentlichkeit“ (cf. Koch / Oesterreicher 1985 und 1994) keinen Platz in dem von ihnen vorgeschlagenen Modell, weil diese Kriterien sich nicht direkt aus dem Axiom ihres Modells ableiten lassen. Sie würden eine operationalisierbare Anwendung für die Analyse von Texten sowie die Objektivität der resultierenden Ergebnisse gefährden. Für eine quantitative und qualitative Bestimmung von Textexemplaren und kommunikativen Praktiken sowie ihrer hieraus resultierenden Verortung auf der Skala zwischen Nähe und Distanz bleiben folglich ausschließlich die unten in der schematischen Darstellung dieses Modells (fünf Schemata) dargestellten Kriterien in Form von ‚Universalen Diskursverfahren‘ und ‚einzelsprachlichen Merkmalen‘ übrig.
Um eine entsprechende Analyse an einem Beispiel zu veranschaulichen: Findet man in einem portugiesischen Alltagsgespräch am Ende eines Sprechbeitrags wiederholt die Form não é, oder zwischen den ‚turns‘ der an einem Dialog beteiligten Gesprächsteilnehmer die häufig eingestreute Form pois, lassen sich diese Ausdrücke im Rahmen des Modells dem universalen Diskursverfahren „Engführung der Orientierung“ zuordnen. Dieses Verfahren wiederum kann auf den Umstand zurückgeführt werden, dass Zeit und Raum der Produktion von Äußerungen mit der Zeit und dem Raum der Rezeption dieser Äußerungen zusammenfallen (cf. Axiom des Modells). Dass es unter diesen situativen Umständen prototypischen Nähesprechens für Sprecher und Hörer fast zwingend naheliegt, ein gegenseitiges Verständnis ihrer Äußerungen durch den häufigen Gebrauch entsprechender sprachlicher Formeln – im Portugiesischen u.a. durch die oben erwähnten sprachlichen Ausdrücke pois oder não é – anzustreben, ist logisch und ergibt sich als universal gültige Konsequenz aus dem Axiom des Modells.
Anders würde es sich verhalten, wenn es nachzuweisen gelte, welcher „Grad der Vertrautheit“ zwischen Sprecher und Hörer besteht – bei Koch / Oesterreicher (2011, 7) eines der ursprünglich vorgeschlagenen Kriterien aus der Gruppe der „Kommunikationsbedingungen“ –, weil es sich hierbei um ein Kriterium handelt, das sich objektiv kaum nachweisen lässt und somit einer operationalisierbaren Anwendung des Modells im Wege stünde.
Universale Geltung kann das Modell beanspruchen, weil man für alle Sprachen und für die in ihnen stattfindenden Dialoge annehmen darf, dass sie auf gegenseitiges Verständnis ausgerichtet sind und sich am gleichen Diskursverfahren einer ‚Engführung der Orientierung‘ orientieren, auch wenn dabei die sprachlichen Mittel jeweils unterschiedlich ausfallen, durch die sich dieses Diskursverfahren in den unterschiedlichen Sprachen manifestiert.
Bei der folgenden schematischen Darstellung des Modells von Ágel / Hennig gilt es einige von mir eingeführte Vereinfachungen bzw. Veränderungen zu beachten. Dabei gehe ich davon aus, dass sie die ursprüngliche Form des Models weder sinnwidrig verzerren, noch im Widerspruch zu seinen Grundvoraussetzungen stehen: (a) So handelt es sich um eine vereinfachende Darstellung, die zwei höhere Abstraktionsstufen, die Ágel / Hennig bei der Darstellung ihres Models benutzen (2007, 179), außer Acht lässt. Damit beziehe ich mich auf die in der Hierarchie des Models oberhalb der „Universalen Verfahren der Diskursgestaltung“ angeordneten Ebenen „Universale Parameter der Diskursgestaltung“ sowie „Universale Parameter der Kommunikation“ (Ágel / Hennig 2007, 184sq.). In einem zusätzlichen Schritt verkürze ich mit dem Ziel einer verbesserten Lesbarkeit den Terminus „Universale Verfahren der Diskursgestaltung“ zu ‚Universale Diskursverfahren‘. Dabei bleibe ich bei der ursprünglichen Bestimmung, die Ágel / Hennig für diesen Begriff vorsehen: „Um einen Diskurs bspw. interaktiv zu gestalten, wenden Kommunikationsteilnehmer bestimmte Verfahren an (wie bspw. das Verfahren der Rezeptionssteuerung), die wir deshalb ‚Universale Verfahren der Diskursgestaltung‘ nennen“ (Ágel / Hennig 2007, 185). Diese Definition bleibt auch an dieser Stelle gültig, mit der Einschränkung, dass der Terminus „Universale Verfahren der Diskurgestaltung“ im folgenden Text durch ‚Universale Diskursverfahren‘ ersetzt wird, und dass ich in den folgenden Kapiteln den Ausdruck im Fließtext zudem kleinschreiben und ohne Anführungsstriche darstellen werde. (b) Die Schemata weiter unten, die das ‚Universale Axiom‘ des Models, seine ‚Universalen Diskursverfahren‘ sowie die ihnen entsprechenden ‚einzelsprachlichen Merkmale‘ der portugiesischen Sprache7 zuordnen, bilden die Grundlage für die Gliederung dieser Arbeit und spiegeln sich ebenfalls im Inhaltverzeichnis des Buches wider. (c) Die Bezeichnungen für die verschiedenen universalen Diskursverfahren – wenn man von dem an dieser Stelle vereinfachten Terminus ausgeht – übernehme ich weitgehend und zum Teil wörtlich von Ágel / Hennig (2007, 189sqq.). Die Benennungen der einzelsprachlichen Merkmale hingegen, die in den Schemata jeweils den universalen Diskursverfahren zugeordnet sind, richten sich nach den thematisierten sprachlichen Phänomenen sowie den Begriffen und Termini, die auch in der portugiesischen Fachliteratur zur ihrer Kennzeichnung benutzt werden. Im Inhaltsverzeichnis dieser Arbeit erscheinen universale Diskursverfahren und sprachliche Merkmale als Titel und Untertitel der Kapitel, in denen sie erörtert werden. Für ein angemessenes Verständnis bei der Lektüre des Buches sollte der Leser also sein Augenmerk auf die Übereinstimmungen richten, die zwischen den in den folgenden Schemata des Modells genannten universalen Diskursverfahren und sprachlichen Ausdrucksmitteln einerseits, und der Inhaltsgabe und den in den Kapiteln des Buches thematisierten Inhalten andererseits, bestehen. (d) Im Zusammenhang mit der Analyse von kommunikativen Praktiken der ‚keyboard-to-screen communication‘ interpretiere ich das Axiom des Modells in dem Sinn, dass sich ihm auch der Begriff eines ‚virtuellen Raums‘ (Internet) sowie einer ‚subjektiv empfundenen Zeit‘ zuordnen lassen – letztere ist als empfundener Zeitmangel kennzeichnend für im Internet kommunizierende ‚User‘ und charakterisiert ihre rasch ablaufenden Routinehandlungen am Computer. Auch andere Faktoren, die als spezifische Rahmenbedingungen das Funktionieren einer ‚keyboard-to-screen communication‘ steuern, wie z.B. die Möglichkeit des Postens von Retweets oder zitierten Tweets beim Twittern, lassen sich m.E. in dieses erweiterte Modell integrieren und helfen, den Gebrauch bestimmter sprachlicher Ausdrucksmittel des Nähesprechens zu verstehen.
Die folgenden fünf Schemata veranschaulichen den Zusammenhang zwischen dem „Universalen Axiom“ des Modells des Nähe- und Distanzsprechens ‚Zeit/Raum der Produktion = Zeit/Raum der Rezeption einer Äußerung‘ und den Analyseparametern ‚Rolle‘, ‚Zeit‘, ‚Situation‘, ‚Code‘ und ‚Medium‘, im Rahmen derer sich die Interpretation der jeweiligen ‚Universalen Diskursverfahren‘ anbietet. Darüber hinaus listen diese Schemata die ‚sprachlichen Merkmale‘ des Portugiesischen auf, in denen sich diese Verfahren manifestieren.