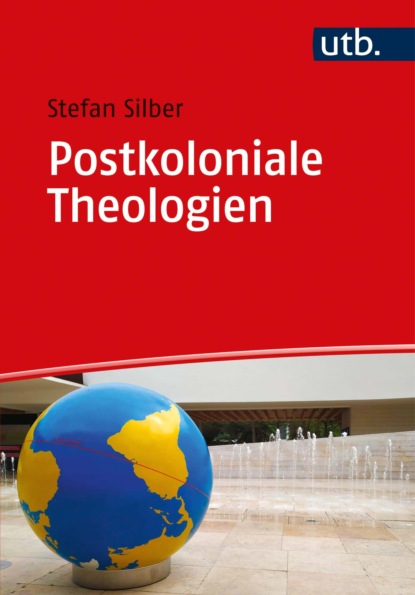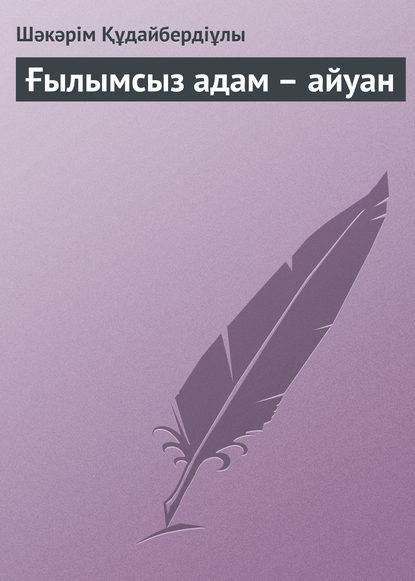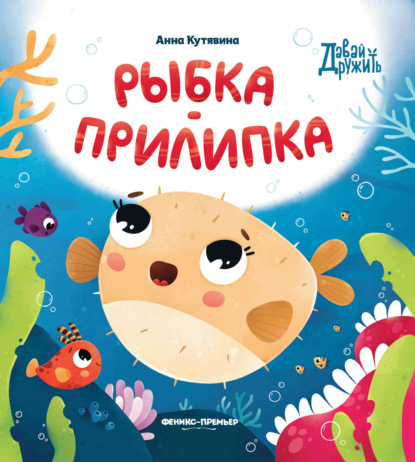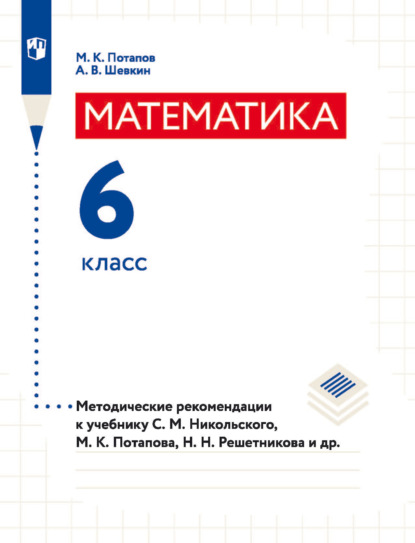- -
- 100%
- +
Einen streng kolonialismuskritischen Akzent erhielt die Diskussion mit der Einführung des Begriffs der ↗ ‚Kolonialität‘ durch den peruanischen Soziologen Aníbal QuijanoQuijano, Aníbal9, der in einem 1992 erschienenen Aufsatz damit die durchgängige Prägung der Denkweise ehemals kolonisierter Staaten und Kulturen bezeichnet, auch wenn die staatliche Unabhängigkeit – wie im Fall Lateinamerikas – schon seit zwei Jahrhunderten vollzogen ist. Für QuijanoQuijano, Aníbal ist diese Denkweise grundlegend im Rassismus begründet und zieht konkrete Auswirkungen auf wirtschaftliche Ausbeutung und soziale Exklusion nach sich. Später wurde der Begriff der Kolonialität in vielfacher Weise auch auf andere postkoloniale Beziehungen erweitert.10 Eine transdisziplinär arbeitende Arbeitsgruppe von WissenschaftlerInnen in Lateinamerika vertiefte unter dem Stichwort „Modernidad/Colonialidad“ oder „Modernität/KolonialitätModernität/Kolonialität“ die wechselseitigen Beziehungen zwischen der europäischen Moderne, dem Kolonialismus und der Kolonialität sowie ihre vielfältigen Konsequenzen in zahlreichen gesellschaftlichen und politischen Bereichen.11
Einer der profiliertesten Vertreter dieser Gruppe, der argentinische Literaturwissenschaftler Walter D. MignoloMignolo, Walter, verweist in seinen Arbeiten auf das prägend kolonialistische Erbe im europäischen Denken seit der Moderne und ruft zum „epistemischen Ungehorsam“12 auf. Darunter versteht er ein Denken über die von der kolonialen ↗ Epistemologie vorgegebenen Grenzen hinaus. Zahlreiche dekoloniale TheoretikerInnen greifen daher auf indigenes und afroamerikanisches Denken zurück und konstruieren von dort aus Kritiken an europäischen und kolonialen Denksystemen.13
Nicht nur in Lateinamerika ist das postkoloniale Denken sehr stark vom FeminismusFeminismus beeinflusst. Zahlreiche AutorInnen weltweit analysieren die wechselseitigen Beziehungen von Kolonialismus und Sexismus, in denen beide sich wechselseitig bestärken und aufgrund derer das koloniale Denken sich bis heute in besonderer Weise im Geschlechterverhältnis äußert. Die argentinische Anthropologin Rita SegatoSegato, Rita untersucht beispielsweise die komplexe Interdependenz zwischen Kolonialismus, Sexismus und Rassismus im Leben indigener Völker.14 Dass ein postkolonialer feministischer Diskurs auch nichtsprachliche Elemente einschließen muss, zeigt die bolivianische Soziologin Silvia Rivera CusicanquiRivera Cusicanqui, Silvia, die unter anderem Bilder, Theater, Webarbeiten und das Teilen von Essen in ihre soziologischen Arbeiten integriert.15
Heterogenes und differenziertes FeldNicht nur diese letzten Beispiele machen bereits deutlich, dass es sich bei den postkolonialen Studien um ein äußerst vielschichtiges, heterogenes und differenziertes Feld handelt. Es befindet sich auch in der Gegenwart immer noch in der Entwicklungsphase und verändert sich in dynamischer Weise. Diese Unübersichtlichkeit ist durchaus verständlich, denn die postkoloniale Kritik bezieht sich ausdrücklich auf bestimmte konkrete Kontexte, die von ihrer jeweiligen Geschichte, Kultur und Politik geprägt sind. Dass die Ergebnisse dann sehr unterschiedlich ausfallen, muss geradezu erwartet werden. Auch dass zwischen VertreterInnen postkolonialer Theorien bisweilen heftige Konflikte ausbrechen oder bestehen, kann nicht verwundern. Denn keine dieser Theorien kommt ohne einen – wie auch immer gearteten – Bezug auf die europäische Geistesgeschichte aus, während diese von ihnen ja zugleich aufs Schärfste kritisiert wird. Der indische Historiker Dipesh ChakrabartyChakrabarty, Dipesh nennt dies ein „postkoloniales Dilemma“:
„Die Gedankenwelt, die während des Zeitalters der europäischen Expansion und Kolonialherrschaft entstand, erscheint zur Beschreibung und Analyse der eigenen (nichtwestlichen) Geschichte und Gesellschaft ebenso unverzichtbar wie ungenügend.“16
GemeinsamkeitenTrotz der teils konfliktiven Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen postkolonialen Strömungen und ‚Schulen‘ lässt sich als Gemeinsamkeit zwischen ihnen erkennen, dass sie den Kolonialismus nicht nur als ein Geschehen in der Vergangenheit betrachten, sondern seine gegenwärtigen Konsequenzen (im kulturellen, epistemischen, soziologischen, wirtschaftlichen, politischen – und eben auch religiösen Bereich) als eine grundlegende Ursache von Konflikten und Problemen der Gegenwart analysieren. Diese Kritik wird heute in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen geübt, in interdisziplinären Arbeiten und in Versuchen, die starre Einteilung in wissenschaftliche Disziplinen, die ebenfalls der europäischen Geistesgeschichte geschuldet ist, zu überwinden, die Wissenschaften zu „entdisziplinieren“17.
Der Fokus auf die Kritik an Kolonialismus und Kolonialität bringt es mit sich, dass die Gefahr besteht, postkoloniale Kontexte und Kulturen auf ihre postkoloniale Kondition zu reduzieren. Auf diese Weise würde der Postkolonialismus selbst in der Falle des ↗ Eurozentrismus verbleiben. Das von MignoloMignolo, Walter und anderen eingeforderte Denken über die Grenzen hinaus und die beispielsweise von BhabhaBhabha, Homi und SaidSaid, Edward ermöglichten Perspektivwechsel in der Analyse der kolonialen und postkolonialen Beziehungen öffnen aber vielfältige Auswege aus dem Dilemma. Die theologischen Beispiele in diesem Buch werden einige dieser Auswege vorstellen und zugleich die inhaltliche und methodische Vielfalt in der Auseinandersetzung mit dem Erbe des Kolonialismus sichtbar machen.
Literaturhinweise
Seit einigen Jahren gibt es einige sehr gute Einführungen in postkoloniale Theorien in deutscher Sprache. Insbesondere muss hier die schon klassische Einführung von María do Mar Castro VarelaCastro-Varela, María do Mar und Nikita DhawanDhawan, Nikita18 genannt werden, die inzwischen in dritter, erweiterter Auflage vorliegt. Sie ist vor allem kulturwissenschaftlich ausgerichtet und orientiert sich in erster Linie an SaidSaid, Edward, SpivakSpivak, Gayatri und BhabhaBhabha, Homi und damit an den anglophonen, asiatischen Varianten der postkolonialen Theorien.
Einen anderen Weg geht Ina KernerKerner, Ina mit ihrer stärker politikwissenschaftlich akzentuierten Einführung19, die thematisch gegliedert ist. Sie greift über den asiatischen Kontext hinaus und behandelt gezielt auch sozioökonomische Themen des Postkolonialismus. Eine gute Einführung in die Grundbegriffe der postkolonialen Studien findet sich auch in dem theologischen Sammelband von Andreas NehringNehring, Andreas und Simon WiesgicklWiesgickl, Simon (geb. TieleschWiesgickl, Simon)20. Sie setzen die Darstellung zentraler Themen der postkolonialen Theorien gleich in Beziehung mit der Theologie.
Bereits 2002 gaben Sebastian ConradConrad, Sebastian und Shalini RanderiaRanderia, Shalini einen Sammelband21 heraus, in dem Übersetzungen von wichtigen Texten der postkolonialen Studien für die deutschsprachige Öffentlichkeit bereitgestellt wurden. Sie eignen sich für einen ersten Einstieg in die globale Diskussion; die Einleitung der HerausgeberInnen verbindet diese mit deutschen und mitteleuropäischen Kontexten.
Im Sammelband „Schlüsselwerke der Postcolonial Studies“ von Julia ReuterReuter, Julia und Alexandra KarentzosKarentzos, Alexandra22 stellen deutschsprachige AutorInnen einige der auch hier schon genannten AutorInnen und Arbeiten (sowie einige weitere) vor. Darüber hinaus wird die Rezeption der postkolonialen Theorien in verschiedenen akademischen Disziplinen untersucht und besprochen. Die wichtige Frage, wie der Kolonialismus deutsche Geschichte, Kultur und Wissenschaft prägt, untersuchen zahlreiche AutorInnen aus unterschiedlichen Fachbereichen in dem von Marianne Bechhaus-GerstBechhaus-Gerst, Marianne und Joachim ZellerZeller, Joachim editierten Buch „Deutschland postkolonial?“23.
Das „Handbuch Postkolonialismus und Literatur“, das Dirk GöttscheGöttsche, Dirk, Axel DunkerDunker, Axel und Gabriele DürbeckDürbeck, Gabriele herausgegeben haben24, stellt auf wenigen Seiten ebenfalls SaidSaid, Edward, SpivakSpivak, Gayatri und BhabhaBhabha, Homi sowie summarisch weitere anglophone und frankophone AutorInnen vor. Neben einem Blick in verschiedene Fächer der Literaturwissenschaft und unterschiedliche Sprachräume findet sich hier auch ein lexikalischer Überblick über 30 wichtige postkoloniale Begriffe, die vor allem, aber nicht nur in der Literaturwissenschaft eine Rolle spielen.
1.3 Postkoloniales Deutschland?
Die historische Verstrickung Deutschlands1 in den Kolonialismus ist in unserem Bewusstsein normalerweise nicht so präsent wie die Verantwortung anderer europäischer Staaten wie Großbritannien, Frankreich und Spanien. Aus diesem Grund werden auch postkoloniale Theorien in Deutschland bislang deutlich weniger zur Kenntnis genommen als dies beispielsweise im anglophonen Raum der Fall ist2.
Tatsächlich wird selbst die explizite Kolonialgeschichte3 Deutschlands in vielen Bereichen nach wie vor ignoriert. Insbesondere die Politik tut sich schwer mit einer Anerkennung der von deutschen Militärs und Kolonialbeamten etwa im heutigen Namibia begangenen Verbrechen. Aber auch Museen, Kunstsammlungen und Universitäten stellen sich häufig nicht der historischen Verantwortung angesichts der bei ihnen lagernden oder ausgestellten Kunst- oder Ritualgegenstände und anderen geraubten Eigentums. Die verwendeten Argumente scheinen dabei gelegentlich direkt der Kolonialzeit entsprungen4. Selbst wenn es um Schädel, Knochen und andere Körperteile von Menschen aus Kolonialgebieten geht, die in anthropologischen oder medizinischen Sammlungen aufbewahrt werden, wehren sich deutsche Verantwortliche bisweilen immer noch gegen eine ordnungsgemäße Rückführung und kulturgerechte Bestattung. Auch kirchlichen Archiven und Museen für Ethnologie und/oder Missionsgeschichte stellen sich diese Herausforderungen5.
Über die tatsächliche Eroberung von Kolonialgebieten für die deutsche Herrschaft hinaus lässt sich in der Literatur des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts eine breite Strömung des Kolonialer Enthusiasmuskolonialen Enthusiasmus ausmachen, in der sich Fernweh, Machtphantasien, Überlegenheitsanspruch, Neugier und handfeste finanzielle Interessen verbinden. Dieser kolonialistische Enthusiasmus ist bruchlos bis in den Nationalsozialismus hinein nachweisbar6.
Darüber hinaus leisteten zahlreiche deutsche SiedlerInnen, Forscher, Militärs, Geschäftsleute, MissionarInnen und Abenteurer, die in den Kolonien anderer europäischer Staaten unterwegs waren, einen Beitrag zum deutschen Kolonialismus, ohne dass ein deutscher Staat oder deutsche Institutionen unmittelbar beteiligt gewesen sein mussten. Durch ihre Kontakte in die Heimat beeinflussten diese Einzelpersonen ebenfalls das koloniale Denken in Deutschland. Nicht zuletzt ist die Bedeutung deutscher Banken für den Kolonialismus nicht zu unterschätzen.
In der Gegenwart sind die Auswirkungen dieser Geschichte subtiler zu erfahren, aber deswegen nicht weniger wirksam7. Sabine JaroschJarosch, Sabine spricht von „Koloniale Wundenkolonialen Wunden“ in der Gegenwart der deutschen Gesellschaft, in denen die Kolonialgeschichte immer wieder schmerzlich zu spüren ist. Sie nennt als Beispiele für solche Wunden unter anderem:
„Bis heute finden sich in zahlreichen deutschen Cafés Statuen oder Bilder von schwarzen DienerInnen. Schokoladenwerbung gebraucht die rassistische Figur des ‚Mohren‘. An rassistischer Sprachpraxis in Kinderbüchern wird vehement festgehalten, auch wenn Betroffene äußern, wie verletzend sie bestimmte Ausdrücke finden. […] Es gibt massiven politischen und gesellschaftlichen Widerstand gegen Initiativen zur Umbenennung von Straßennamen, die nach Kolonialverbrechern benannt sind. Schwarze Menschen und People of Color […] sind häufiger Polizeikontrollen ausgesetzt, weil sie allein aufgrund ihrer Hautfarbe ins ‚Täterprofil‘ passen. Menschen, die keine ‚weiße‘ Pigmentierung aufweisen, werden immer wieder in die Situation gebracht, sich als ‚Geanderte‘ zu fühlen, als nicht zur deutschen Gesellschaft Zugehörige.“8
Zahlreiche Initiativen in größeren deutschen Städten haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Gegenwart des Kolonialen im Alltag sichtbar zu machen und kritisch herauszuheben. Mit alternativen Stadtführungen (teils auch virtuell erlebbar) machen sie auf ProtagonistInnen des Kolonialismus, ehemalige und gegenwärtige Kolonialinstitutionen, Denkmäler und Straßennamen, Namen und Geschäftszeichen von Hotels und Apotheken usw. aufmerksam, um auf die Wirksamkeit kolonialer Denkweisen und Praktiken bis in die Gegenwart hinzuweisen und auf eine Verhaltensänderung hinzuwirken9.
Der Kolonialismus wirkt auch in Erfahrungen von alltäglichem, strukturellem und unterbewusstem Rassismus fort, von denen People of Colour und MigrantInnen in Deutschland berichten. Sie werden häufig mit den kulturellen Erinnerungen an die deutsche Kolonialzeit in Verbindung gebracht, die – wie beschrieben – umfassender ist als die konkrete Kolonialherrschaft des Deutschen Reiches. Ein nicht zu unterschätzendes Problem, das unmittelbar mit dem Kolonialismus zu tun hat, ist die in Deutschland weit verbreitete und vielschichtige Islamfeindlichkeit. Hito SteyerlSteyerl, Hito und Encarnación Gutiérrez RodríguezGutiérrez Rodríguez, Encarnación sprechen bezüglich solcher Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland von der „Koloniale Kontinuitätkoloniale[n] Kontinuität der Bundesrepublik“10 und verweisen insbesondere auf die Arbeiten Schwarzer11 Feministinnen seit den 1980er Jahren.
→ Michael NausnerNausner, Michael, österreichisch-schwedischer Theologe, erinnert daran, dass nicht nur das Christentum in seiner Geschichte eine „intime Komplizität […] mit der Kolonialisierung“12 aufwies, sondern dass die heutigen Migrationsformen eine „Spätfolge“13 dieser Kolonial- und Missionsgeschichte seien. Darüber hinaus erkennt er mehrere Zusammenhänge zwischen Migration und kirchlichem Leben in Mitteleuropa: Religionen spielen zwar einerseits eine wichtige Rolle bei der Integration von MigrantInnen, andererseits führt aber eine starke Zuwanderung auch zur Bildung von Diaspora-Religionen und christlichen Gruppen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Auf diese Weise tragen migrantische christliche Gruppen auch postkoloniale Konfliktkonstellationen in Kirchen und Gemeinden Mitteleuropas. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden plädiert NausnerNausner, Michael dafür, die theologische Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Migration nicht allein der praktischen Theologie und der Missionswissenschaft zu überlassen, sondern auch in der systematischen Theologie nach den grundlegenden Konsequenzen dieser komplexen Herausforderung für Theologie und Kirchen hierzulande zu fragen14.
Der deutsche Theologe Simon WiesgicklWiesgickl, Simon, der auch in Hongkong lehrte, hat in seiner Dissertation gründlich herausgearbeitet, wie die Entstehung und Entwicklung der historisch-kritischen Exegese in Deutschland einerseits ohne den Kolonialismus nicht denkbar gewesen wäre und sie andererseits aber auch zahlreiche Denkmuster und Stereotypen des kolonialen Zeitalters integrierte. So lassen sich in exegetischen Texten der ↗ Eurozentrismus, der Überlegenheitsanspruch deutscher ExpertInnen und sogar Wechselwirkungen mit dem Antisemitismus zeigen, die alle auch eine wichtige Rolle in der Kolonialideologie deutscher Prägung spielen. Solche kritischen Untersuchungen wären auch in anderen theologischen und theologiegeschichtlichen Bereichen überaus wünschenswert15.
Eine weitere Postkoloniale Realität in der deutschen Kirchepostkoloniale Realität in der deutschen Kirche besteht bis heute in den vielschichtigen Beziehungen zwischen Deutschland und früheren Kolonialstaaten auch anderer Länder durch Ordensgemeinschaften und Hilfswerke. Diese Beziehungen bestehen teilweise bereits seit vielen Jahrzehnten und haben in dieser Zeit auch bereits vielfach ihren Charakter transformiert. Dennoch beruhen sie ursprünglich auf kolonialen Verhältnissen, die nicht immer hinreichend im kritischen Bewusstsein sind. Die Diskussion postkolonialer Theorien wurde in manchen dieser Institutionen jedoch bereits aufgenommen16.
Eine grundlegende Nachwirkung des Kolonialismus in Deutschland, die vielfache Konsequenzen nach sich zieht, lässt sich schließlich auf ↗ epistemologischer Ebene greifbar machen: Der europäische Kolonialismus insbesondere des 19. Jahrhunderts wäre nicht denkbar gewesen ohne die ideologischen Voraussetzungen des deutschen Idealismus und der Aufklärung insgesamt. Gayatri SpivakSpivak, Gayatri merkt hierzu an, dass Deutschland eine zentrale philosophische und intellektuelle Rolle bei der Ausarbeitung und Durchführung einer kolonialen Ideologie spielte: „Das kulturelle und intellektuelle ‚Deutschland‘ […] war die Hauptquelle der pedantischen Denkrichtung, die eine Identitätsbegrifflichkeit einführte,“17 die zur Benennung, Bewertung und Einhegung kolonialer Erfahrungen diente. Unter ausdrücklicher Bezugnahme auf KantKant, Immanuel, HegelHegel, Georg Wilhelm Friedrich und MarxMarx, Karl schreibt sie: „Deutschland produzierte die autorisierten ‚universalen‘ Erzählungen, in denen das Subjekt unweigerlich ein europäisches war.“18
Diese Philosophien des 18. und 19. Jahrhunderts prägen deutsche Denkweise bis in die Gegenwart. Das identitäre Denken vom so genannten ‚christlichen Abendland‘ ist nur ein Beispiel für den Ausschluss scheinbar fremder oder ‚anderer‘ Kulturen von einer unterstellten ‚Leitkultur‘. Auch der in vielen Bereichen nach wie vor wirksame Eurozentrischer Überlegenheitsansprucheurozentrische Überlegenheitsanspruch gegenüber Entwicklungen in anderen Teilen der Welt lässt sich hier nennen. Ein Christentum, das seine asiatischen Wurzeln vergessen zu haben scheint und sich als ‚europäisches‘ versteht, zumal in seiner eurozentrischen katholischen Variante, muss sich dieser kritischen Anfrage in weitaus verstärktem Maß stellen.
1.4 Koloniale Kontexte heute
Auch wenn die meisten Kolonien inzwischen staatliche Unabhängigkeit erlangt haben, ist der Kolonialismus keine abgeschlossene Episode der Vergangenheit. Er prägt die Gegenwart auf vielfältige Weise. Der Postkolonialismus als globale wissenschaftliche Strömung versteht sich daher auch als eine kritische Auseinandersetzung mit den Auswirkungen der Kolonialzeit in der Gegenwart, die sich auf sehr unterschiedlichen Ebenen bemerkbar machen: in wirtschaftlicher Abhängigkeit, in kulturellen Hierarchien und Exklusionen und auf ↗ epistemologischer Ebene. Zugleich lassen sich auch globale Gegenbewegungen mit diesem kolonialen Weiterwirken des Kolonialismus wahrnehmen, die ebenfalls auf diesen verschiedenen Ebenen agieren.
In vielen Bereichen der internationalen wirtschaftlichen Beziehungen werden gegenwärtig unter dem Stichwort des NeokolonialismusNeokolonialismus unterschiedliche Ausbeutungsverhältnisse diskutiert, die sich vom historischen Kolonialismus dadurch unterscheiden, dass die ausgebeuteten Regionen formal ihre staatliche Unabhängigkeit besitzen. Durch Bergbaukonzessionen, Investitionen und Handelsverträge werden diese Neokolonien jedoch dazu gebracht, das zu produzieren, was der internationale Investor vorgibt, und nicht das, was von der lokalen Bevölkerung benötigt wird. Besonders drastisch macht sich dies im landwirtschaftlichen Sektor bemerkbar.
Eine andere Form des Neokolonialismus kann beobachtet werden, wenn Arbeitsplätze etwa in der Bekleidungs- oder Informationsindustrie in Ländern geschaffen werden, die ein wesentlich geringeres Lohnniveau und eine schlechtere Arbeitsgesetzgebung als die industrialisierten Staaten besitzen. In vielen Fällen wird von den armen Ländern selbst die Gesetzgebung so ‚investorenfreundlich‘ gestaltet, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter unter extrem prekären, teils der Sklaverei ähnelnden Bedingungen zu arbeiten gezwungen sind. Eine dritte Form des Neokolonialismus findet sich in der Auslagerung der Konsequenzen des Klimawandels in die Länder und Regionen, die ihn am wenigsten verursacht haben. Diese drei Beispiele sollen die Phänomene des Neokolonialismus nur exemplarisch und nicht erschöpfend aufzeigen.
Der mexikanische Soziologe Pablo González CasanovaGonzález Casanova, Pablo wies bereits in den 1960er Jahren darauf hin, dass trotz der staatlichen Unabhängigkeit und zahlreichen anderen sozio-ökonomischen Veränderungen in den Postkolonien wirtschaftliche Strukturen erhalten bleiben, die sowohl die globale Ausbeutung weiter aufrechterhalten als auch die Entwicklung eines ‚Interner Kolonialismusinternen Kolonialismus‘ begünstigen, durch den einheimische Eliten und bestimmte Landesregionen koloniale Machtverhältnisse über andere Teile des Landes weiterführen können1. Dies zeigt sich beispielsweise in der systematischen Ausbeutung ländlicher und von Bergbau betroffener Regionen, die häufig durch eine Zentralregierung unterstützt wird. Derzeit wird ein solcher interner Kolonialismus besonders drastisch in der Amazonienregion wahrgenommen2.
Weitere koloniale und neokoloniale Kontexte finden sich im Zusammenhang mit den vielfältigen Migrationsbewegungen der Gegenwart3. Einerseits gehören neokoloniale Ausbeutung und Gewaltszenarien, die mit ihr verbunden sind, zu den wesentlichen push-Faktoren der Migration, andererseits muss unter den pull-Faktoren die sich öffnende Schere zwischen den weltweiten Gewinnern und den Verlierern der kapitalistischen Globalisierung identifiziert werden. Geduldete und sich illegal aufhaltende MigrantInnen werden darüber hinaus häufig auch in Europa unter sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen oder in anderen prekären Arbeitsverhältnissen ausgebeutet. Von ihren Ursprungsländern angefangen sind MigrantInnen auf dem ganzen Weg ihrer Migration bis in die Zielländer überall dem Rassismus und Hierarchien kultureller Überlegenheit ausgesetzt, die ihren Ursprung nicht zuletzt in den Jahrhunderten der europäischen Kolonialpraxis besitzen.
Ebenso wie die wirtschaftlichen Strukturen des Kolonialismus besitzen auch seine Kulturelle Tiefenschichtenkulturellen Tiefenschichten eine Langlebigkeit, die nicht durch das Ende der Kolonialzeit einfach überwunden oder durchbrochen werden kann. Aníbal QuijanoQuijano, Aníbal nennt die Hartnäckigkeit dieser kulturellen Prägungen die ↗ Kolonialität:
„Sie besteht […] aus einer Kolonisierung der Vorstellungswelt (imaginario) des Dominierten. Das heißt, sie handelt innerhalb dieser Vorstellungswelt. In gewisser Weise ist sie ein Teil davon.“4
Dies bedeutet, dass die Vorstellungswelt der Menschen selbst kolonisiert, also bis in die Gegenwart den Bedingungen des Kolonialismus unterworfen ist. Gleichzeitig ist es diese Vorstellungswelt selbst, die diese kulturellen Bedingungen des Kolonialismus aufrechterhält, weil sie sie für selbstverständlich einstuft. Dies ist der Grund, weshalb die koloniale Abwertung der einheimischen Kulturen und die unterbewusste Aufwertung alles Europäischen in den ehemals Unterworfenen und Unterwerfenden gleichermaßen nachwirkt und bis in die Gegenwart kulturprägende Macht ausübt. Ein wichtiges Werkzeug der Kolonialität ist nach QuijanoQuijano, Aníbal der Rassismus, da er oberflächliche Unterschiede im Aussehen der Menschen dazu nutzt, kulturelle Auf- und Abwertung individuell zuzuordnen.
Wirtschaftliche und kulturelle Kolonialität bedingen und befördern sich gegenseitig. Die ökonomische Ausbeutung wird legitimiert und akzeptabel durch die abwertende kulturelle (Selbst-)Einschätzung, und die kulturelle Abwertung verstärkt sich durch wachsende Armut und Prekarität. Diese wechselseitige Verstärkung postkolonialer Erfahrungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ist ein wichtiges Thema der Kritik im Postkolonialismus. Sie verweist auf die unterbewusste, für selbstverständlich gehaltene hartnäckige Überlebenskraft kolonialer Verstehensmuster.
Man kann die Wirkung dieser Hinterlassenschaften des Kolonialismus als ↗ epistemologisch bezeichnen: Sie verändern die Art und Weise, wie Menschen sich selbst und die Welt, in der sie leben, wahrnehmen. Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Herkunft, Sprache oder Hautfarbe werden unterbewusst auf einer kolonialen Folie gelesen und damit von vornherein in diese Erblast der Kolonialität eingeordnet. Das Recht transnationaler Unternehmen auf die Ausbeutung von Rohstoffen, Energiegewinnung und landwirtschaftlicher Produktion wird nicht hinterfragt, weil in der Koloniale Erinnerungkolonialen Erinnerung die Vormacht und damit das Vorrecht der ehemaligen Kolonialstaaten gar nicht in Zweifel gezogen werden. Dies geschieht sowohl auf der Seite der vormals Kolonisierten wie der ehedem Kolonisierenden.