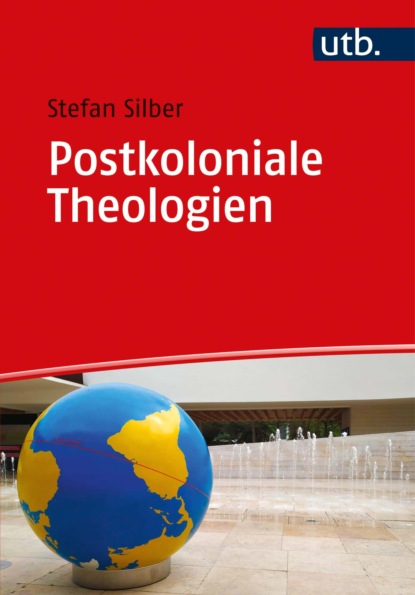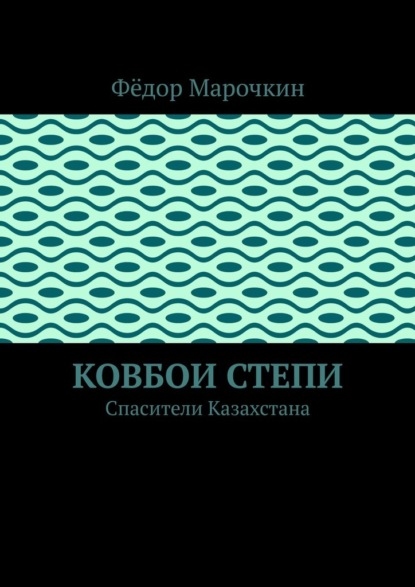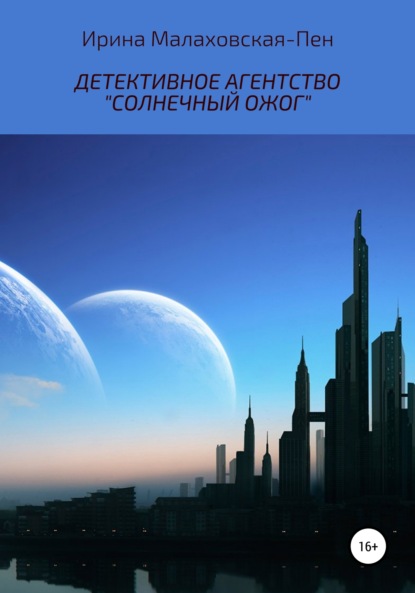- -
- 100%
- +
Auch innerhalb der Staaten Europas und Nordamerikas wirkt diese koloniale Erinnerung: Die kolonialen Beziehungen haben nicht nur die Vorstellungswelt der Dominierten verändert und nachhaltig geprägt, sondern auch die der Eroberer. Die Überlegenheit der heute durch den Kapitalismus Mächtigen ist scheinbar selbstverständlich auch eine kulturelle und politische Überlegenheit. Sie scheint durch faktische Gegebenheiten legitim und wird durch ebenso vorurteilsbelastete ‚Wissenschaft‘ akademisch abgesichert. Ebenso üben ↗ Eurozentrismus und Weiße Überlegenheit häufig unhinterfragt ihren kulturellen Einfluss aus.
Die Kritik an diesen scheinbaren Selbstverständlichkeiten ist ein wesentliches Thema der postkolonialen Studien. Sie streben an, die verborgenen Strukturen der Kolonialität aufzudecken, zu kritisieren und zu verändern. Auch die Postkoloniale Theologienpostkolonialen Theologien, die in diesem Buch im Mittelpunkt stehen, zielen die Kritik dieser tief liegenden kulturellen Überzeugungen an, rücken jedoch zugleich auch das Feld der Religionen in den Mittelpunkt. Sie fragen zum einen nach der Verantwortung der Religion für die Ausprägung dieser selbstverständlich hierarchischen Vorstellungswelt des Kolonialismus und zum anderen auch nach den Konsequenzen, die der Kolonialismus seinerseits für die Konstruktion von Theologien nach sich gezogen hat.
Postkoloniale Theologien und Studien allgemein fügen sich damit in ein globales Netz des Widerstands gegen die Kolonialität und den Kolonialismus ein, das auch schon zu Kolonialzeiten existierte. Denn solchen Widerstand gibt es ungefähr ebenso lange wie den Kolonialismus selbst, auch innerhalb der Kirchen und der Theologie. Er steht diesem jedoch nicht als homogener Block gegenüber, sondern ist durch vielfältige Verbindungen mit dem Kolonialismus selbst unauflöslich verflochten und äußert sich in unterschiedlichen Strategien und Praktiken.
Gleichzeitig mit der neoliberalen Globalisierung kann daher heute auch von einer Globalisierung der Solidarität, der Gerechtigkeit oder der Hoffnung die Rede sein. Menschen versuchen an vielen Orten mit sehr unterschiedlichen Methoden gemeinsam an der Selbstverständlichkeit der vielfältigen zerstörerischen Strukturen der Gegenwart zu rütteln. Sie sind dabei selbst auch der Erblast der Kolonialität unterworfen und müssen daher ihr eigenes Tun auch immer wieder selbstkritisch hinterfragen. Ein wichtiges Element dieser Selbstkritik sind dabei eben die vielfältigen und in Entwicklung begriffenen postkolonialen Studien, genauso wie umgekehrt der selbstkritische Blick auf die eigene Produktion zum Selbstverständnis des Postkolonialismus insgesamt gehört.
1.5 Bedeutung der postkolonialen Studien für die Theologie
Auch ChristInnen sind Teil dieser globalen Prozesse – der ↗ Kolonialität und des Widerstands. Die Verflechtungen der christlichen Mission mit den Gewalttaten des Kolonialismus sind weithin bekannt und wurden vielfach kritisch analysiert. Bereits während der Kolonialzeit wie auch danach sind ChristInnen – als Einzelne, aber auch in Repräsentation ihrer kirchlichen Institutionen – sowohl auf der Seite der Zerstörungen wie auf der des Widerstandes zu finden. Viele von ihnen – wie der Dominikaner Bartolomé de las CasasLas Casas, Bartolomé de – waren zudem zugleich Kolonisatoren und Kritiker des Kolonialismus. Eine binäre Einteilung in Gut und Böse, Kolonialismus und Widerstand verbietet sich in einer angemessenen historischen Perspektive. Die Kritik solchen Schwarz-Weiß-Denkens ist gerade ein wesentlicher Aspekt des postkolonialen Denkens.
Die vielfältige Verflechtung christlicher und kirchlicher AkteurInnen in koloniale Beziehungen ist ein wichtiger Grund dafür, dass die postkolonialen Studien weltweit gesehen auch in der Theologie schon seit einigen Jahren aktiv rezipiert wurden. Der US-amerikanische Theologe Joseph DugganDuggan, Joseph unterschiedet Vier Phasen der Entwicklung postkolonialer Theologienvier Phasen der Entwicklung postkolonialer Theologien1: Eine erste Strömung identifiziert er bereits – avant la lettre – in den Befreiungskämpfen gegen den Kolonialismus Mitte des 20. Jahrhunderts. Bereits in diesen Befreiungskämpfen waren ChristInnen aktiv beteiligt und produzierten auch theologische Texte, häufig aus der Perspektive indigener Völker. Die Nichtberücksichtigung christlicher und theologischer Literatur aus dieser Zeit durch die Hauptströmungen der postkolonialen Theologien verengt jedoch nach Ansicht von Duggan das Spektrum dieser Theologien unnötig.
Eine zweite Strömung entwickelt sich aus der Anwendung der postkolonialen Literaturwissenschaften auf die Exegese der Bibel. Vor allem in Indien, Afrika und den USA finden sich etwa seit der Jahrtausendwende TheologInnen, die beginnen, die Bibel mit Hilfe des postkolonialen Instrumentariums neu zu lesen und zu interpretieren. Diese zweite Strömung besitzt bis heute einen großen Einfluss auf die Entwicklung postkolonialer Theologien. Besonders in den USA entwickelt sich dann DugganDuggan, Joseph zufolge eine dritte, eher systematisch-theologisch orientierte Strömung, deren VertreterInnen das Instrumentarium der postkolonialen Studien auf weitere theologische Disziplinen anwenden und insbesondere auch den Dialog mit dem postkolonialen Feminismus suchen.
Die vierte Strömung, von der DugganDuggan, Joseph 2013 schreibt, dass sie „die komplexeste und vielschichtigste“ und zudem „noch in der Entwicklung begriffen“2 sei, sucht den expliziten Dialog mit postkolonialen TheoretikerInnen, die in der Regel der Religion als einer Triebfeder des Kolonialismus sehr ablehnend gegenüber gestanden hatten. In diesem breiten interdisziplinären Dialog wird auch selbstkritisch die Frage gestellt, welche Rolle postkoloniale Subjekte tatsächlich in einer theologischen Strömung besitzen, die gegenwärtig sehr stark in den USA und im englischsprachigen Norden des Planeten geführt wird. Indigene und nichtchristliche AutorInnen sind daher in diesem Dialog ebenfalls vertreten.
Mit Andreas NehringNehring, Andreas und Simon WiesgicklWiesgickl, Simon lassen sich dieser Chronologie noch die Entwicklungen innerhalb der Ökumenischen Vereinigung der DrittwelttheologInnen EATWOT hinzufügen. In der Gründungsversammlung dieser Vereinigung 1976 verorten die beiden Autoren einen „Epistemologischer Bruchepistemologischen Bruch“3, der sich der Sache nach schon den postkolonialen Anliegen annähert. Darüber hinaus können sicherlich auch weitere Strömungen von Theologien aus dem Globalen Süden aus den letzten Jahrzehnten (wie die lateinamerikanische Befreiungstheologie sowie die Befreiungstheologien anderer Kontinente, feministische und ökofeministische Theologien des Südens, indigene Theologien aus Lateinamerika, Nordamerika, Afrika und Asien usw.) zum vielfältigen Spektrum der postkolonialen Theologien gerückt werden. In der Gegenwart entspinnt sich ein komplexer Dialog zwischen diesen unterschiedlichen Strömungen.
Der explizite Rekurs auf die postkolonialen Studien und die ausdrückliche Thematisierung von kolonialen und postkolonialen Fragestellungen könnte es rechtfertigen, von den postkolonialen Theologien als einer eigenen Strömung zu sprechen. Eine solche Abgrenzung würde jedoch eine in der Praxis nicht existierende Trennung von anderen vergleichbaren Theologien und eine innere Homogenität dieser Strömung unterstellen. Vielmehr muss man sich die postkolonialen Theologien als eine vielfältige, kritische und dialogbereite theologische Perspektive vorstellen, die Instrumente der postkolonialen Studien aufgreift, um Herausforderungen zu bearbeiten, die sich aus historischen kolonialen Zusammenhängen ergeben, und dabei im lebendigen Austausch mit anderen Theologien des Globalen Südens steht. In diesem Band werden daher auch theologische Beispiele vorgestellt, die sich selbst nicht ausdrücklich als postkolonial bezeichnen oder sich explizit auf die Methodiken der postkolonialen Studien beziehen.
Es ist derzeit wohl kaum möglich, einen vollständigen Überblick über das Panorama postkolonialer Theologien zu geben. Das liegt nicht nur an der beschriebenen Unmöglichkeit einer Abgrenzung dieser Theologien von verwandten und benachbarten Strömungen und an ihrer inneren Vielfalt, sondern auch daran, dass sich weder alle theologischen Arbeiten, die man als postkolonial einstufen könnte, selbst so (oder auch ‚dekolonial‘) nennen. Schließlich muss man auch kritisch anmerken, dass es inzwischen Arbeiten gibt, deren Selbstidentifizierung als ‚postkolonial‘ nicht mit der verwendeten Methodologie übereinstimmt.
Als eine theologische Perspektive in Bewegung und Transformation kann man daher die postkolonialen Theologien derzeit als Vielgestaltigkeit und Uneinheitlichkeit postkolonialer Theologienvielgestaltig und uneinheitlich bezeichnen. Sie weisen auch keinen geografischen Schwerpunkt auf; vielmehr entwickeln sie sich eher versprengt auf allen Kontinenten, oftmals in Minderheitsverhältnissen, die von ihnen selbst als ‚Diaspora‘ charakterisiert werden. Das Internet und soziale Medien werden gerne und ausgiebig genutzt, so dass globale Vernetzung und Kommunikation möglich werden. Auch ökumenisch und teilweise interreligiös entwickelt sich eine lebendige Zusammenarbeit.
Zwischen theologischen Entwürfen verschiedener christlicher Konfessionen wird dabei meist nicht ausdrücklich unterschieden. Vielmehr werden Entwürfe aus anderen Kirchen oft dankbar (und kommentarlos) aufgegriffen und rezipiert. Die Gemeinsamkeiten in den (post-)kolonialen Fragestellungen sind oft größer als die geschichtlich gewachsenen konfessionellen Unterschiede. Im Gegenteil wird der historische Konfessionalismus sogar als koloniales Erbe dekonstruiert. Die Grenzen zwischen den Konfessionen werden – wie viele Grenzbereiche im Postkolonialismus – als (post-)koloniale Machtinstrumente problematisiert und dadurch auch durchlässig für den Dialog.
Aufgrund der Aufmerksamkeit, die im Postkolonialismus sowohl kulturellen wie auch politischen und wirtschaftlichen Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnissen zukommt, berühren sich die postkolonialen Theologien auch in vielfältiger Weise sowohl mit interkulturellen als auch mit Befreiungstheologien. Während interkulturelle Theologien in der Vergangenheit häufig die Fragen der Machtverhältnisse ausblendeten und die kulturellen Begegnungen und Lernprozesse in den Vordergrund rückten, fragen postkoloniale Theologien stärker nach den Möglichkeiten des interkulturellen Dialogs bzw. der ↗ Verhandlungen zwischen den Kulturen unter dem Einfluss kolonialer Machtstrukturen. Gegenüber den Befreiungstheologien und verschiedenen anderen politischen Theologien weltweit lenken die postkolonialen Theologien hingegen die Aufmerksamkeit insbesondere auf (inter-)kulturelle Fragen, die in den politischen Theologien oft als zweitrangig oder gar als Hindernis zurückgedrängt wurden und machen darauf aufmerksam, dass die Analyse kultureller Machtverhältnisse notwendig ist, um soziale Hierarchien und Ausbeutungsstrukturen besser zu verstehen.
In beiden theologischen Strömungen – den politischen wie den interkulturellen Theologien – wächst nun das Interesse an einer Auseinandersetzung mit den Fragen und Methodiken des Postkolonialismus. Postkoloniale Theologien nähren sich daher auch aus dem Dialog mit diesen beiden pluralen Strömungen der Theologien des Globalen Südens.
In den verschiedenen Ausformungen postkolonialer Theologien zeigt sich weiterhin auch die Bedeutung, die in ihnen jeweils den konkreten lokalen und historischen Kontexten zugemessen wird. Sie versuchen nicht, allgemeingültige Antworten auf vermeintliche Menschheitsfragen zu geben, sondern gehen von konkreten kulturell und machtpolitisch geprägten Strukturen und Problemen aus. Dadurch gewinnen sie nicht nur eine Konkrete kontextuelle Charakteristikkonkrete kontextuelle Charakteristik, sondern auch global gesehen eine äußerst differenzierte Pluralität: Sie lassen sich nicht nur nicht über einen Kamm scheren, sondern sie wirken in der Gesamtschau gelegentlich widersprüchlich, uneinheitlich und fragmentiert. Diese Uneinheitlichkeit ist eine praktische Folge ihrer grundsätzlich kritischen Perspektive gegenüber der Universalisierung, Vereinheitlichung und Verdinglichung in der Theologie, die sie vor allem hinsichtlich der eurozentrischen und kolonialen Theologie bemängeln. Man muss diese Widersprüchlichkeit und Fragmentarität postkolonialer Theologien daher durchaus als gewünscht ansehen.
Denn auf diese Weise wird es den postkolonialen Theologien möglich, die vielgestaltigen Verbindungen etwa von Kolonialismus und Missionierung in der Geschichte konkret zu bearbeiten. Denn Spuren und Überreste kolonialer Mentalität weisen sehr unterschiedliche Gestalten auf, je nach historischen Kontexten und geschichtlichen Entwicklungen. Sie finden sich in Theologie und Kirche sowohl in den (ehemaligen) Missionsgebieten als auch in Europa und Nordamerika, bis in die Gegenwart. Die komplexen Beziehungen zwischen den von kolonialen und postkolonialen Machtstrukturen geprägten Kulturen und den Theologien, die in ihnen entstanden sind und entstehen, lassen sich mit dieser postkolonialen Methodik entschlüsseln und verändern.
Gerade in der katholischen Kirche, die sich dezidiert als Weltkirche versteht und zentralistisch organisiert, sind globale Machtverhältnisse und Kulturen, die von ihnen charakterisiert sind, eine wesentliche Herausforderung für die Theologie, und zwar nicht nur für die Missions- und Religionstheologien, sondern auch für Ekklesiologie, Christologie und andere theologische Themen, die ja ebenfalls kontextueller Prägung unterworfen sind.
Die folgenden Kapitel stellen einige Überlegungen in diesen Zusammenhängen vor und zeigen, welche tief reichenden Konsequenzen die Rezeption postkolonialen Denkens in der Theologie hat. Beispiele aus aller Welt und aus verschiedenen Bereichen der Theologie werden zeigen, dass die Theologie grundsätzlich angefragt ist und sich prinzipiell zu dieser Herausforderung stellen muss.
Der philippinische Theologe Daniel Franklin PilarioPilario, Daniel Franklin benennt „drei Hauptziele“ postkolonialer Theologien:
„(1) Erstens die dekonstruktive Phase. Die postkoloniale Theologie unternimmt es, biblische Dokumente, theologische Paradigmen und doktrinäre Behauptungen zu untersuchen, um ihre Komplizenschaft mit dem kolonialen Unternehmen festzustellen. […]
(2) Zweitens das Projekt der Rekonstruktion. Postkoloniale Theologien führen rekonstruktive Lektüren der sogenannten klassischen Texte aus der Perspektive subalterner Stimmen durch oder stellen neue Texte und Praktiken in den Vordergrund, die bislang von dominanten Diskursen unterdrückt wurden. […]
(3) Drittens entscheidet sich die postkoloniale Theologie für eine Hermeneutik des Widerstands, d.h. nicht nur zu lesen, wie die Kolonialmächte die Kolonisierten konstruieren, sondern auch, wie die Subalternen dieselbe Macht untergraben, mit der sie dominiert wurden.“4
Diese Ziele oder Phasen postkolonialer Theologien, die nicht als starre Abfolge oder Struktur gedacht werden dürfen, werden auch in den Beispielen, die auf den folgenden Seiten vorgestellt werden, immer wieder zum Vorschein kommen. In diesem Überblick wird aber schon deutlich, dass die postkoloniale Kritik nicht nur einzelne Elemente der theologischen Arbeit verändert, sondern die traditionelle Theologie prinzipiell in Frage stellt. Die österreichisch-belgische Theologin Judith GruberGruber, Judith verweist auf diese Grundsätzlichkeit der Neuorientierung:
„Eine deutschsprachige postkoloniale Theologie ist damit keine neue, marginalisierbare Disziplin, sondern orientiert die epistemologischen Vollzüge des theologischen Diskurses neu:“ Postkoloniale TheologInnen in Europa wählen „eine alternative Methode zu den Strategien des etablierten Diskurses; wir gehen buchstäblich einen anderen ‚Weg‘ des Theologietreibens, der uns dazu herausfordert, auch die ‚Landkarte‘ der Theologie neu zu vermessen.“5
Auch hierzulande besitzt der Postkolonialismus daher eine prinzipielle Bedeutung für die Theologie. Denn in ihm werden zum einen aus einer historischen Perspektive Kolonialismus, Mission, ↗ Eurozentrismus usw. angefragt. Zum anderen entfaltet sich diese Bedeutung auch in epistemologischer Hinsicht, da die europäischen Theologien und ihre Sprachwelt wesentlich mitverantwortlich für postkoloniale Verwerfungen sind. Schließlich ziehen diese Fragen auch auf praktischer Ebene Konsequenzen in Bereichen wie Gemeinde, Schule und Hochschule nach sich, wie in den folgenden Kapiteln deutlich werden wird.
Literaturhinweise
Die Veröffentlichungen in deutscher Sprache zu postkolonialen Theologien sind noch überschaubar6. Der umfassende und mit hilfreichen Einleitungen versehene Sammelband „Postkoloniale Theologien. Bibelhermeneutische und kulturwissenschaftliche Beiträge“7 von Andreas NehringNehring, Andreas und Simon WiesgicklWiesgickl, Simon (geb. TieleschWiesgickl, Simon) aus dem Jahr 2013 bietet nicht nur gleich zu Beginn eine informative Einführung in die postkolonialen Studien, sondern vor allem eine Zusammenstellung von zumeist aus dem Englischen übersetzten einschlägigen Beiträgen aus Asien und Nordamerika. Dieser Band gibt einen guten Überblick über AutorInnen, Themen und Methoden, stellt aber noch keine systematische Einführung in die postkolonialen Theologien dar. Diese Einschränkung gilt auch für den Nachfolgeband „Postkoloniale Theologien II: Perspektiven aus dem deutschsprachigen Raum“8, den die beiden Herausgeber 2018 veröffentlichten, und in dem Beiträge, die ursprünglich auf Deutsch geschrieben wurden, gesammelt sind. Diese sind inhaltlich eher disparat. Sie eint, dass sie postkoloniale Methodiken auf verschiedene Themenbereiche anwenden, die den AutorInnen jeweils wichtig erschienen. Der Band macht zugleich auch sichtbar und greifbar, dass postkoloniale Theologien auch im deutschen Sprachraum bereits diskutiert werden.
Der von Sebastian PittlPittl, Sebastian herausgegebene Sammelband zu „Theologie und Postkolonialismus“9 dokumentiert die Beiträge einer Tagung, die 2017 im Institut für Weltkirche und Mission (Frankfurt/M.) zu diesem Thema stattfand. Der zweisprachige Tagungsband (deutsch und englisch) vereint vor allem missionswissenschaftliche Reflexionen von WissenschaftlerInnen aus aller Welt und verweist sowohl auf die Vielfalt als auch auf die globale Bedeutung der postkolonialen Theologien. Die ebenfalls zweisprachige Tagungsdokumentation „Postkolonialismus, Theologie und die Konstruktion des Anderen“10 diskutiert kirchenhistorische, biblische und systematisch-theologische Themen und nimmt auch Konsequenzen für die europäische Theologie in den Blick.
Bereits 2013 erschien eine Ausgabe der Zeitschrift „Concilium“ (2/2013) zum Thema „Postkoloniale Theologie“, die übersetzte Beiträge aus aller Welt vorstellt. Einige dieser Beiträge führen sehr gut in die Thematik ein, andere dagegen können eher als konkretes Einzelbeispiel für postkoloniale Theologien oder angrenzende theologische Debatten dienen. Das 2020 veröffentlichte Heft derselben Zeitschrift zu „Dekolonialen Theologien“, das in der deutschen Ausgabe leider nur unter dem Titel „Gewalt, Widerstand und Spiritualität“ (1/2020) erschien, stellt diese theologische Strömung aus lateinamerikanischer Perspektive dar. Vor allem jüngere AutorInnen geben darin einen Einblick in Vielfalt und Methoden, aber ebenfalls keine systematische Einführung in die ‚dekoloniale‘ Variante postkolonialer Theologien. Das „Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften“ veröffentlichte im Jahr 2020 (Bd. 61) einige Beiträge vor allem aus sozialethischer Perspektive, in denen wichtige Spuren für eine Rezeption postkolonialer Studien im deutschsprachigen Diskursraum dieser theologischen Disziplin gelegt werden11.
Die Ausgabe 1-2/2012 von „Interkulturelle Theologie. Zeitschrift für Missionswissenschaft“ dokumentiert hauptsächlich einige der Aufsätze, die auch im ersten Band von NehringNehring, Andreas/TieleschWiesgickl, Simon erschienen sind. In der Ausgabe 2-3/2019 werden unter der Überschrift „Postkolonialismus – und was dann?“ einige interessante Beiträge zu Religionsgeschichte, Missionsgeschichte und Missionswissenschaft aus postkolonialer Perspektive zusammengestellt.
Der spanische Theologe Juan José TamayoTamayo, Juan José führt mit „Theologien des Südens“12 in zahlreiche neuere theologische Methodiken des Globalen Südens ein. Postkoloniale Theologien werden dabei ebenfalls vorgestellt, aber leider nicht systematisch aufbereitet oder grundlegend analysiert. Die Studie „Südwind“ des Schweizer Theologen und Philosophen Josef EstermannEstermann, Josef über „kontextuelle nicht-abendländische Theologien im globalen Süden“13 dokumentiert und analysiert ebenfalls Theologien aus aller Welt, die den postkolonialen sehr nah verwandt sind, aber vertieft dies nur ansatzweise unter dem Aspekt der theologischen Entkolonisierung14.
Darüber hinaus finden sich im deutschsprachigen Raum neben weiteren Einzelbeiträgen und Aufsätzen zu postkolonialen Themen15 vor allem zwei Dissertationen zu theologischen Fragen: Sigrid RettenbacherRettenbacher, Sigrids postkoloniale Erforschung der Religionstheologie16 und Simon WiesgicklWiesgickl, Simons kritische Aufarbeitung der Geschichte der historisch-kritischen Exegese aus postkolonialer Perspektive17. Beide weisen weit über ihre konkrete Fragestellung hinaus und bieten hilfreiches Material zur Vertiefung postkolonial-theologischer Anliegen in deutscher Sprache und in deutschsprachigen Kontexten. Zu erwähnen ist hier außerdem noch die deutsche Übersetzung von → Jörg Riegers christologischer Studie „Christus und das Imperium“18, die postkoloniale Methodik aufgreift. Weitere wichtige und interessante Veröffentlichungen lassen sich in verwandten Disziplinen wie der Religionssoziologie, der interkulturellen und der feministischen Theologie ausmachen.
1.6 Wissen und Macht in der Theologie. Zum Aufbau dieses Buches
Der Bibelwissenschaftler → R. S. SugirtharajahSugirtharajah, R.S. aus Sri Lanka beschreibt als „vereinende Kraft“ der vielgestaltigen Entwürfe postkolonialer Autorinnen und Autoren die Intention, „die Verbindung zwischen Wissen und Macht in der textuellen Produktion des Westens zu untersuchen und aufzudecken“1.
Diese Intention kann auch in den postkolonialen Theologien entdeckt werden. Sie steht auch im Hintergrund der folgenden Kapitel, in denen es grundlegend um den Zusammenhang von Macht und Wissen in der Theologie gehen wird. Denn jedes Wissen steht immer in Verbindung mit einer bestimmten Kultur, wenn man es nicht als universales, ahistorisches und überkulturelles Abstraktum verstehen will. Auch theologisches Wissen ist immer kulturell gebunden und untersteht damit konkreten Machtkonstellationen, die sich zu bestimmten historischen Zeitpunkten in den Kulturen, die die Theologie prägen, bilden.
Während die interkulturelle Theologie sich darum verdient gemacht hat, die Zusammenhänge zwischen Theologie und Kultur herauszuarbeiten, und die Theologie der Befreiung insbesondere die wechselseitigen Beziehungen zwischen Macht und Theologie analysierte, kann in der Perspektive der postkolonialen Theologien ausdrücklicher die komplexe Dreiecksbeziehung zwischen Herrschaft, Kultur und theologischer Produktion in den Blick genommen, analysiert und kritisiert werden.
Sowohl in der interkulturellen wie auch in der Befreiungstheologie ist in den letzten Jahrzehnten die Aufmerksamkeit für dieses komplexe Wechselverhältnis gewachsen. Seine Thematisierung ist keine Exklusivleistung postkolonialer Theologien. Darum geht es hier auch gar nicht. Vielmehr schöpfen postkoloniale Theologien sowohl aus der Befreiungstheologie als auch aus der interkulturellen Theologie Hilfestellungen für eine umfassendere und profundere Analyse und können ihnen zugleich einen fruchtbaren Dialog anbieten.
Kultur als komplexe DynamikKultur muss dabei als umfassende, komplexe Dynamik verschiedener Symbolsysteme betrachtet werden, die Religion, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik einschließt2. Sie bezieht sich nicht nur auf Kunst, Sprache und Wissenschaft, sondern auf alle Lebensbereiche, auch die Gestaltung des Alltags, Herrschaftsverhältnisse und das Weltverständnis. Ein reduzierter Kulturbegriff wird der kulturellen Selbst- und interkulturellen Fremderfahrung des Menschen nicht gerecht, schon gar nicht in kolonialen und postkolonialen Kontexten. Ebenso müssen Macht und Herrschaft auch als kulturelle Größen angesehen werden, die nicht nur auf rechtliche, faktische oder gewaltsam erzwungene Abhängigkeiten in den Blick nehmen, sondern ebenso psychische, kulturelle und religiöse Unterordnungen sowie Gegenmacht und Widerstand einschließen. Insbesondere mit Homi BhabhaBhabha, Homi und Gayatri SpivakSpivak, Gayatri ist es wichtig, sich auf die Konzeptionen von Macht, Herrschaft und ↗ Hegemonie, wie sie von Michel FoucaultFoucault, Michel und Antonio GramsciGramsci, Antonio entwickelt wurden, zu beziehen, wie dies in den postkolonialen Studien geschieht3.