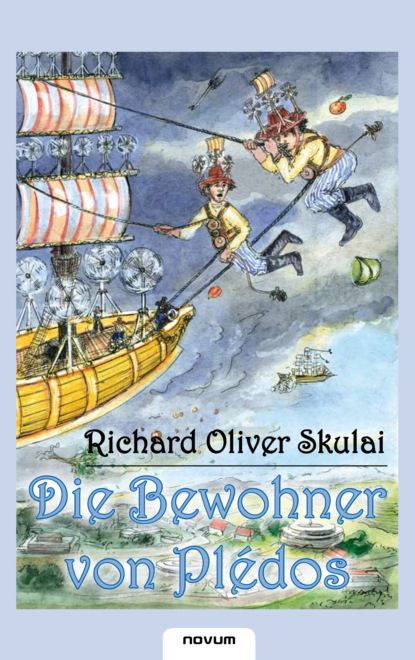- -
- 100%
- +
Wo nicht das Fleisch der Menschen zart,
dorthin verboten ist die Fahrt.
Und wo nicht weiche Leute,
da gibt es keine Beute!
Idan und Oler, die Sprüche wie diese als Grundschüler im Chor hatten singen müssen, widerten solche hochgepäppelten Lügen und Halbwahrheiten an. Von den Abenteurern aus Íoland und Stiefelburg hatten die Haihauptbewohner erfahren, dass auch der Inselkontinent Rüsselschwein nicht von gewöhnlichen Menschen besiedelt war. Die Abenteurer hatten von den schrecklichen Schlangenwesen und Kyruppen berichtet und von den hässlichen Kunovölkern, die über das ganze Land verbreitet waren. Das Wort „hässlich“ war von den Haihauptriesen gefürchtet und durfte kaum ausgesprochen werden, seit ihnen von der ausgesprochenen Hässlichkeit der totenmunder Alraunenwesen berichtet worden war. Als sie hörten, dass die Gesichter der Kunos runzelig und ihre Münder breit waren und dass sie breite Schweinsnasen hätten, ging bei ihnen schon der geistige Rollladen herunter. Gerüchte über die magischen Kräfte der Kyruppen und Schlangenwesen taten das ihrige. Denn die Riesen waren in der Mehrheit abergläubisch. Der Kontinent Rüsselschwein war gefürchtet, obwohl noch nie ein Haihauptriese dort gewesen war. So endete denn auch das Propagandalied:
Drum meide Totenmund allein
und nebenbei auch Rüsselschwein!
Noch ein dritter Kontinent wurde von den Riesen – zwar nicht in der Theorie, aber in der Praxis – gemieden: Ómuo, bestehend aus dem großen Lande Sonnenostun und der Halbinsel Omonu. Die Existenz dieses Kontinentes wurde, obwohl das Wissen über seine Verhältnisse allgemein zugänglich war, penetrant verschwiegen. Weiterhin wurde verschwiegen, dass die Jagd auf die wilden Einwohner Ómuos trotz ihres zarten Fleisches wegen ihrer scharfen Zähne und der Tatsache, dass ihre Mägen hochkonzentrierte Salzsäure enthielten, verpönt war. Das allgemeine Bekanntwerden solcher Hinderungsgründe hätte in der Bevölkerung von Haihaupt Zweifel an der unumstrittenen Heldenhaftigkeit des Haihauptmenschen geweckt. Nur die Zähigkeit des Fleisches und die allgemeine Furcht vor Zauberei durften als Hinderungsgründe gelten.
Idan und Oler nützten diesen Aberglauben, um nach Rüsselschwein zu siedeln, wo sie vor Verfolgung sicher waren. Schon von Jugend an war ihnen klar, dass die Berichte über die Verhältnisse auf Rüsselschwein übertrieben und die Furcht vor seinen Bewohnern unbegründet sein musste. Und sie irrten sich nicht. In den Kunos begegneten ihnen weise und friedliebende Leute. Sie waren außerdem im Verhältnis zu den Riesen winzig klein – eine Tatsache, die die Staatspropaganda verschwiegen hatte. Die Schlangenwesen und Kyruppen waren auf ihre Gebiete beschränkt und wollten nur in Ruhe gelassen werden. Und so durchwanderten sie die weiten, menschenleeren Landschaften, bis sie zu der Ganganjer-Schlucht kamen. Dort pflanzten sie den Märchenwald. In dem Märchenwald siedelten sie Tiere an, die sie aus verschiedenen Gegenden des Kontinentes zusammentrugen. Sie lebten in Frieden in diesem Wald. Wegen der Vielfalt an Lebensformen, die in diesem Wald vereint waren, wurde er auch Komponischer Märchenwald genannt. Alle Tiere im Komponischen Märchenwald konnten sprechen, denn die Riesen hatten ihnen die Menschensprache beigebracht.
Das stärkste und zugleich gefährlichste Tier des Waldes war zweifellos Bär Porbulo, der Grizzlyhauptmann. Aufgerichtet maß er wohl drei Meter und fraß jeden Neuen auf, der in den Komponischen Märchenwald kam. Treu zur Seite standen ihm sein Bruder Zotti-Momi und Barion-Bär, sein erster General. Diese Tiere waren mächtig und grausam. Nur dem kleinen Idan und den Tieren innerhalb des Märchenwaldes taten sie nichts. Ihre Nahrung jagten sie in großen Gruppen außerhalb des Waldes unter dem Oberbefehl von Barion-Bär, und selbst Büffel und Auerochsen waren nicht sicher vor ihnen. Da war Urlu, der Löwenkönig, wieder ein anderer Typ. Er fraß nur schwächere Kälber und Hasen. Er war gutmütig, gelassen und träge. Mit seinem Löwenclan zog er jedes Jahr zum großen Löwensee im Norden des Kontinentes, wo er sich mit anderen Löwenkönigen traf. Über Urlu und Bär Porbulo wunderte sich wiederum Kiri, der Anführer der Elefanten, der größer und stärker als ein Mammut war. „Warum fressen die denn immer Fleisch?“, mochte er bei sich denken, wenn er die Löwen und Grizzlybären beobachtete. „Davon kriegt man ja nur Bauchweh! Überhaupt eine dumme Sache, das Fleischfressen! Wenn man bedenkt, dass man andere Wesen dafür töten muss, gegen die man ja nichts hat! Ich töte nur die, die mir etwas getan haben. Käme mir schlecht dabei vor, wenn es anders wäre! Seltsam: Dass einen die Natur dazu zwingen soll, ungerecht zu sein! Aber ohne mich!“
Der schlaueste und listigste von allen war Flexy, der Waschbär. Jeden Tag saß er auf einem Ast und schaute mit seinen schwarzen Knopfaugen um sich, ob er nicht irgendeinem anderen einen Streich spielen könne. Er liebte den Schabernack von Herzen. Und er konnte den ganzen Tag vor Freude vor sich hin keckern, wenn ihm ein guter Scherz, ein ausgefallener Witz, die Beschämung anderer gelungen war. Der kleine Idan fragte ihn oft um Rat, denn er wusste, dass Flexy ihn mochte, aber ihm fiel auf, dass der Waschbär trotz seiner Schlauheit immer nur dumme Sachen und schräge Einfälle im Kopf hatte. Eine ernsthafte Unterhaltung mit dem klugen Tier war ihm kaum jemals möglich.
Immerhin war Flexy der große, gefeierte Held des Giplombenkrieges gewesen. Der Giplombenkrieg hatte noch in einer Zeit stattgefunden, als der kleine Idan noch nicht geboren oder zumindest noch nicht in Rüsselschwein war. Die Giplomben hatten auf ihren Raubzügen den Komponischen Märchenwald überfallen, während Idan und Oler auf Reisen waren. Aufgrund ihrer Größe und Körperkraft hatten sie es sogar mit den Löwen und Grizzlybären aufgenommen und selbst Bär Porbulo hatte aus dieser Zeit noch einige Narben unter seinem Fell vorzuweisen. Obwohl einige der Giplomben ihr Leben hatten lassen müssen, wären die Tiere des Waldes von der Übermacht des feindlichen Heeres am Ende doch besiegt worden. Bei der großen Zahl der Feinde wäre sogar fraglich gewesen, ob Idan und Oler die Situation in den Griff bekommen hätten, wenn sie nicht verreist gewesen wären, und das, obwohl sie fast doppelt so groß wie ausgewachsene Giplomben waren und mit mehrfacher Körperkraft begabt. In dieser aussichtslosen Lage war es Flexy gewesen, der die Rettung brachte. Er lockte den Giplombenkönig in eine Falle, und das ganze Heer folgte ihm hinterher – direkt in die Ganganjer-Schlucht. Flexy hatte dem Giplombenkönig weisgemacht, dass er sich im Besitz eines wertvollen Schatzes befände. Er hatte geprahlt, hatte ihn verspottet, war zwischen seinen Stielaugen herum gesprungen und zurück ins Geäst der Bäume und der Giplombenkönig war ihm mit dem ganzen Heer gefolgt. In voller Jagd waren sie ihm hinterher gestürzt. Flexy hatte sie auf verborgenen Wegen nahe an die Schlucht herangeführt und zwar an eine Stelle, die von der Sicht verdeckt war. Und als sie bemerkten, wohin sie ihre Füße gesetzt hatten, war es schon zu spät gewesen. Zwischen den Klippen waren sie an einem schrägen Abhang abgerutscht, den Flexy zuvor mit Schmierseife aus Olers Haushalt bearbeitet hatte, und hatten ein jämmerliches Ende gefunden. Noch heute sprach man von Flexys Großtat. Aber ein ruhiges vernünftiges Gespräch konnte man mit Flexy nicht führen. Er konnte nicht still halten, musste immer etwas zu tun haben, immer von einem Ort zum anderen laufen, wurde von einem witzigen Gedanken nach dem anderen gejagt. Flexy wohnte mit anderen Waschbären zusammen, die ebenso umtriebig waren wie er selbst. In Unterhaltungen waren sie kaum genießbar. So einer war Flexy.
Neben dem Tag der Freude, an dem die Giplomben besiegt worden waren, gab es aber noch einen anderen Tag, einen Tag der Trauer. Das war der Tag gewesen, an dem Silena, die ängstliche Hirschkuh, in die Ganganjer-Schlucht gestürzt war, nachdem man ihr einen heftigen Schrecken eingejagt hatte. Das war durch Flexys Schuld geschehen, der sie durch Lügenmärchen in große Aufregung versetzt hatte. Der ganze Wald trauerte um Silena an diesem Tag. In all den langen Jahren, soweit die Tiere sich entsinnen konnten, war im Wald bisher noch nie ein Tier gestorben. Nur die beiden Riesen, die schon einige Generationen hatten kommen und gehen sehen, hatten vor den Tieren das Geheimnis der Sterblichkeit bewahrt.
In den folgenden Tagen waren die Kunos gekommen und hatten die Bewohner des Waldes getröstet. Sie sagten, dass alles seine Bestimmung habe. Nichts sei umsonst und sinnlos und das wirkliche Leben sei immerwährend und ohne Ende. Auf der Erde aber habe alles seine Zeit und sein bestimmtes Ziel. Für alles sei hier ein Rahmen gesteckt und es sei keinesfalls alles möglich. Nur die böse Tat sei nicht bestimmt. Dieses Leben aber sei ein Samenkorn für ein ungleich höheres und freieres. Auch die Hirschkuh Silena sei jetzt frei für ein anderes, höheres Leben. Mit diesen Worten beruhigten die Kunos die Schar der Tiere. Die Kunos vereinten großes handwerkliches Geschick bei einfachster Lebensweise mit hoher Denkkraft. Sie waren weise, aber nicht schön von Gestalt. Sie hatten einen breiten Mund mit Spaltlippen, dicke Bäuche, große abstehende Ohren und breite Schweinsnasen. Die Gliedmaßen waren kurz und plump und der Kopf fast halb so groß wie der gesamte übrige Rumpf. Sie trugen einen ungeheuer langen Haarschopf, der fast senkrecht empor stand und bei jedem Individuum unterschiedlich gefärbt war. Da die Kunos neben ihrem ausgezeichneten Gehör unter den menschlichen Wesen auf Plédos über den schärfsten Blick verfügten und ausgesprochene Augenmenschen waren, hatten sie für jede der ihnen bekannten rund zweihundert Millionen Farben ein anderes Wort. So kam es, dass jeder Kuno von Geburt an nach seiner speziellen Haarfarbe benannt wurde. Meist war es so, dass mit jedem neugeborenen Kunokind eine neue Farbe entdeckt und benannt wurde, denn so viele Farbnuancen, wie die Haartracht der Kunos zeigte, gab es trotz des feinen Unterscheidungsvermögens der Kunoaugen in der freien Natur überhaupt nicht. So ist es nur verständlich, dass es, wie oben angedeutet, in der Kunosprache mehr Wörter für Farben gab als für andere Dinge – nämlich etwa zweihundert Millionen – und es kaum einen Kuno gab, der den Namen eines anderen trug. Die Kunosprache, die an sich schon überaus reichhaltig war, verfügte über einen Wortschatz von dreihunderttausend Wörtern, wenn man die Namen für Farben abzog, und das ist schon überaus viel für eine Menschensprache und umfasst wohl mehr als hundert Sprachen unserer Erde. Es gab nur zwei Personen unter den Kunovölkern, die eine höchst langweilige Haarfarbe hatten, eine Farbe, die genau an den beiden Enden aller möglichen und auch uns bekannten Farbskalen lag, nämlich Schwarz und Weiß. Es waren Kuno Weißhaar und sein Cousin Kuno Schwarzschopf. Natürlich sagte ihnen niemand, dass man ihren Namen und ihre Farbe für langweilig hielt, aber man gab es ihnen durch Gesten, Mienenspiel und zweideutige Worte zu verstehen. Und das war der Grund, warum sich beide von ihrem übrigen Volk abgesondert hatten und einen engen Kontakt zum kleinen Idan pflegten. Viel lieber hätten die beiden „Kuno Kaloramis“ geheißen, was eine warme Feuerfarbe bedeutete, ein besonders leuchtendes Orange, das in Worten unserer Erdensprache nicht von anderen, nach unseren Begriffen sehr ähnlichen Orangetönen, zu unterscheiden ist, aber von den Kunos sehr wohl unterschieden wurde. Oder sie hätten es begrüßt, „Kuno Fulgur“ oder „Amirabilis“ genannt zu werden, was beides eine weißgoldene Glanzfarbe in ganz verschiedenen Nuancen bezeichnet. Kuno Weißhaars Mutter hieß zum Beispiel Kuna Kaloramia. Man kann sich wohl denken, wie sehr entsetzt sie war, als sie in Erwartung ihres Kindes und womöglich einer völlig neuen, bisher unbekannten Farbe das schlichte Weiß auf dem Kopf ihres Sohnes entdeckte. Das war natürlich eine große Schande. Freilich wurde nicht ausgesprochen, dass dies eine Schande war. In der Sprache der Kunos, so reich sie auch war, gab es das Wort „Schande“ überhaupt nicht. Das war ein Wort, das die Kunos erst im Umgang mit anderen Völkern erlernten, aber unter sich so gut wie nie gebrauchten. Dennoch spürte Kuno Weißhaar wohl von früher Jugend auf den Gram seiner Mutter. Denn der ganze Stolz der Kunos ist ihr Haarschopf, der oft dreimal so lang ist wie ihre Statur. Und Kuno Weißhaars Haarschopf war eben weiß und der Haarschopf seines Vetters eben schwarz und das waren ganz banale Farben, die überall vorkamen. Ja, man stritt sich oft darüber, ob es sich um echte Farben handelte. „Weißhaar … Schwarzschopf … isch des iberhaupt e’ Farb’?“, pflegten Verwandte zu sagen und die Mutter Kuna Kaloramia und Kuno Schwarzschopfs Mutter, die mit Namen Kuna Fulgurana hieß, schämten sich dann gewaltig, denn sie mussten vor sich selbst bekennen, dass es eigentlich gar keine Farben waren. Wie oft hatte Kuno Weißhaar seine Eltern angefleht, ihm doch einen anderen Namen zu geben. Aber es war nun einmal Gesetz, dass ein Kuno nach seiner Haarfarbe benannt werden musste. Da war nichts zu machen. Das war so ziemlich das einzige Problem, aber ein nicht geringes – zumindest nicht für Kuno Weißhaar und für Kuno Schwarzschopf. Sie spürten deutlich die Verachtung, die man ihnen gegenüber hegte, und diese hing eben mit ihrem Namen und ihrer Haarfarbe zusammen, die eigentlich gar keine Farbe war. Insgeheim tuschelte man, sie seien Missgeburten. Hätten sie kleinere Ohren oder menschliche Nasen oder einen Elefantenrüssel statt Schweinsnasen gehabt, so hätte man sie nicht als Missgeburten bezeichnet. Aber eine Haarfarbe, die eigentlich gar keine war, kam eigentlich nur in zwei besonderen Fällen vor – eben bei Kuno Weißhaar und Kuno Schwarzschopf. Und das war völlig außergewöhnlich. Da die Kunos trotz ihrer sonstigen Weisheit nicht von der Überbewertung der Haarfarben ablassen wollten und Kuno Weißhaar und Kuno Schwarzschopf das ständig zu spüren bekamen, fühlten sich die beiden gezwungen, ein Wanderleben zu führen. Dabei machten sie Erfahrungen und Entdeckungen wie selten ein Kuno. Den Komponischen Märchenwald besuchten sie regelmäßig.
Dann wohnte auch noch ganz in der Nähe von Idan, dem Kleinen, eine Familie von Menschenaffen, bestehend aus dem großen Affenvater, der Affenmutter, Äffchen und dem Großen-Bruder-Affen. Eigentliche Namen hatten diese Affen nicht, obwohl sie die Sprache der beiden Riesen gelernt hatten. Äffchen aber, das jüngste Mitglied der Affenfamilie, nannte man auch Erfinder-Äffchen, weil es der klügste Affe im ganzen Wald war und von erfinderischen Einfällen nur so sprühte. Dieses Äffchen hatte einen eigenartigen Verstand, der auf die ungewöhnlichsten Dinge verfiel und geradezu imstande war, aus dem reinen Nichts etwas zu machen. Es war ein außerordentliches Äffchen. Dabei zählte es – nach der Meinung seiner Artgenossen – nur wenige Jahre und war verglichen mit dem hohen Lebensalter der Plédo-Affen, noch ein recht junger Bub. Nun sollte man wissen, was Plédo-Affen sind. Es sind eben solche Affen, zu deren Art die Affenfamilie zählte. Plédo-Affen sind nach dem Planeten Plédos benannt, auf dem sie wohnen, weil sie dort die älteste, klügste und größte Art der bekannten Menschenaffen darstellen. Sie sind rothaarig und im ausgewachsenen Zustand beinahe vier Meter hoch. Diese stattliche Größe hatten auch die beiden Eltern der jungen Affen. Erfinder-Äffchen selbst reichte dem kleinen Idan gerade bis zur Brust. Dieses Erfinder-Äffchen war Idans bester Freund. Es lebte in einer abgesonderten Behausung, einer geräumigen Grotte, die es sich heimisch eingerichtet hatte. Dort befanden sich zahlreiche Gerätschaften. Erfinder-Äffchen nannte daher seine Behausung Labor. Der kleine Idan besuchte Erfinder-Äffchen beinahe täglich.
Der Dunkle Mond
An diesem Morgen eilte der kleine Idan mit großen Schritten zur Behausung von Erfinder-Äffchen. Erfinder-Äffchen begrüßte ihn freundlich und fragte ihn nach seinen Wünschen.
„Ach“, meinte der kleine Idan, „mir ist so entsetzlich langweilig. Wir führen hier alle ein so schönes, harmonisches Leben und ein Tag vergeht wie der andere. Ich weiß nicht, was ich gegen die Langeweile machen soll. Ich würde so gerne etwas Neues erleben. Vielleicht hast du ja eine Idee.“
„Langeweile ist etwas für Dummköpfe“, sagte Erfinder-Äffchen. „Im Übrigen kenne ich das Problem. Manchmal geht es mir ähnlich. Nur habe ich den Vorteil, mir meine Zeit mit sinnvollen Gedanken zu vertreiben. Die anderen Tiere sind furchtbar dumm und bemerken ihre Langeweile nicht. Sie leben ein Leben, in dem es nichts zu tun gibt. Flecki, der Waschbär, der schlaueste unter den Tieren, vertreibt sich seine Zeit mit lustigen Streichen. Du aber bist ein Mensch und weder mit Dummheit gestraft noch mit besonderen Gaben des Geistes gesegnet. Ich verstehe dein Dilemma wohl. Menschen sind eben seltsame Tiere. Und auch ich verspüre solch eine Verwandtschaft zur Seltsamkeit. Sind mir doch gerade kürzlich die guten Ideen ausgegangen und ich habe mich auf etwas Neues besinnen müssen. Es ist mir auch schon etwas eingefallen. Kürzlich las ich in einer uralten Chronik über einen wundersamen Schatz, der in dem finsteren Tal des Todes auf der Insektenwelt Pessian verborgen liegen soll. Dieser Schatz, so heißt es, soll seinem Besitzer geheimnisvolle Kräfte verleihen. Weißt du was, den wollen wir uns holen!“
Da machte der kleine Idan große, erstaunte Augen und fragte: „Was ist denn das, die Insektenwelt Pessian? Was ist eine Welt?“
„Auf welche Schule bist du denn gegangen“, meinte Äffchen, „dass du noch nicht einmal weißt, was eine Welt ist?“
„Was ist Schule?“, fragte der kleine Idan.
„Potz Blitz“, rief Äffchen, „dass einem da nicht der Geduldsfaden reißt bei soviel Ungelehrsamkeit! Aber ruhig Blut! Am besten, wir fangen einmal ganz von vorn an. Also: Eine Welt ist eine Welt wie die unsere auch.“
„Was heißt das: Wie die unsere auch? Was ist denn unsere Welt?“
„Eins nach dem anderen“, meinte Äffchen. „Also: Du weißt nicht, was eine Welt ist?“
„Schon“, sagte der kleine Idan. „Eine Welt ist der Boden, auf dem ich stehe, und alles, was darauf ist, und der Himmel über uns.“
„Und was glaubst du, wie das Ganze aussieht, wenn du es von hoch, hoch oben betrachtest?“
„Dann wird wohl alles viel kleiner aussehen und man hat einen weiteren Blick.“
„Und sonst, glaubst du, verändert sich nichts, nur, dass man immer mehr und mehr sieht, je höher man aufsteigt?“
„Es wird wohl schon so sein“, erwiderte der kleine Idan.
„Nun, gehen wir die Sache anders an“, sagte Äffchen. „Wenn du immer weiter und weiter in eine Richtung geradeaus gehen könntest, wie weit könntest du gehen?“
„Man kann immer weiter gehen“, meinte der kleine Idan.
„Gut! Sehr gut!“, rief Äffchen. „Man sieht: Ein Spekulant bist du nicht! Die Welt der Spekulanten ist begrenzt. Die Spekulanten warten nicht ab, bis sie etwas erlebt haben, sondern setzen an die Stelle dessen, was sie noch nicht erlebt haben, etwas anderes, das sie erlebt haben. Mehr wollen sie gar nicht wissen. Aber Leute wie du haben die besten Anlagen zum Wissenschaftler. Sie können sich auch in Dinge hineinversetzen, die sie noch gar nicht erfahren haben. Aber weiter! Du redest von einem Boden. Der ist für dich die Welt, auf der wir leben. Aber warum stehen wir denn darauf und schweben nicht einfach darüber?“
„Wir würden herunterfallen“, sagte der kleine Idan.
„Sehr richtig“, meinte Äffchen. „Aber der Boden – was ist mit ihm? Ist er vom Fallen befreit? Worauf steht er, damit er nicht fällt?“
„Der Boden? Ja, das ist der Boden. Ich glaube nicht, dass noch etwas darunter ist. Wahrscheinlich ist er unendlich dick. Wenn etwas darunter wäre, müsste darunter auch noch etwas sein und darunter auch noch etwas und immer so fort und das Allerletzte müsste fallen.“
„Das ist sehr gut bemerkt“, meinte Erfinder-Äffchen. „Und du bist damit der Wahrheit sehr nahe. Überlege: Kann es möglich sein, dass der Boden unendlich ist? Was ist überhaupt unendlich? Kann es unendlich viele Dinge geben, die zugleich sind? Dann wären sie doch irgendwie abgeschlossen. Wenn sie aber alle gleichzeitig abgeschlossen irgendwo vorliegen würden, dann wären sie ja nicht unendlich.“
„Das ist mir zu hoch“, sagte der kleine Idan und kratzte sich am Kopf.
„Aber es beweist, dass es kein Ding gibt, das unendlich ist.“
„Und der Weltraum?“, fragte Idan. „Kann der Weltraum endlich und begrenzt sein? Kann man nicht immer weiter und weiter fliegen?“
„Der Weltraum ist auch kein Ding“, sagte Äffchen. „Er ist mit Dingen gefüllt. Aber es könnte sein, dass der Weltraum, der mit Dingen gefüllt ist, irgendwo aufhört und alles, was sich darüber hinaus bewegt, erst einen neuen, zusätzlichen Raum bildet, der zuvor noch nie existiert hat. Jedenfalls ist der Boden, auf dem du stehst, nicht unendlich dick. Der Boden und alle Länder und Meere auf dieser Erde, die du bereisen kannst, sind kugelförmige Gebilde.“
„Eine Kugel?“, fragte ungläubig der kleine Idan.
„Eben das. Und der dunkle Mond Pessian und alle Planeten und Sterne, die du draußen am Himmel siehst, sind ebensolche Kugeln.“
„Was ist dann oben und unten?“, fragte der kleine Idan.
„Oben ist alles, was sich über der Oberfläche der Kugel befindet, und unten ist alles, was in Richtung ihres Mittelpunktes liegt.“
„Wenn ich aber jetzt anfange in der Erde zu graben“, sagte Idan, „und ich grabe immer tiefer und tiefer, bis ich zum Mittelpunkt komme, kann ich dann nicht auch noch über den Mittelpunkt hinaus graben, und zwar so lange, bis ich auf der anderen Seite herauskomme? Und müsste ich dann nicht auf der anderen Seite von der Erde herunterfallen? Oder kehrt sich im Erdmittelpunkt oben und unten einfach um?“
„Du kannst gar nicht bis zum Erdmittelpunkt graben“, sagte Äffchen. „Je näher du dem Mittelpunkt kommen würdest, desto schwerer würdest du, und in der Mitte würdest du ganz zu einer Kugel zusammengepresst. Nun aber sollst du auch wissen, was es mit dem Planetenmond Pessian auf sich hat. Dieser Pessian oder auch Pessima, wie ihn die grünen Eingeborenen von Ómuo nennen, wurde in Urzeiten von unserer Heimatwelt Plédos ausgestoßen, damit sich auf dessen Oberfläche das Leben in weichen Formen und in all seiner heutigen Vielfalt bilden konnte. Diese neu entstandene Welt Pessian, der dunkle Planetenmond, enthält alles Böse, Schlechte und Finstere, das damals noch mit unserer Welt von Plédos vereinigt war und der Entfaltung des Lebens ein starkes Hindernis bot. Auf Pessian dagegen haben sich wundersame und schreckliche Lebensformen gebildet, über die ich dir gleich berichten werde. Während die meisten Monde der anderen Welten beinahe tote Körper sind, ist Pessian zu einem echten, selbstständigen Planeten geworden, der sogar beinahe die gleiche Atmosphäre hat wie unsere Welt. Auch das Leben auf ihm ist ein selbstständiges und allerdings recht wunderliches geworden. Du musst dir nämlich vorstellen, dass große Teile der Oberfläche des Planetenmondes Pessian – einige größere Inseln und die schleimigen Meere ausgenommen – mit einer Schicht winziger, sechzehnbeiniger Gliedertiere verschiedener Farbe und Größe überzogen sind, die dort überall herumwimmeln. Das sind zurückgebildete Windruten, wie sie auf vielen Welten zuhause sind. Windruten sehen tatsächlich aus wie zusammengebundene Ruten, die oben und unten in je acht spinnenartige Beinchen auslaufen, sodass man oben und unten nicht unterscheiden kann. Man könnte sagen, sie haben in ihrer Entwicklung den Gipfel der Kopflosigkeit erklommen und stehen in ihrer Lebensweise noch unter den Pflanzen, bei denen man ja wenigstens Wurzeln und Blüte unterscheiden kann. Den Mineralien und Steinen schon ähnlicher und dennoch wie Tiere belebt, bilden sie das Nahrungsangebot und zugleich die äußeren Häute der intelligenten Bewohner des Planeten, der schrecklichen Pessianer. Diese Pessianer sollen so furchtbar anzuschauen sein, dass sie jeglicher Beschreibung spotten und dass selbst in der uralten Chronik, aus der ich mein Wissen über den Planetenmond Pessian entnehme, nichts darüber verzeichnet ist. Am ehesten ließen sie sich noch, so heißt es, mit riesigen, gespenstartigen Insekten vergleichen, die entfernt an Menschen erinnern. Sie bewegen sich aufrecht und in ständiger Drohgebärde und pfeifen dabei durch ihre Tracheensysteme wie ausgewachsene Windruten in Íoland oder in Totenmund, was sich dann anhört wie das Heulen des Windes. Außerdem rasseln und klappern sie ständig dabei, als schlügen die blanken Zähne von Totenschädeln aufeinander. Dieses Zähneklappern ist übrigens ein ganz typisches Geräusch der Pessianer.“