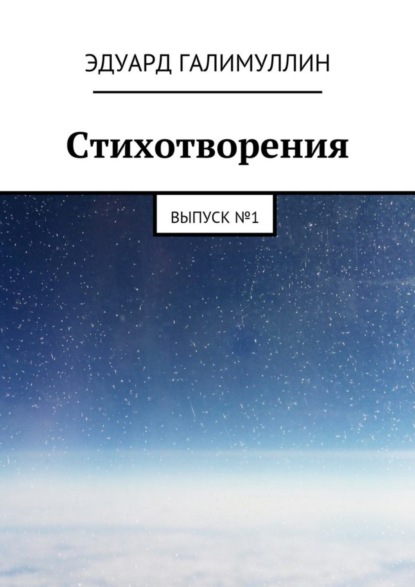Licht und Schatten – der Alltag eines Krankenhausarztes

- -
- 100%
- +
Bei den „Bergen von Arbeit“ handelte es sich im Wesentlichen um die Akten entlassener Patienten, deren abschließender Arztbrief noch zu diktieren war. Da mir anfangs die notwendige Routine fehlte, um aus dem Krankheitsverlauf eines Patienten einen in sich schlüssigen Arztbrief zu formulieren, und es sich zudem um eine höchst langweilige Tätigkeit handelt, wuchs mein Aktenberg erschreckend schnell an. Die erste wichtige Routine entwickelte ich zunächst dahingehend, durch eine geschickte Stapeltechnik ein vorzeitiges Umstürzen des Aktenberges zu verhindern. Akuter Handlungsbedarf, also das Diktat der Arztbriefe, war aus einer Vielzahl von Gründen irgendwann aber zwingend erforderlich: Es handelte sich um Probleme der Statik, der vorhandenen Bebauungsfläche, der Kommunikation, des aktuellen Bedarfs, ein mentales Problem und strenge Vorgaben des Vorgesetzten: Entweder die Statik geriet gefährlich ins Wanken, und der Umsturz des Aktenberges stand trotz ausgefeilter Stapeltechnik unmittelbar bevor, oder ein Anbau zu einer Bergkette war mangels freier Schreibtischfläche nicht möglich, oder der Berg versperrte mir die Sicht auf meinen gegenübersitzenden Kollegen mit entsprechender Einschränkung der Kommunikation, oder man benötigte die Akte, weil der Patient kurzfristig wieder eingeliefert worden war, oder mein eigener Ordnungssinn meldete sich protestierend, oder schlimmstenfalls mahnte der Chefarzt das Diktat der Arztbriefe an. Besonders diese letzte Möglichkeit galt es unbedingt zu verhindern, die hohe Kunst bestand im Wesentlichen darin, bereits vor einer drohenden Erinnerung des Chefarztes aktiv zu werden. Dazu fand ich in der Klinik nur selten die notwendige Ruhe. Im Ernstfall schleppte ich also anfangs eine Tüte voller Arztbriefe mit nach Hause, um dort diktierend eine Nachtsitzung einzulegen, bis mir mit dem Mikrofon in der Hand die Augen zufielen und mein Kopf ermüdet auf die vor mir ausgebreiteten Krankenunterlagen gesunken war. Bald aber waren solche häuslichen Nachtsitzungen dann nicht mehr erforderlich.
Bevor ich selbstständig arbeiten konnte, begleitete ich meinen Zimmerkollegen bei den täglichen Visiten, auch bei den Chefarztvisiten. Das Ausfüllen des Aufnahmebogens der Patienten hatte im Gegensatz zu heutigen Gepflogenheiten höchst ausführlich zu erfolgen, darauf wurde mein Kollege von dem Chefarzt häufiger hingewiesen, und ich damit natürlich indirekt auch. Hingegen war mein Kollege eher ein Freund knapperer Befundberichte, wenn man es großzügig formulieren wollte. Auf dem Weg zum gewünschten Behandlungsziel schien er eine gewisse Arbeitsrationalisierung zu bevorzugen. Diesen Arbeitsstil behielt er trotz einiger Scharmützel mit dem Chefarzt übrigens bei, wie gesagt, er ruhte in sich selbst. Seine Diagnosen und Therapien waren allerdings überwiegend korrekt.
Bei einer der nächsten Visiten kritisierte der Chefarzt, dass eine der Patientinnen meines Kollegen mit einem Schlaganfall schon viel zu lange, nämlich sechs Wochen, im Krankenhaus lag. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters hatte diese Patientin nur einen leichteren Schlaganfall mit geringer Arm- und Beinschwäche erlitten, jedoch ohne Sprachstörung. Nun verhält es sich so, dass die Hinauszögerung einer Patientenentlassung durchaus und in mehrerlei Hinsicht zu einer Arbeitserleichterung führen kann. Zum einen ist das Bett belegt, sodass kein neuer Patient mit der üblichen Prozedur aufgenommen werden kann. Zum anderen kann das lästige, aber notwendige Diktieren des Arztbriefes in eine weiter entfernte Zukunft verschoben werden. Daher entsprach die bis dahin fehlende Entlassung der Patientin mit dem Schlaganfall in etwa der Arbeitsphilosophie meines Kollegen, keineswegs aber den Vorstellungen des Chefarztes. Bezüglich einer rechtzeitigen Entlassung trafen hier also vollkommen unterschiedliche Welten aufeinander. Folgerichtig ordnete der Chefarzt mit strenger Stimme die Entlassung der Patientin am nächsten Tag an.
Eine Woche später war die nächste Chefarztvisite angekündigt. Mein Kollege und ich saßen in unserem gemeinsamen Arztzimmer und ergänzten zur Vorbereitung der Visite die Krankenakten, machten hier und da noch eine Notiz oder ordneten Untersuchungen für den nächsten Tag an. Plötzlich wurde ich aus dieser betriebsamen Ruhe aufgeschreckt: „Verflixt noch mal, ich habe etwas vergessen!“, rief mein Kollege ärgerlich über sich selbst und schlug sich dabei mit der Handinnenfläche vor die Stirn. Ich schaute ihn fragend an. An diesem Tag schränkte ausnahmsweise kein Aktenstapel die Sicht auf ihn ein. Seine Stirn hatte sich in sorgenvolle Falten gelegt. Für einen kurzen Moment drohte dieser sonst so besonnene und ruhige Mensch seine Fassung zu verlieren, so schien es mir. „Ich habe total vergessen, die Patientin letzte Woche zu entlassen!“ Er hatte gerade die Akte der Patientin mit dem Schlaganfall aufgeschlagen. Ich musste mir zu meiner Schande eingestehen, dass ich auch nicht mehr daran gedacht hatte.
Nun war guter Rat teuer. Es blieb keine Zeit mehr für eine sofortige Entlassung, denn schon in wenigen Minuten würde der Chefarzt die Station zur Visite betreten. Und die Patientin konnten wir natürlich auch nicht innerhalb weniger Minuten einfach vor die Tür setzen. „Und jetzt?“, wollte ich ratlos wissen. Ich teilte vollkommen seine Einschätzung, dass wir auf eine größere Katastrophe zusteuerten. Schließlich war unser Chefarzt, obwohl nicht mehr der Jüngste an Jahren, für sein ausgezeichnetes Gedächtnis bekannt. Dieser Ruf eilte ihm weit voraus. Uns drohte großes Ungemach. Mein Gegenüber brütete angestrengt über der Patientenakte, fuhr sich sorgenvoll mit einer Hand durch die Haare und schüttelte ärgerlich über die eigene Vergesslichkeit wiederholt den Kopf. Mir fiel auch keine sofortige Lösung dieses durchaus ernsten Problems ein.
Nach langen Minuten intensiven Grübelns sprang er plötzlich aus seinem Schreibtischsessel auf, strahlte mich an und rief begeistert: „Ich hab’s: Wir müssen sie verschwinden lassen!“ Jetzt hat er aus Angst vor dem bevorstehenden Donnerwetter des Chefarztes endgültig den Verstand verloren, so schoss es mir sogleich durch den Kopf: „Wie bitte? Wie soll das denn funktionieren?“, fragte ich erstaunt und so, als hätte ich mich nur verhört. Mir war nicht geläufig, wie man solch ein riskantes Vorhaben in die Tat umsetzen konnte. Solch eine abenteuerliche Idee hatte ich ihm überhaupt nicht zugetraut. Seine sorgenvolle Miene hatte sich in ein breites Grinsen verwandelt. „Wir schieben sie einfach in das Badezimmer!“ Mir fehlten die Worte, und ich starrte ihn ungläubig mit offenem Mund an. „Und wenn es schiefgeht?“, gab ich zu bedenken. „Wir haben keine andere Wahl“, sagte er ungeduldig, denn die Zeit drängte. Mit dieser Erkenntnis hatte er nun auch wieder recht.
Das Badezimmer war natürlich nicht irgendein gewöhnliches Badezimmer. Es war mindestens fünfmal so groß wie unser Arztzimmer, in der Mitte thronte freistehend eine überdimensionale Badewanne mit einer Hebevorrichtung für schwer bettlägrige Patienten. Das Schicksal war uns auch insofern wohlgesonnen, als die Türe zu diesem Badezimmer zufällig genau gegenüber der Zimmertüre unserer Patientin lag. Die Parole lautete ganz einfach: Je kürzer der Weg, desto geringer die Aufregung der Patientin und das Risiko, entdeckt zu werden. Der Ortswechsel der Patientin musste blitzschnell erfolgen, um erstens kein Aufsehen zu erregen und zweitens dem Chefarzt zuvorzukommen, es blieben uns nur noch wenige Minuten Zeit.
Wir verließen also eilig unser Arztzimmer und gingen rasch in ihr Zimmer, in dem sie alleine lag. Dies war insofern ein Vorteil, als es keine lästigen Zeuginnen für die Umsetzung unseres Vorhabens gab. Mein Kollege erklärte ihr kurz und knapp und damit unwiderruflich die Notwendigkeit einer sofortigen Grundreinigung ihres Zimmers, die an diesem Morgen angeblich von den Putzfrauen vergessen worden wäre, und dass sie daher für einen Moment in einem anderen Raum untergebracht werden müsste. Diese Nachricht wurde von der Patientin durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen, denn sie nickte nach einem kurzen Blick in die Zimmerecken ganz verständnisvoll mit dem Kopf. Offenbar hielt auch sie eine Grundreinigung für dringend erforderlich. Er entschuldigte sich hastig für die Unannehmlichkeiten, die damit verbunden wären. Wir schoben also die Patientin in ihrem Bett und mitsamt dem Nachttisch in das Badezimmer gegenüber, drückten ihr für den Notfall eine Klingel in die Hand und verließen eilig wieder den Baderaum, ehe sie zur Besinnung kam und neugierige Fragen stellen konnte. Die Schwestern auf der Station wurden vollständig in unseren Plan eingeweiht und zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet. Die Krankenakte der Patientin wurde auf Anregung der Schwestern gerade noch rechtzeitig aus dem Visitenwagen entfernt.
Zehn Minuten später erschien der Chefarzt gemessenen Schrittes und gar nicht so übel gelaunt auf der Station. Seine Stimmungslage konnte man glücklicherweise häufig seinen Gesichtszügen entnehmen. Ein ernster Gesichtsausdruck verhieß in aller Regel nichts Gutes, und man war gut beraten, während der Visite auf seine Anordnungen nicht zu viele fachliche Entgegnungen folgen zu lassen. Hingegen gab seine entspannte Miene an diesem Tag, als er die Station betrat, durchaus Anlass zur Hoffnung auf einen Durchgang ohne größeres Gemetzel. Mein Kollege und ich zwinkerten uns mit den Augen hinter seinem Rücken bereits vertraulich zu, wir hatten seine Mimik schließlich schon oft genug studieren dürfen. Tatsächlich sollten wir an diesem Tag eine ungewöhnlich friedliche und beinahe erholsame Chefarztvisite erleben. Die begleitende Stationsschwester hatte während der Visite keine Miene verzogen oder sich anderweitig etwas über die versteckte Patientin anmerken lassen.
Als wir die Patientin nach der Visite aus dem Badezimmer befreiten und sie zurück in ihr Zimmer schoben, ließ sie ihren Blick sofort prüfend durch den Raum schweifen. Mit dem geschulten Auge einer erfahrenen Hausfrau bemerkte sie natürlich blitzschnell die nach wie vor fehlende Grundreinigung ihres Zimmers. Während ihre Finger bereits entrüstet auf die sichtbaren Beweise der nach wie vor bestehenden Verunreinigungen deuteten und sich ihr Mund noch um Worte ringend gerade eben empört zu der entsprechenden Frage öffnen wollte, hatten wir ihr Zimmer bereits wieder fluchtartig im Eilschritt verlassen. Von draußen schnappten wir durch die hinter uns zugefallene Türe nur noch einige undeutliche Wortfetzen voller Proteste von ihr auf. Wir hatten die Visite ohne größere Blessuren überlebt und waren mit dem Ablauf genauso zufrieden wie unser Chefarzt.
Was ist nun aus den Hauptdarstellern dieses Schauspiels geworden?
Der Chefarzt hat nie von der versteckten Patientin erfahren, so glaubten wir damals jedenfalls. Einschränkend bleibt allerdings zu bedenken, dass gute Chefärzte für gewöhnlich ihre Augen und Ohren überall haben. Sollte er dennoch von unserer streng geheimen Handlung erfahren haben, so hatte er wenigstens einmal Gnade vor Recht walten lassen.
Die Stationsschwestern haben die Geschichte gleich einer Legende an nachfolgende Schwesterngenerationen weitergereicht.
Die Patientin hat sich sehr herzlich für die gut siebenwöchige Behandlung ihres Schlaganfalls bedankt.
Mein Kollege, das Schlitzohr, hat noch über ein Jahr an unserer Klinik gearbeitet, bevor er sich gemäß seiner Lebenseinstellung in eine ruhige Landarztpraxis im Bergischen Land zurückgezogen hat.
Und ich? Ich muss heute noch über diese unglaubliche Geschichte lachen.
Kurze Anmerkung zum Verständnis: Heutzutage dauert die Klinikbehandlung eines Schlaganfalls in einer Ausprägung wie bei unserer Patientin trotz einer sehr viel umfangreicheren Diagnostik nicht mehr sieben Wochen, sondern etwa zehn Tage.
5 Ein großer Irrtum
Ein Wochenenddienst bedeutete damals, dass man am Freitagmorgen seinen Dienst antrat und am folgenden Montag wenn möglich um 16:30 Uhr den Dienst beenden konnte. Es handelte sich also um einen Anwesenheitsdienst von 80 Stunden, in denen man am Wochenende ununterbrochen alleine und eigenverantwortlich die stationären Patienten, die Neuaufnahmen und die Notfälle zu versorgen hatte. Diese Dienste waren nun nicht so fürchterlich, wie es sich anhört, aber doch sehr kräftezehrend. Wenn man Glück hatte, verbrachte man ein relativ ruhiges verlängertes Wochenende in der Klinik und hatte ausreichend Schlaf zwischendurch. Es gab jedoch auch Wochenenden, an denen es mehr oder weniger bei Schlafversuchen blieb, die durch das Funkgerät oder Telefon ein abruptes Ende fanden. Ein solches Wochenende mit Schlafversuchen sollte mir bevorstehen.
Das Bereitschaftszimmer befand sich in einem Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Klinik. Wer hier eine Wohlfühloase für tüchtige diensttuende Ärzte erwartet hatte, wurde bitter enttäuscht. Ein Stuhl, ein kleiner Tisch, ein sauber bezogenes Bett mit durchgelegener Schaumstoffmatratze, ein Kleiderschrank mit einigen Wolldecken, saubere, aber hässliche Vorhänge mit verblassenden Farben, die depressiv vor dem einzigen Fenster hingen, ein nichtssagendes, immerhin gerade hängendes Bild an der Wand über dem Bett, der Raum insgesamt an Schmucklosigkeit nicht zu überbieten. Dort auf der Fensterbank in einer Ecke ruhte ein altes verbeultes Radio mit höchstens drei zu empfangenden Sendern und abgeknickter Antenne. Dusche und Toilette befanden sich draußen auf dem Flur. Waren diese Mammutdienste an Wochenenden nicht schon Strafe genug, so wurden sie durch die Trostlosigkeit dieses Bereitschaftszimmers noch übertroffen. Aber ich wollte nicht klagen, schließlich ging es meinen Arztkollegen um keinen Deut besser. Und irgendwann, nach zahllosen Nachtdiensten, ignorierte man einfach dieses langweilige Zimmer. Es war nicht so, dass ich mich wegen der Dienstzeiten oder der Begleitumstände etwa in Gestalt dieses Bereitschaftszimmers gegen die Dienste wehrte. Sie gehörten eben zum Beruf eines jeden Krankenhausarztes, und nach zahlreichen solcher Dienste gewöhnte man sich daran. Nach vier oder fünf Wochen stand der nächste Wochenenddienst an, und man konnte sich rechtzeitig darauf einstellen.
Diese Dienste wurden natürlich erleichtert durch nette Kontakte und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Fachabteilungen, die das gleiche Los gezogen hatten, zum Beispiel Mitarbeitern der Chirurgie oder Neurologie, und selbstverständlich den Schwestern auf den internistischen Stationen. Hier eine Aufmunterung, dort ein freundliches Wort, wir saßen schließlich alle im gleichen Boot.
Selten kam es leider vor, dass man einen Arztkollegen hatte, der sich die Bezeichnung „Kollege“ noch nicht so recht verdient hatte. Solche Mitarbeiter zeigten Tendenzen, ihre Arbeit dahingehend zu optimieren, dass sie eigene Aufgaben an ihre Kollegen delegierten. Sie verfolgten eher eigene Interessen, als sich dem Teamgeist unterzuordnen. Bisweilen versuchten sie auch, sich unter einem Vorwand vor einem Nachtdienst zu drücken.
Solch ein Mitarbeiter trat an einem Freitag meines Wochenenddienstes um 14:00 Uhr auf mich zu und sagte: „Hör mal, ich muss heute zwei Stündchen eher weg. Unten in der Ambulanz sitzt ein junger Bursche mit Luftnot, ich glaube, der hat nichts. Könntest du den bitte übernehmen?“ Ich willigte ein, zumal ich mir den Rücken freigehalten und die Routinearbeiten auf meiner Station bereits erledigt hatte.
Ich machte mich also auf den Weg in die Ambulanz im Erdgeschoss. Dort saß auf einer Trage ein großer, kräftiger junger Mann, etwa 23 Jahre alt, mit strohblonden Haaren und wohlgenährt. Mein erster Eindruck, bevor ich ihm zur Begrüßung die Hand reichte und mich vorstellte, sagte mir bereits, dass das Urteil meines Kollegen, „Ich glaube, der hat nichts“, keinesfalls zutraf. Er hatte nämlich sichtbare Luftnot, seine Atmung war relativ beschleunigt, und seine Lippen und Fingernägel waren leicht bläulich verfärbt als Hinweis auf einen deutlichen Sauerstoffmangel. Er berichtete, dass er die Luftnot schon seit einigen Tagen hätte und dass sie von Tag zu Tag schlimmer geworden wäre. Er hätte dabei anhaltenden Hustenreiz ohne Auswurf, jedoch ohne Fieber, und könnte nachts wegen der Atemnot kaum mehr ruhig durchschlafen. Alle meine Fragen nach früheren Lungenkrankheiten, oder nach Kontakt mit Giftstoffen, oder nach Allergien, verneinte er. Nach meinen ersten Eindrücken und nach den Angaben des Patienten bezweifelte ich ernsthaft, dass sich mein Kollege ihn überhaupt angesehen hatte. Eine Minute hatte gereicht, um sein Urteil zu widerlegen.
Ich zog mein Stethoskop aus der Kitteltasche und hörte seinen Brustkorb von allen Seiten ab. „Bitte mit offenem Mund tief ein- und ausatmen!“ Ich hörte hier und da ein leises Knistern, das mich nicht weiterbrachte, keinesfalls aber dieses Rasseln wie bei einer Lungenentzündung oder ein Pfeifen wie bei einem Asthmaanfall, keine brodelnden Klänge wie bei einer Wasseransammlung in der Lunge. Ich hörte auch, dass alle Lungenanteile belüftet waren, und dennoch bot er diese untrüglichen Zeichen des Sauerstoffmangels! Vielleicht handelte es sich um eine Lungenembolie, so dachte ich, bei der eine Lungenarterie durch ein Blutgerinnsel verstopft ist, die würde man mit dem Stethoskop nicht hören können. Allerdings gehörte dazu in der Regel eine Beinvenenthrombose, und die hatte er nicht, wie mir ein Blick auf seine Beine zeigte. Merkwürdig, sehr ungewöhnlich! Ich hatte keinen Hinweis auf die Ursache seiner Luftnot gefunden. „Wir müssen eine Röntgenaufnahme von der Lunge anfertigen, vielleicht wissen wir dann mehr“, erklärte ich ihm.
Unser Chefarzt war Internist und Radiologe und hielt jeden Morgen die Röntgenbesprechung ab. Daher konnte ich Röntgenbilder der Lunge bereits recht gut beurteilen. Die Lungenaufnahme wurde durchgeführt, und ich wartete ungeduldig vor der Entwicklungsmaschine in der Röntgenabteilung. Ich musste sofort die Ursache dieser seltsamen Luftnot in Erfahrung bringen. Endlich kam die Röntgenaufnahme heraus, ich zog sie langsam aus der Entwicklungsmaschine und hängte sie an den beleuchteten Schaukasten für Röntgenbilder.
Die Röntgenassistentin stand neben mir, sie wollte eigentlich nur die richtige Belichtung der Aufnahme überprüfen, und hielt sich sofort erschrocken die Hand vor den Mund. Ein kurzer Blick genügte, ich musste tief Luft holen und mich erst einmal auf den Hocker vor dem Schaukasten setzen. Es war ein entsetzlicher Befund, mit dem keiner von uns beiden gerechnet hatte. Gesundes Lungengewebe wird im Röntgenbild durch den Luftgehalt schwarz dargestellt. Nun stelle man sich einen Tag im Spätwinter vor, die Temperaturen liegen bereits knapp über dem Gefrierpunkt, es herrscht dichtes Schneetreiben, welches besonders eindrucksvoll im Licht eines Autoscheinwerfers zu sehen ist. Genauso sah das Röntgenbild des jungen Patienten aus, wir sprachen bei solch einem Bild leider recht treffend von einer „Schneegestöberlunge“. Beide Lungenflügel waren von oben bis unten übersät mit solchem Schneegestöber, nur hatten diese weißen Flecken im Vergleich zu Schneeflocken eine mehr rundliche Form und waren nicht so wattig-bauschig, sondern schärfer begrenzt. Wir standen vor einem sehr schlimmen Befund: Es handelte sich um ausgedehnte Lungenmetastasen! Die Metastasen (bösartige Tumorabsiedlungen) unterschiedlicher Größe standen dicht an dicht, hatten keinen Lungenanteil verschont und sich bis in die kleinsten Winkel der Lunge ausgebreitet. Solch einen massiven Befall der Lunge mit Metastasen hatte ich bis zu diesem Tag noch nie gesehen. Es handelte sich zweifellos um das weit fortgeschrittene Endstadium eines bösartigen Tumors.
Ich hatte nicht die geringste Vorstellung, von welchem bösartigen Tumor diese ausgedehnte Streuung der Metastasen ausgehen konnte. Es musste sich um einen hochgradig aggressiven Tumor handeln, der für die Bildung der Metastasen die Lunge bevorzugte. Und möglicherweise waren die Metastasen genau so aggressiv und schnell gewachsen wie der Primärtumor selbst. Andernfalls hätte der junge Patient schon seit sehr viel längerer Zeit über Atembeschwerden klagen müssen.
Ich holte die körperliche Untersuchung nach, zuvor in der Ambulanz hatte ich meine Untersuchung zunächst auf den Brustkorb beschränkt. Ich fand keinen Ursprung der Lungenmetastasen. Es gab keine vergrößerten Lymphknoten, und Hals, Rachen und Bauchraum waren bei der Inspektion und dem Abtasten in Ordnung. Die Möglichkeit der Ultraschalldiagnostik gab es damals noch nicht. Selbst die Ergebnisse seiner Blutuntersuchung ergaben keinen Hinweis auf den Ursprung der Krebserkrankung. Angesichts seiner erheblichen Luftnot, die den Patienten mehr als genug belastete, teilte ich ihm den Röntgenbefund nicht mit und sprach nur von einer beginnenden Lungenentzündung.
Ich konnte nur das vordringliche Symptom, nämlich die Luftnot, behandeln und versuchen, ihm so etwas Erleichterung zu verschaffen. Er sollte Bettruhe einhalten, der Oberkörper wurde so hoch wie möglich gelagert, damit sich die Lunge bei der Atmung besser entfalten konnte, und es wurde Sauerstoff über eine Nasensonde verabreicht. Des Weiteren verordnete ich prophylaktisch ein Antibiotikum, denn die Minderbelüftung der Lunge durch die Metastasen könnte bald zu einer Ansiedlung von Bakterien führen, sowie Kortison und ein Medikament zur Erweiterung der Bronchien. Den kurzen Gedanken an eine Behandlung am Beatmungsgerät auf der Intensivstation verwarf ich sofort wieder, denn dadurch würden die zahlreichen Metastasen auch nicht gebessert. Ich überzeugte mich häufig und regelmäßig an diesem Wochenende von seinem Zustand und Befinden, es schien ihm subjektiv und auch nach meinem Eindruck eher etwas besser zu gehen. Auch die Schwestern hielt ich an, regelmäßig nach ihm zu schauen. Dieser Aufforderung hätte es eigentlich nicht bedurft, sie waren erfahren genug.
Das Wochenende zog sich hin, es wurde nicht zu hektisch, aber ich war trotzdem ausreichend beschäftigt. Es gab keine weiteren kritischen Krankheitsfälle, bis auf mein Sorgenkind. Sein Zustand blieb unverändert, ich erhöhte die Sauerstoffzufuhr noch etwas.
Ich hatte nur schwer in einen unruhigen Schlaf finden können, denn zu sehr beschäftigte mich der junge Patient. In der Nacht zu Montag, gegen 2:00 Uhr morgens, schrillte das Telefon. Ich fuhr in dem Bett im Bereitschaftszimmer hoch und griff zum Hörer. Die Nachtschwester meldete sich am Apparat: „Herr Doktor, Sie müssen kommen. Ihr Patient ist verstorben!“ „Was? Wie ist das möglich?“, brüllte ich in den Hörer. Ich hatte wie gewöhnlich in voller Dienstkleidung geschlafen, warf mir nur hastig den Arztkittel über, rannte über die Straße und durch den gegenüberliegenden Haupteingang der Klinik, raste die Treppen hoch auf die Station und riss die Türe seines Zimmers auf.
Der Patient war seit ungefähr einer Stunde tot, ich tastete keinen Puls, konnte keine Herztöne mit dem Stethoskop hören, und seine Pupillen waren geweitet und ohne jegliche Reaktion auf den Lichtreiz meiner kleinen Stabtaschenlampe. Ich schloss ihm die noch halb geöffneten Augen und bedeckte seinen Kopf mit der Bettdecke. Selbst in Kenntnis seines Lungenbefundes hatte ich keinesfalls mit seinem so raschen Lebensende gerechnet. Ich hatte im Gegenteil sehr gehofft, ihn zumindest halbwegs stabil über das Wochenende bringen zu können. Wie hatte das geschehen können? Warum hatte er nicht die bereitliegende Klingel auf seinem Nachttisch betätigt oder um Hilfe gerufen? Oder war ihm im Schlaf die Sauerstoffsonde aus der Nase herausgerutscht? Mich plagten heftige Selbstzweifel. Hätte ich noch mehr für ihn tun können? Hatte ich etwas versäumt oder übersehen? Alle meine Bemühungen waren vergeblich geblieben, es fühlte sich in diesem Augenblick an wie eine sehr bittere Niederlage. Eigentlich durfte gar kein Patient in meinem Dienst versterben, und schon gar nicht ein 23-jähriger junger Mann, für den das Leben eigentlich noch gar nicht so recht begonnen hatte. Damals, als ich noch alleine am Bett meines verstorbenen Patienten stand, fühlte ich mich sogar auf eigenartige Weise schuldig an seinem Tod. Ich sollte noch längere Zeit brauchen, bis ich den plötzlichen Tod eines mir anvertrauten Patienten verarbeiten konnte. Ich ging an das Fenster in seinem Zimmer und schaute in die mondlose, finstere Nacht hinaus. Ich fühlte mich auf einmal sehr einsam. Aber das Grauen war noch nicht vorüber.
Der Patient war verheiratet. „Haben wir eine Telefonnummer von der Ehefrau?“, fragte ich die beiden Nachtschwestern, die ausschließlich Nachtwachen machten und genauso betroffen waren wie ich selbst. Sie reichten mir die Unterlagen des Patienten herüber. Ich griff zum Telefonhörer, wählte die Nummer und erreichte die Ehefrau. Ich sagte zu ihr: „Sie müssen dringend in die Klinik kommen, der Zustand ihres Mannes hat sich erheblich verschlechtert!“ Ich vermied es seit Anbeginn meiner Tätigkeit, nahen Angehörigen am Telefon mehr oder weniger sachlich den Tod eines Patienten mitzuteilen. Dies wollte ich ihnen persönlich sagen und sie auch an das Totenbett begleiten. Telefonisch konnte man schwer beurteilen, wie sie auf die Todesnachricht reagieren würden. Trauer und Verzweiflung suchen sich ihren eigenen Weg.