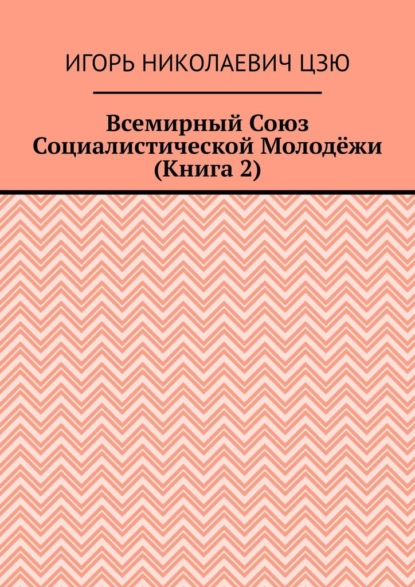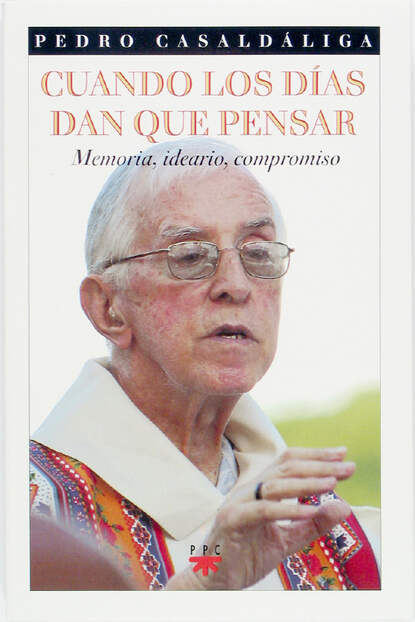Licht und Schatten – der Alltag eines Krankenhausarztes

- -
- 100%
- +
Der Chefarzt betrat natürlich nicht um 7:00 Uhr frühmorgens das Krankenhaus, aber ich nach wenigen Stunden Schlaf in dem Dienstzimmer, das sich in dem Gebäude gegenüber der Klinik befand. Ich lenkte meine Schritte sofort auf die Station und öffnete die Badezimmertüre. Mein nächtlicher Gast war verschwunden und hatte den Raum sogar relativ ordentlich hinterlassen. Die leere Teekanne, ein Becher und ein Teller, den er bis auf den letzten Brotkrümel geleert hatte, standen einsam neben der Liege auf dem Fußboden. „Na also, hat doch prima geklappt“, sagt ich zu mir selbst. Dann öffnete ich weit die beiden großen Flügelfenster, und die Alkoholschwaden in dem Raum entfleuchten in die kalte, klare Winterluft.
Ich konnte nicht behaupten, dass dieser Vagabund die Situation ausnutzte und aus unserem Krankenhaus seinen zweiten Wohnsitz machte. In den folgenden Jahren kam er vielleicht zwei- bis dreimal im Jahr für eine Nacht, vorzugsweise in den kalten Wintermonaten und auffallenderweise immer dann, wenn ich Nachtdienst hatte. Inzwischen verhielt es sich schon so, dass sich die Nachtschwestern und ich uns in einer eisigen Winternacht fragten, wann uns unser Freund wieder besuchen würde, es wäre doch eigentlich genau sein Wetter. Kurze Zeit später suchte er dann tatsächlich eine wärmende Bleibe für eine Nacht. Vielleicht verhielt es sich aber auch so, dass meine Kollegen in ihren Nachtdiensten nicht die Geduld mit ihm aufbrachten und ihn, betrunken wie er war, direkt wieder auf die Straße setzten. Ich hegte auch den Verdacht, dass er diverse andere Möglichkeiten der Unterbringung kannte, zum Beispiel das nicht sehr weit entfernte Obdachlosenasyl. Unser gastliches Krankenhaus schien er immer nur dann aufzusuchen, wenn er sich woanders gerade einmal wieder sämtliche Sympathien verscherzt hatte. Auf seine Weise war er ein kleiner Überlebenskünstler am Rande der Gesellschaft, ohne festen Wohnsitz, der sich aber dennoch nicht aufgegeben hatte.
Zu unserem Krankenhaus führte ein schmaler Zugangsweg durch ein kleines Waldstück mit dicht stehenden hohen Kiefern der angrenzenden Heidelandschaft, die Durchfahrt war jedoch nur für Rettungsfahrzeuge gestattet. Dennoch nutzte ich, wie übrigens viele andere Mitarbeiter auch, diese Zufahrt auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig, bedeutete sie doch eine wesentliche Abkürzung, so dass ich morgens zehn Minuten länger zu Hause schlafen konnte. Eines Morgens erschienen auf dem Zugangsweg hinter einem mächtigen Kiefernstamm in dem Waldstück zunächst die rote Kelle, dann der uniformierte Arm und schließlich der dazugehörige Polizist, nebst einem Kollegen. Ich war in einen gemeinen Hinterhalt geraten und ertappt worden. „Führerschein und Zulassung bitte“, sagten sie streng. Es folgte ein ausführlicher Vortrag über die begangene Verkehrswidrigkeit, die mich trotz intensiver Beteuerungen meiner Unabkömmlichkeit im Krankenhaus zehn Deutsche Mark kostete. Es war auch nur ein schwacher Trost, dass an diesem Morgen noch zahlreiche andere Mitarbeiter der Klinik mein Schicksal teilen mussten. Ärgerlich war nur die Tatsache, dass diese beiden Ordnungshüter in einer Rekordzeit so viele Mitarbeiter zur Kasse gebeten hatten. Während des Mittagessens in der Kantine an diesem Tag gab es nur ein Thema: Wir Ärzte fragten uns natürlich fachübergreifend, wer die gewinnbringende Anregung zu dieser modernen Form einer Wegelagerei gegeben hatte. Chirurgen, Neurologen und Internisten waren sich in ungewohnter Eintracht sehr schnell einig, dass diese Idee nur von „ganz oben“ gekommen sein konnte.
Viele Monate nach meiner grob fahrlässigen Verkehrswidrigkeit hatte ich wieder einmal Nachtdienst, und in dieser Nacht gab es nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Ich saß gemütlich mit den beiden Nachtschwestern bei einer Tasse Kaffee zusammen. Diese friedliche und harmonische Runde wurde spät abends abrupt unterbrochen durch drei nebeneinandergehende Personen, die langsamen Schrittes über den langen Stationsflur auf uns zukamen. Die mittlere Person zeigte ein auffallend unsicheres Gangbild, ähnlich einem schwankenden Schiff auf stürmischer See, sodass sie von den Begleitern kräftig gestützt werden musste. Schon von Weitem erkannte ich sie alle drei, Gesichter konnte ich mir schon immer gut einprägen: Es handelte sich um den König der Landstraße mit langem Rauschebart und der üblichen kräftigen Alkoholfahne und um die beiden Polizisten mit der roten Kelle, die mich um die horrende Summe von zehn Deutschen Mark erleichtert hatten.
Sie konnten sich wohl nicht mehr an mich erinnern, denn an jenem Morgen hatten sie einfach zu viele Verkehrssünder zur Kasse bitten müssen. Sie fragten: „Guten Abend, könnten Sie bitte bei diesem Mann eine Blutprobe abnehmen?“ Darauf wollte ich erst einmal wissen, was er denn überhaupt ausgefressen hätte. „Der hat mal wieder randaliert“, erklärten sie. Ich flunkerte ein wenig und teilte ihnen voller Bedauern mit, dass ich momentan furchtbar überlastet wäre, dass gleich mehrere dringende Aufgaben auf mich warten würden und ich die Blutprobe daher leider nicht entnehmen könnte. Bei diesen meinen Worten schien es mir fast so, als hätte ich bei einem kurzen Seitenblick ein fröhlich-triumphierendes, wenn nicht sogar ein dankbares Aufblitzen in den Augen meines Lebenskünstlers wahrgenommen, mit dem sich seine Gesichtszüge sichtbar entspannten. Jedenfalls blieb den beiden Polizisten nichts anderes übrig, als darauf achselzuckend mit dem Randalierer in ihrer Mitte und unverrichteter Dinge die Klinik wieder zu verlassen. Und ich erinnerte mich an meine dringende Aufgabe und kehrte zufrieden zu meiner Tasse Kaffee zurück, die ich nicht kalt werden lassen wollte. Wohlgelaunt dachte ich an ein geläufiges Sprichwort: „Man sieht sich doch immer zweimal im Leben“.
Bevor ich gemäß der Ausbildungsordnung zum Internisten die Klinik wechseln musste, begegneten wir uns noch ein letztes Mal, und diesmal nicht in einem kalten Winter, sondern im Hochsommer. Es gab in unserem Stadtteil eine kleine Fußgängerzone mit einigen Geschäften wie Bäckereien, Weinhandel, Blumenladen, Discounter und anderen mehr. An dem schönen Sommertag war die Fußgängerzone gut besucht, einige Passanten saßen unter den großen, rot-weiß gemusterten Sonnenschirmen vor den Bäckereien und nahmen einen kleinen Imbiss oder eine Tasse Kaffee zu sich. An meinem freien Nachmittag schlenderte ich gemächlich an den Geschäften entlang, um einige Besorgungen zu machen.
Schon von Weitem sah ich ihn an einer Straßenecke auf einem niedrigen Höckerchen sitzen, seine Füße hatte er auf einen kleinen Schemel gestützt, seine Hemdsärmel waren in der warmen Nachmittagssonne hochgekrempelt. Auf seinen angezogenen Knien ruhte ein großer Zeichenblock, auf dem er eine vor ihm stehende Frau offenbar mit Bleistift und Kennermiene porträtierte. Sein Blick richtete sich immer wieder auf ihr Gesicht und den Zeichenblock, einige Striche skizzierte er sogar, ohne die Augen von ihrem Gesicht abzuwenden. Mehrere Passanten standen um ihn herum und bewunderten sein Werk. Ich musste zweimal hinschauen, denn ich hätte ihn fast nicht wiedererkannt, unser letztes Zusammentreffen lag schon viele Monate zurück: Von seinem Rauschebart hatte er sich getrennt, seine Haare waren mehr als ordentlich frisiert, er war für seine Verhältnisse relativ ordentlich gekleidet, und seine mir nur allzu gut bekannte Alkoholfahne fehlte ebenfalls. Als ich langsam zu der Gruppe der Schaulustigen trat, blickte er nur kurz zu mir auf. In seinem Blick lag Erkennen, er verzog jedoch keine Miene, offenbar war ihm unser Wiedersehen an diesem Ort und in dieser Situation nicht angenehm. Ich blickte ihm von hinten über die Schulter auf seine Zeichnung und konnte es kaum glauben: Mit scharfer Beobachtungsgabe und erheblichem künstlerischem Talent hatte er die Gesichtszüge dieser Passantin mit wenigen Bleistiftstrichen und einigen Schraffierungen so gekonnt zu Papier gebracht, als würde sie nicht vor uns stehen, sondern aus dem Zeichenblock herauswachsen. Besser hätte man dieses Porträt nicht gestalten können. Die Art und Weise, wie er die Zeichnung angefertigt hatte, sagte sehr viel über ihn aus.
Ich hatte schon immer geahnt, dass in diesem rätselhaften Menschen viel mehr steckte, als nur ein hoffnungsloser Alkoholiker. Seine Augen, sein Blick und seine Gestik bei unserer ersten Begegnung, damals kurz vor Weihnachten, hatten es mir verraten. Als die Passantin ihr Porträt zufrieden zusammenrollte, unter den Arm klemmte und ihren Weg fortsetzte, fragte ich ihn, wie viel er denn für seine Kunstwerke nehmen würde: „Och, was die Leute so geben, Herr Doktor, meistens zehn Mark.“ „Und dann?“ Er sagte nichts, blickte mich nur an und wies mit einer Kopfdrehung und einer kurzen Anhebung des Kinns in die Richtung des nahegelegenen Kiosks, der dort am Marktplatz stand. Dort gab es neben Zeitungen und Tabakwaren sicherlich auch Schnaps, und er würde das Entgelt für sein Kunstwerk gewiss nicht in eine Zeitung investieren. Er war ehrlich, ich hatte seine Geste wohl verstanden.
Ich hatte mir über die Jahre, die ich ihn kannte, nie eingebildet, ihn von seiner Alkoholabhängigkeit befreien zu können. Dazu wäre sicherlich eine sechsmonatige Entziehungskur erforderlich gewesen, mit allerdings nur fraglichem Erfolg. Stattdessen habe ich ihn aber ein wenig bedauert, weil er mit seinem Humor, seiner Schlitzohrigkeit und seinem zweifelsohne vorhandenen künstlerischen Talent sehr viel mehr aus seinem Leben hätte machen können.
Dennoch hatte ich nie den Eindruck gehabt, dass er mit seinem Lebensstil unglücklich war, vielleicht aber doch mit einer einzigen Ausnahme: einer frostigen, bitterkalten Winternacht ohne ein wärmendes Dach über dem Kopf.
7 Das Schulzeugnis
Die Arbeit der letzten Tage war anstrengend genug, und die Innere Abteilung war mit Patienten nahezu voll belegt. Mein letzter Nachtdienst lag noch nicht lange zurück, und nun trat ich bereits den nächsten Nachtdienst an. Warum mussten eigentlich die meisten ernsten Notfälle nachts in die Klinik kommen und warum auch noch ausgerechnet in meinen Diensten? Ich haderte mit meinem Schicksal und ertappte mich bei finsteren Verschwörungstheorien, so als hätten es alle erdenklichen lebensbedrohlichen Notfälle nur auf meine Dienste abgesehen. Dies war natürlich nicht der Fall, denn schließlich waren auch meine Arztkollegen in ihren Diensten gut beschäftigt, aber so war an diesem Abend eben die Stimmungslage.
Ich erhielt einen Anruf von unserem Pförtner, der mir mitteilte, dass sich der Notarzt „mit einer Tablettenvergiftung“ angekündigt hatte. Nun war es seinerzeit nicht so, dass der Notarzt jeden Patiententransport in die Klinik telefonisch ankündigte. Dies geschah in der Regel nur bei besonders dringenden Notfällen. Daher begab ich mich sofort in die große Halle neben der Notfallambulanz, in die der Notarztwagen einfahren würde, und wartete dort zusammen mit den Ambulanzschwestern.
Die Bezeichnung „Tablettenvergiftung“ konnte nun allerhand bedeuten. Abhängig von dem eingenommenen Medikament und der Dosierung konnte es sich um eine relativ harmlose oder aber auch um eine lebensgefährliche Vergiftung handeln. Über die Gründe der Vergiftung, die von einer versehentlichen Überdosierung über einen dummen Streich bis zu einem ernst gemeinten Selbstmordversuch reichten, fehlten uns ebenfalls jegliche Informationen. In dieser Ungewissheit warteten wir also auf den Notarztwagen.
Nach wenigen Minuten hörten wir in der Ferne schon das Martinshorn, das langsam näher kam und immer lauter wurde. Die Krankenwagenfahrer ließen das Martinshorn bis unmittelbar vor dem Krankenhaus eingeschaltet, obwohl auf der Zufahrtsstraße zu dieser Nachtstunde so gut wie kein Verkehr herrschte. Auch dieser Umstand deutete eher auf einen sehr dringenden Notfall hin. Kurz darauf fuhr der Notarztwagen schon in die Halle hinein. Als die Rettungssanitäter aus dem Wagen sprangen und die Wagentüren öffneten, sah ich zwei 14-jährige Mädchen mit sehr blasser Hautfarbe und somit in schlechtem Zustand. Ich reagierte mehr als erstaunt, denn auf gleich zwei Patientinnen war ich nicht vorbereitet worden. Entweder der Notarzt oder der Pförtner hatte bei seinem Anruf die zweite Patientin unterschlagen. Dem Notarzt war es bei beiden nicht gelungen, eine Infusionskanüle in die Vene zu legen. Den Grund hierfür sah ich gleich: Obwohl beide Mädchen gertenschlank waren und die Venen daher eigentlich gut sichtbar sein mussten, war dies eben nicht der Fall, denn sie waren kaum mit Blut gefüllt. Bei beiden Patientinnen war der Puls am Handgelenk nur sehr flach tastbar, und dazu vollkommen unregelmäßig und viel zu langsam. Auch die Blutdruckwerte waren erheblich erniedrigt. Das schaffte ich unmöglich alleine, denn ich konnte unmöglich beide gleichzeitig versorgen. Ich bat den diensthabenden Anästhesisten (Narkosearzt) um Unterstützung.
Laut dem Bericht des Notarztes hatte die erste junge Patientin die Versetzung zum Ende des Schuljahres nicht geschafft, sie war also sitzen geblieben. Die zweite Patientin hatte zwar die Versetzung geschafft, war aber als beste Freundin der Handlungsweise der Sitzenbleiberin gefolgt. Letztere hatte bei ihrer Großmutter auf der Ablage des Badezimmerspiegels über dem Waschbecken ein fast volles Röhrchen mit Herztabletten gefunden. Den Inhalt hätten sie sich geteilt und vor mehreren Stunden mit einem Schluck Bier eingenommen. Sie waren aber keinesfalls alkoholisiert, denn ich konnte keine Alkoholfahne riechen. Das leere Tablettenröhrchen hatte der Notarzt mitgebracht.
Damals wurde dieses Medikament, in der Regel eine Tablette täglich, zur Stärkung des Herzmuskels bei Patienten mit einer Herzmuskelschwäche verordnet. In massiver Überdosierung eingenommen, wie in dem vorliegenden Fall mit mindestens zehn Tabletten bei jeder Patientin, kann es jedoch zu lebensgefährlichen Herzrhythmusstörungen mit Todesfolge führen. Wenn das Medikament einmal ins Blut gelangt ist, wird es leider nur sehr langsam über zehn Tage abgebaut. Die Tabletteneinnahme lag bereits so viele Stunden zurück, dass die Tabletten bereits aus dem Darm resorbiert worden waren und ihre gefährliche Wirkung am Herz entfaltet hatten, wie am Puls der Mädchen unschwer zu erkennen war. Ein Gegenmittel gab es nicht, was bedeutete, dass mir nur die Behandlung der äußerst ernst zu nehmenden Folgeerscheinungen der Vergiftung blieb. Nun klagten die beiden über Schwindel, Benommenheit und Farbensehen, also die bekannten Nebenwirkungen bei einer Überdosierung. Glücklicherweise gehören hierzu auch Übelkeit und Erbrechen, und sie hatten sich zu Hause bereits mehrfach übergeben, wie sie sagten. Immerhin war es ihnen so schlecht gegangen, dass sie noch soeben den Notarzt rufen konnten.
Die aktuelle Situation war nicht dazu geeignet, um sich tiefgreifende Gedanken über die näheren Umstände der unüberlegten Handlungsweise der beiden Schülerinnen zu machen. Das jugendliche Alter der beiden, die grundlose Mittäterschaft der versetzten Schülerin und der Aufenthaltsort in Großmutters Wohnung sprachen für sich. Durch ihre Dummheit hatten sie mich in ernsthafte Bedrängnis gebracht. Wäre die aktuelle Lage nicht so ernst gewesen, dann hätte ich ihnen gerne eine ausführliche Standpauke gehalten. Was blieb also zu tun?
Ich dachte zunächst an eine Magenspülung, ließ den Gedanken aber wieder rasch fallen, denn der Zeitpunkt der Tabletteneinnahme lag viel zu lange zurück, und außerdem hatten sie erbrochen und damit den Magen entleert. Sie erhielten allerdings in Wasser aufgelöste Kohletabletten mit dem Ziel, die Resorption noch im Darm befindlicher Tablettenreste zu verhindern. Als sie die Gläser mit der pechschwarzen Kohleflüssigkeit sahen, verzogen sie simultan das Gesicht. „Runter damit, sonst werdet ihr sterben!“, sagte ich bewusst streng. Damit wussten sie nun endgültig, worum es ging, es ging um ihr Überleben! Wir befanden uns keineswegs in einer Situation, die langwierige Diskussionen und Erklärungen erlaubte, sondern rasches Handeln erforderte. Meine Worte verfehlten jedenfalls nicht ihre Wirkung, und sterben wollten sie offenbar doch nicht. Und wir hatten reichlich Kohletabletten aufgelöst, die kann man nicht überdosieren. Sie hoben die Gläser, hielten sich demonstrativ mit zwei Fingern die Nase zu, schauten sich gegenseitig an und leerten sie gemeinsam mit widerwilliger Miene bis zum letzten Tropfen.
Auf dem Handrücken, am Unterarm und in der Ellenbeuge meiner Patientin war zunächst keine Vene sichtbar, trotz eingehender Stauung mit dem Stauschlauch am Oberarm. Also musste ich die Venen tasten. Am Unterarm fand ich nach längerer Suche endlich eine Vene an typischer Stelle und führte vorsichtig die Infusionskanüle in die Vene. Die Kanüle lag richtig, denn es kam nach Entfernung der Metallkanüle Blut zurück. Auch meinem Kollegen war die Venenpunktion bei dem anderen Mädchen gelungen, und die ersten Infusionen begannen zu tropfen. Über diese Kanülen konnten wir wichtige Medikamente direkt in die Vene verabreichen. Das EKG zeigte bei beiden Patientinnen den identischen Befund, nämlich den für diese Vergiftung typischen abweichenden Verlauf der EKG-Kurve. Der Herzschlag war viel zu langsam, etwa 35 Schläge pro Minute (normale Herzfrequenz 70 bis 80 Schläge pro Minute!), weil die Überleitung der Herzerregung vom linken Herzvorhof in die linke Herzkammer teilweise blockiert war. Bei der höchstgradigen Blockierung hätten sie sofort einen vorübergehenden Herzschrittmacher benötigt, und dies im zarten Alter von 14 Jahren!
Selbstverständlich dachte ich schon wegen der sehr niedrigen Herzschlagfolge über den Herzschrittmacher nach. Dagegen sprachen aber gleich mehrere Gründe: Ich konnte nicht beide Schrittmacher gleichzeitig legen, auch war keine der jungen Patientinnen im gegenwärtigen Zustand transportfähig in eine andere Klinik, die Anlage eines Schrittmachers ist nicht frei von Komplikationen, und eine Verschlimmerung der aktuellen Situation durfte ich mir keinesfalls erlauben. Natürlich stimmte ich mein Vorgehen in jener Nacht mehrfach telefonisch mit dem Chefarzt, der Rufbereitschaftsdienst hatte, ab, und er gab mir volle Rückendeckung für meine Entscheidung gegen die Herzschrittmacher. Für diese Handlungsweise mussten wir uns später zwar einige kritische Worte von Kollegen anderer Abteilungen anhören, unser Vorgehen habe ich aber nie bereut. Natürlich hatten diese Kollegen im Nachhinein gut reden, denn sie waren in der besagten Nacht schließlich nicht anwesend, und sie hatten auch keine sofortige Entscheidung über die Behandlung der lebensgefährlichen Vergiftungen treffen müssen. Dieser sehr schwierige Fall sollte sich später noch sehr schnell in unserer Klinik herumsprechen und einige hohe Wellen schlagen.
Die beiden Patientinnen wurden auf die Station verlegt und an Monitore angeschlossen, die die Herztätigkeit aufzeichneten. Es wurden Alarmgrenzen eingestellt, sodass die Monitore bei Unter- oder Überschreitung der Alarmgrenzen Alarm gaben, zum Beispiel bei einem weiteren Abfallen der Herzfrequenz. Sicherheitshalber hatte ich den Notfallkoffer, der alle Utensilien für eine Wiederbelebung enthielt, in das Zimmer der beiden jungen Patientinnen bringen lassen. Die Zimmertüre wurde offen gelassen, und die Nachtschwestern hatten genau gegenüber ihr Dienstzimmer und damit von dort aus durch die großen Glasscheiben die beiden Patientinnen im Blick. Ich verbrachte eine schlaflose Nacht und hielt praktisch neben ihren Betten eine Sitzwache ab, um auf jede neue Rhythmusstörung sofort reagieren zu können. Der Ernst der Lage war mir durchaus bewusst. In dieser Nacht gab es zum Glück keine anderweitigen Notfälle in der Klinik, so dass ich mich ganz auf die beiden Patientinnen konzentrieren konnte.
Es wurde wirklich ein schwieriges Unterfangen. Da die Herzfrequenz sehr niedrig blieb, versuchte ich mit einem Medikament gegenzusteuern, das in stündlichen Abständen injiziert werden musste. Bei meinen häufigen Kontrollgängen in das Zimmer der beiden Schülerinnen bemerkte ich im weiteren Verlauf eine zunehmende Anzahl von Extraschlägen aus der linken Herzkammer, die vermutlich ebenfalls auf die Tablettenvergiftung zurückzuführen waren. Würden solche Extraschläge in schnellerer Folge oder in ganzen Salven auftreten, so würden sie in einem Kammerflimmern enden. Bei Kammerflimmern mit seinen rasend schnellen, wirkungslosen Zuckungen verliert der Herzmuskel seine Pumpfunktion und fördert kein Blut mehr, und der Patient verliert das Bewußtsein. Dies hätte zu einer sofortigen Elektroschocktherapie mit dem Defibrillator geführt, der in ihrem Zimmer bereitstand. Die Behandlung mit Elektroschocks bei den beiden jungen Schülerinnen galt es auf jeden Fall zu vermeiden, denn ob diese allerletzte Maßnahme erfolgreich enden würde, stand auch noch in den Sternen. Auch gegen diese Extraschläge begann ich also eine medikamentöse Therapie, worauf sich die Anzahl der Extraschläge langsam verringerte.
Im Laufe der nächsten Tage stellte sich bei beiden Schülerinnen eine langsame Stabilisierung der Herztätigkeit ein. Mit jedem neuen Tag konnten wir auch einen weiteren Anstieg der Herzfrequenz beobachten, und die Rhythmusstörungen in Form der Extraschläge waren damit ebenfalls rückläufig. Die Auswirkungen der Tablettenvergiftung ließen endlich nach, es hatte auch lange genug gedauert. Bald konnten wir dann die Überwachung an den Herzmonitoren beenden. In täglichen EKG-Kontrollen normalisierte sich die Kurve der einzelnen Herzschläge wieder. Und je mehr sich die beiden Schülerinnen übrigens von der Tablettenvergiftung erholten, desto leiser wurden auch die kritischen Stimmen einiger Kollegen wegen der nicht erfolgten Schrittmacher-Therapie, bis sie schließlich ganz verstummten.
Natürlich haben wir die beiden Schülerinnen abschließend einer Psychiaterin vorgestellt, die keinerlei Selbstmordgefährdung feststellen konnte. Von einer suizidalen Absicht war ich von Anbeginn auch nicht ausgegangen, wir wollten uns lediglich absichern. Die Einnahme von Großmutters Herztabletten war nur ein sehr unüberlegter, ausgesprochen dummer Streich zweier junger unreifer Mädchen. Vielleicht hatte die Sitzenbleiberin ihre schlechten schulischen Leistungen bis zur Zeugnisausgabe vor ihren Eltern verheimlichen können und Angst gehabt, das Zeugnis den Eltern vorzulegen. Oder sie hatte die Tabletten aus Angst vor einer strengen Bestrafung aus dem Badezimmer der Großmutter genommen.
An die Eltern der beiden Schülerinnen kann ich mich in keiner Weise entsinnen. Ganz sicher waren sie aber in jener Nacht, als ich um das Leben der beiden Schülerinnen kämpfte, nicht anwesend, ebenso wenig wie andere Angehörige. Selbst an den folgenden Tagen der Behandlung ist mir eine Begegnung mit Angehörigen nicht erinnerlich. Vielleicht kam der Besuch erst außerhalb meiner Dienstzeiten, oder es gab doch auch schwierige familiäre Verhältnisse.
In jener Nacht war ich ausschließlich auf die notwendigen therapeutischen Maßnahmen konzentriert, heute aber frage ich mich, wie ich mich wohl gefühlt hätte, wenn die Behandlung kein gutes Ende gefunden hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Schülerinnen ausreichend verständlich machen konnte, wie sehr sie ihr junges Leben durch die Tabletteneinnahme aufs Spiel gesetzt hatten. Ich kann nur hoffen, dass die insgesamt zweiwöchige Klinikbehandlung ein einschneidendes Erlebnis für sie war, das sie für den Rest ihres Lebens nicht mehr vergessen haben. Ich habe es auch nicht vergessen.
Ob sie wohl heute noch beste Freundinnen sind?
8 Ungeklärte Fieberschübe
Nun war ich bereits einige Jahre an diesem Krankenhaus tätig. Ich hatte viel erlebt, gründliches Arbeiten gelernt, die täglichen Herausforderungen wurden langsam zur Routine. Bisweilen konnte es dennoch geschehen, dass man bei einer vermeintlichen Routinearbeit auf den Boden der Wirklichkeit zurückgeholt wurde.
Meine neue Patientin war erst wenige Tage zuvor aus dem Krankenhaus eines Nachbarortes entlassen worden, wo sie zehn Tage lang wegen einer Lungenentzündung behandelt worden war. Kaum zu Hause angekommen, hatte sie nach wenigen Tagen erneut Fieber entwickelt. Der Hausarzt hatte sie darauf in unsere Klinik eingewiesen. Auf das vorherige Krankenhaus war sie aus verständlichen Gründen nicht so gut zu sprechen.
Sie sollte eine sehr geduldige Patientin werden. Sie war vielleicht 55 Jahre alt, groß gewachsen, von schlanker Statur, und dichte, pechschwarze, relativ kurz geschnittene Haare umrahmten ihr blasses Gesicht. Sie war eine höfliche Person, bescheiden, auffallend still, sehr ernst, das Lachen war ihr offenbar vergangen. Sie war bisher immer gesund gewesen, die Mandeln waren vor langer Zeit operiert worden, in relativ jungen Jahren hatte sie einen Herzschrittmacher bekommen, darüber hinaus bot ihre Vorgeschichte keine Auffälligkeiten.