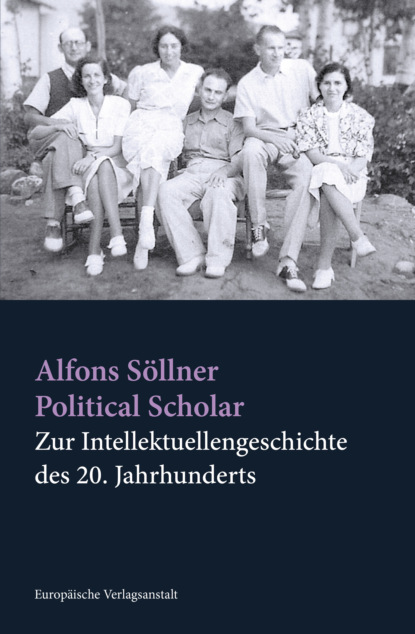- -
- 100%
- +
Paul Klees „Angelologie“
Folgt man der Spur, die Paul Klees „Angelus Novus“ durch Leben und Werk von Walter Benjamin zieht, so ist eine gewisse Verdunkelung, eine schicksalhafte Verwicklung nicht zu übersehen: Die freundlich-ironische Intonation des Anfangs wird Schritt für Schritt überlagert von persönlichen Enttäuschungen und beruflichen Misserfolgen bis hin zur erzwungenen Flucht aus Hitler-Deutschland, den Entbehrungen im Pariser Exil und schließlich dem Endpunkt, wie er tragischer nicht sein konnte: Das Bild, das ihn seit 1921 begleitet hatte, das alle Umzüge miterlebt hatte, musste von seinem Besitzer im Sommer 1940 aus dem Rahmen geschnitten und von Georges Bataille in der Bibliotheque Nationale vor dem Zugriff der Nazis versteckt werden. Und während die mit ihm verwobenen „Geschichtsphilosophischen Thesen“ noch von Benjamin selber auf den Weg in die Freiheit gebracht wurden, nahm sich ihr Verfasser das Leben, kurz bevor er die rettende Grenze nach Spanien hätte überschreiten können. Wenn die Formulierung nicht zynisch klänge, könnte man von einer tragischen Mimesis sprechen, die sich in dieser Beziehungsgeschichte ereignete. Dass sie hochproduktiv war, bedeutet keinerlei Trost: Der „Angelus Novus“ wurde tatsächlich zum Boten des Untergangs.
Gibt es einen Ausweg aus dem Sog, der in dieser Assoziationskette steckt? Er könnte greifbar werden, wenn man den „Angelus Novus“ in den Kontext des originären Schaffensprozesses stellt, aus dem er als Bildkunstwerk hervorgegangen ist. Offensichtlich gibt es eine ganze Reihe von Parallelen zwischen Benjamin und dem Maler und Zeichner Paul Klee – sie reichen von der Prägung durch das bürgerliche Herkunftsmilieu und die Erfahrung von Diskriminierung und Exil über ein mehr oder weniger hintergründiges Interesse an religiösen und theologischen Motiven und kulminieren in einer gemeinsamen Orientierung am Kanon der ästhetischen Moderne, so verschieden sie sich in der professionellen Spezialisierung auch ausgeprägt hat: Bildkunst und Malerei hier, Literatur und Kunstkritik dort. Geht man aber von der Vielfalt der Engelsbilder aus, die Paul Klee im Laufe seines Lebens geschaffen hat, so zeigt das Engelsmotiv im Vergleich zu Benjamin nicht nur eine andere Tendenz, sondern auch ein deutlich anderes Verhältnis zu den christlich-jüdischen Traditionsbeständen.
Von den beinahe 50 Engelsdarstellungen Paul Klees, die eine Kumulation um 1933 und dann noch einmal um 1940 haben40, strahlen zwar etliche eine ebenso düstere Zweideutigkeit aus, wie sie der „Todesengel“, der „Angelus militans“ (beide 1940) oder eben der frühe „Angelus Novus“ zeigen, doch weitaus dominanter und auch häufiger ist der Ausdruck des Witzigen und Ironischen, vielleicht sogar des Komischen und Spöttischen. Das hängt nicht nur mit dem emotionalen Gehalt dieser Darstellungen zusammen, sondern auch mit der Technik, in der die meisten dieser Zeichnungen gearbeitet sind: Viele von ihnen sind in einfachen oder auch ineinander übergehenden Strichen gehalten und ermöglichen so einen raschen und emotionalen Zugang, was durch die knappen und witzigen Titel der Bilder noch befördert wird. Da gibt es den „wachsamen“, den „altklugen“ und den „vergesslichen Engel“, da ziert sich der „Schellen-Engel“ mit dem Glöcklein am Kleidersaum, während man ganz besonders ergriffen wird von dem zarten Wesen mit dem Namen: „es weint“. Klee variiert alle Sorten von Weiblichkeit, zeigt den „bald flüggen“, den „befruchteten“ und den „noch weiblichen Engel“, aber auch das „Engelspaar“, nicht zu vergessen die Serie der „Engel im Werden“: der „Engel-Anwärter“, der „noch tastende“ oder der „zweifelnde Engel“.41
Klees Engelbilder sind vielfältig und einfältig zugleich, sie sind so energisch wie zart, sie bilden einen ganzen Kosmos ab, in dem so gut wie alle menschlichen Stimmungen und Gefühle versammelt sind. Aber das Besondere an ihnen kann man darin vermuten, dass sie zwar in Engelsgestalt daherkommen, d. h. tatsächlich etwas Überirdisches repräsentieren, also „Boten aus einer anderen Welt“ sind, aber sie scheinen nichts „Heiliges“, nichts „Erhabenes“ verkünden zu wollen. Selbst der „heilige Schrecken“, den sie bisweilen auslösen, bewirkt keine Einschüchterung, sondern verliert sich in einem Geheimnis, das eher hell als dunkel ist, jedenfalls irgendwie transparent bleibt, wenn es sich nicht in einer ironischen Brechung auflöst. So sind die „himmlischen Heerscharen“, die Klee – übrigens fast immer als Einzelwesen – in seinen Bildern aufmarschieren lässt, eigentlich nur Botschafter einer freundlichen Menschenkunde, sie zeigen die vielen Gesichter der condition humaine und verzichten absichtsvoll auf den Goldhintergrund der theologischen Tradition und die dazugehörigen Mythologien, um die Freuden wie die Leiden des alltäglichen Lebens erträglich zu machen.
Wenn es bei Paul Klee so etwas gibt wie eine bildkünstlerische „Angelologie“, dann steckt sie in der Form, in der die Engelswelt in die Menschenwelt gleichsam umgemodelt wird: Repräsentiert wird durchaus eine jenseitige Welt, die das Wunderbare, das Heilige, das Messianische zur Geltung bringt, aber weil dem ironischen, dem witzigen oder auch dem rätselhaften Ausdruck der Vortritt gelassen wird, rückt das Überirdische in ein produktives Zwielicht: Ist etwa der Engel, der seine Rolle in der messianischen Geschichtsauffassung zu spielen hat, gar nicht der Überbringer einer bestimmten Botschaft (sei es des Heils oder des Unheils), sondern lediglich Lichtbringer aus irdischer, gemeinmenschlicher Machtvollkommenheit – ein „Aufklärer“, der Licht in eine dunkle Geschichte bringt, während die Botschaft als solche nur vom leibhaftigen Menschen stammen kann, d. h. vom Betrachter oder Interpreten allererst zu stiften ist? Solche Überlegungen sind sicherlich spekulativ, aber sie gewinnen an Wahrscheinlichkeit, wenn man bedenkt, was sich Paul Klee in Voraussicht seines eigenen Todes vom Engel erhofft haben soll:
„Einst werd ich liegen
im Nirgend
bei einem Engel
irgend“ 42
Der junge Leo Löwenthal – Vom neo-orthodoxen Judentum zur aufgeklärten Geschichtsphilosophie
Leo Löwenthal gehört zu den vom Hitler-Regime vertriebenen Gelehrten, die in Deutschland vergleichsweise spät wiederentdeckt wurden. Zwar erkannte man in den 1970er Jahren die paradigmatische Vorläuferrolle seiner literatursoziologischen Aufsätze aus der Zwischenkriegszeit und fand damit einen wichtigen Mentor für eine „neue“, die immanente Interpretation hinter sich lassende Germanistik. Doch blieb Löwenthal auch dann noch im Schatten, als in den 1980er Jahren seine Gesammelten Schriften herausgegeben und jetzt seine wissenschaftlichen Interessen in ganzer Breite sichtbar wurden. Schuld daran war natürlich die übermächtige Präsenz, die Horkheimer und Adorno, den Heroen der „Frankfurter Schule“, bereits im frühen Nachkriegsdeutschland zugefallen war und die sich im Gefolge der Studentenbewegung noch steigerte.
Eine Möglichkeit, diesem Eindruck entgegenzutreten, bestünde in der Nachzeichnung der Entwicklung, die Leo Löwenthal genommen hat, nachdem Horkheimer und Adorno 1949/50 in die Bundesrepublik Deutschland zurückgekehrt waren, er selber aber es vorzog, in den USA zu bleiben. Der durchaus eigene Weg, den er dort beschritt, führte über die praktische Anwendung seiner Kompetenzen als Forscher der Massenkommunikation in der „Voice of America“ auf eine Professur an der University of California in Berkeley. Hier stellte er nicht nur eigenständige Überlegungen über den Zusammenhang von Literatur und Gesellschaft an, sondern publizierte in der ganzen Breite über die Geschichte der bürgerlichen Literatur in Deutschland und Europa. Nicht zu vergessen seine subtile Präsenz in der Formierungsphase der amerikanischen Studentenbewegung und deren kritische Begleitung.
Eine andere Möglichkeit, Leo Löwenthal Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, bestünde in der Darstellung der hintergründigen Rolle, die er als verantwortlicher Redakteur der legendären Zeitschrift für Sozialforschung gespielt hat. Dafür könnte seine reiche Korrespondenz als Zeugnis dienen, von der bislang nur einige wenige Proben publiziert wurden.1 Würde man sie in ihrem ganzen Umfang aus den mittlerweile verfügbaren Archiven heben, so hätte man ein Panorama der Wissenschaftsgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor Augen, eine dezidiert internationale Gelehrtenkorrespondenz, die gegen die nationalistische Verstümmelung durch das Hitler-Regime geführt wurde und sich in den ausführlichen Besprechungsteilen der Zeitschrift für Sozialforschung niedergeschlagen hat. Deren Impresario war Leo Löwenthal.
Ich möchte in diesem Aufsatz einen dritten Weg gehen und mich ganz auf den jungen Leo Löwenthal konzentrieren, d. h. auf eine Epoche, die zeitlich in etwa mit der Weimarer Republik zusammenfällt und einen jüdischen Intellektuellen im Stadium seiner Formierung zeigt. Zwar kommt es ab Mitte der 1920er Jahre schrittweise zur Integration in das Frankfurter Institut für Sozialforschung, das den 1900 geborenen Löwenthal zweifellos stark geprägt, aber eben auch vereinnahmt hat, doch geht dieser Phase eine intellektuelle Entwicklung voraus, die ebenso eigenwillig wie widersprüchlich verlief. Nimmt man weiter an, dass beides – extrem polare Einflüsse und der Versuch ihrer Synthese – von Anfang an zum Profil des jungen Löwenthal gehörte und sich subkutan auch noch fortsetzte, als er 1930 zur rechten Hand des frisch berufenen Direktors Max Horkheimer wurde, dann zeichnet sich die Möglichkeit ab, mittels einer biographischen Studie aus der Frühgeschichte einem Grundmotiv nachzuspüren, das später in der sog. Frankfurter Schule sowohl nachwirkte als auch verdeckt wurde.
„Revolutionärer Radikalismus und jüdischer Messianismus“
„Ich bin ein Rebell gewesen, und alles, was damals intellektuell oppositionell war, also, wie Benjamin sagt, auf der Seite der Verlierer im Weltprozess, das zog mich magisch an. Ich war Sozialist, Anhänger der Psychoanalyse, Anhänger der Phänomenologie in neukantianischen Kreisen, ich nahm eine Stelle an, in der ich mit Ostjuden zu tun hatte, was zum Beispiel meinem und Adornos Vater äußerst peinlich war […]. Es war also eine geradezu synkretistische Ansammlung in meinem Hirn und in meinem Herzen von Bestrebungen, Richtungen und Philosophien, die im Gegensatz zum Bestehenden standen.“2 Was sich im autobiographischen Gespräch mit Helmut Dubiel in der Erinnerung so zusammengefasst findet, hatte indes einen eindeutigen Ausgangspunkt gehabt, was die Familiengeschichte betrifft: die Rebellion des Gymnasiasten gegen den assimilierten, atheistischen, vom traditionellen Judentum völlig abgewandten Vater.
Es ist die dadurch gegebene Konstellation, der Konflikt zwischen einer dezidiert aufklärerischen, d. h. antireligiösen Haltung und „meiner irgendwie politisch motivierten Rückkehr zur jüdischen Tradition“3, der den jungen Löwenthal mehr als alles andere umtreibt und den man als einen hintergründigen Motor für seine Entwicklung weit über die 1920er Jahre hinaus anzunehmen hat. Löwenthals intellektuelle Ursprünge weisen in der Tat nicht wenige Widersprüche auf, deren psychologische Einheit mehr durch das Pathos der Jugendlichkeit und eine zeittypische Rhetorik des Aufbruchs gestiftet war als durch eine fertige Weltanschauung. Man wird also erst einmal die einzelnen Elemente des jugendlichen Suchens für sich zu benennen haben, bevor man den Versuch unternimmt, sie in eine nachvollziehbare Perspektive zu bringen. Dabei wird der springende Punkt in der Frage bestehen, wie Löwenthals politische Erweckung ausgerechnet mit der Rückkehr zur jüdischen Tradition zusammenging, die man vielleicht als neo-orthodox bezeichnen kann.
Durch das höchst instruktive Interview, das Helmut Dubiel mit Leo Löwenthal geführt hat, sind wir in der Lage, die Konfliktsituation eines aufgeweckten jüdischen Studenten zu Anfang der 1920er Jahre relativ konkret zu rekonstruieren. Ihre Details werden durch die mittlerweile aus den Archiven verfügbaren Dokumente recht gut bestätigt: Danach wird Löwenthal schon in seiner kurzen Soldatenzeit von der Revolutionsbegeisterung angesteckt – noch aus seinem ersten Wintersemester in Frankfurt stammt ein flammendes „Bekenntnis zur Revolution“, in dem „die Morgenröte einer neuen Zeit“ mit der „Heiligkeit des sittlichen Pathos’“ begründet und ein „heiliges bundesgleiches Ja, ein offenes Bekenntnis“ gefordert wird.4 Und 1920 stimmt er in einem Brief an die Eltern folgende Totenklage an: „Eisner ist tot, Gustav Landauer ist tot, nun auch Max Weber. […] Zwei Juden und der dritte ein großer Philosemit. Juden als Geistige, als Revolutionäre, als Vorkämpfer, alle gemordet!! Wenn unser Beruf auf Erden es ist, Vorkämpfer zu sein, Künder neuen Geistes, Bahnbrecher der Revolution, so naht der Gedanke, ob nicht unsere Aufgabe schöner und fruchtbarer gelöst würde, wenn wir zusammen zu einer engen Gemeinschaft uns schlössen.“5
Woher stammt dieses Pathos und vor allem, welche politischen Folgerungen werden daraus gezogen? Zwar hatte Löwenthal insofern Ernst mit seinem Bekenntnis gemacht, als er zusammen mit Franz Neumann und Ernst Fraenkel, die später bekanntlich in der Weimarer Gewerkschaftsbewegung Karriere gemacht haben, zu den Gründern einer sozialistischen Studentengruppe in Frankfurt gehörte. Doch steht hinter der Aufforderung zu einem „jüdischen Bund“ ein anderer Einflusskreis, der für den jungen Löwenthal maßgeblicher wurde, nämlich der Zirkel um den Frankfurter Rabbiner Nehemias Anton Nobel. Wenn Löwenthal diesen Zusammenhang retrospektiv durch eine „merkwürdige Mischung aus mystischer Religiosität und philosophischer Eindringlichkeit“ charakterisiert und sich davon auch distanziert, so kann man das auch so verstehen, dass sein politisches Engagement nur sekundär durch eine sozialistische Ideologie getragen war – primär hingegen waren Gedankengänge, wie sie im Nobel-Zirkel gepflegt wurden, und die waren dezidiert aus einer bestimmten Variante der jüdischen Theologie motiviert. Hier dürfte übrigens auch der Grund liegen, weshalb sowohl in der Erinnerung Löwenthals selber wie in den einschlägigen Dokumenten zwischen kommunistischen, sozialistischen, zionistischen und allgemein anti-assimilatorischen Ideen kaum unterschieden wird.
Es ist in der Tat nicht leicht, sich in die Welt des jungen Leo Löwenthal zu Anfang der 1920er Jahre einzufühlen. Mit der Studienwahl der Philosophie stand er quer zum Vater, der sich einen bürgerlichen „professional“, also weder einen brotlosen Intellektuellen noch einen politischen Anwalt für ostjüdische Einwanderer gewünscht hatte. Sein Protest gegen das antireligiöse, assimilierte Elternhaus ging schließlich so weit, dass er eine Tochter aus orthodoxem Hause heiratete und einen koscheren Hausstand gründete. Noch komplizierter stellt sich die Situation dar, wenn man die akademischen Interessen des jungen Löwenthal hinzunimmt: Zwar gab es, vermittelt über die philosophischen Sympathien des Nobel-Kreises, eine Wahlverwandtschaft zum Marburger Neukantianismus und speziell zu Hermann Cohen, auf dessen philosophische Reaktivierung des Judentums noch zurückzukommen sein wird, aber dass er nach Anfangssemestern in Gießen und Frankfurt nach Heidelberg wechselte, ist schwerlich als Interessensbekundung für das zweite Zentrum des Neukantianismus zu bewerten.
Manches spricht sogar für das Gegenteil: Nach Heidelberg zog ihn vermutlich vor allem sein Interesse an der Psychoanalyse, aber auch Golde Ginsburg, die an Frieda Reichmanns „Therapeutikum“ arbeitete und später seine Frau wurde. Und was Löwenthal von seinen Heidelberger Semestern vor allem erinnert, ist der Eklat, den er im Philosophieseminar von Karl Jaspers mit einem intransigenten Vortrag über „Das Dämonische“ auslöste, ebenso wie seine Promotion, mit der er 1923 sein Studium in Frankfurt beendete, weder dem Thema noch der Art seiner Behandlung nach neukantianisch orientiert war. Nimmt man diese beiden Schriften als Grundlage, übrigens die einzigen, die aus der Studienzeit zur Verfügung stehen, so hat man zwar recht disparate Texte zur Hand, immerhin aber gibt es einen gemeinsamen Fokus; und dieser liegt eindeutig in der Richtung einer mehr oder weniger dogmatischen Religionsphilosophie, wenn man einmal in Kauf nimmt, dass mit dieser Bezeichnung ein ziemlich ungesichertes Gelände zwischen Philosophie und Religion markiert ist. Auf der andern Seite hatte gerade dieses Genre in den 1920er Jahren eine gewisse Konjunktur.
Der Test darauf ist der Text „Das Dämonische“, den Löwenthal immerhin als so symptomatisch ansah, dass er ihn in die Gesammelten Schriften aufnahm. Liest man diesen knappen Text mit heutigen Augen, so erscheint er entweder als unverständlich oder aber als rätselhaftes Konglomerat aus alttestamentarischer Vision, hochpathetischer Aktualisierung und metaphysisch überladener Interpretation. Dass er in zwei Abschnitte – „Das Ziel“ und „Der Weg“ – untergliedert ist, deutet immerhin in eine identifizierbare Richtung: auf den Versuch einer Geschichtsphilosophie, die zunächst durch das Tal der „Sündhaftigkeit“ führt, aber dann in einer eschatologischen Vision mehr abbricht als vollendet wird. Dass Karl Jaspers diese pseudo-theologische Überbietung des einschlägigen Kapitels aus seiner kurz vorher publizierten „Psychologie der Weltanschauungen“ nicht goutieren mochte – darüber sollte Löwenthal im Seminar eigentlich referieren –, ist nur zu verständlich.
Nicht weniger deutlich reagierte der etwas ältere Siegfried Kracauer, immerhin der engste Freund des ambitionierten Religionsphilosophen, in einem Brief auf Löwenthals Elaborat. Er zitierte das böse Wort vom „Amoklauf zu Gott“, das Max Scheler angeblich auf Ernst Bloch gemünzt hatte, und umriss damit die apokalyptische Gefühlslage recht genau, aus der dieser „Entwurf einer negativen Religionsphilosophie“ stammte6. Er zeigt Parallelen zum Expressionismus am Ende des Ersten Weltkrieges, der neben seinen literarischen „Eruptionen“ auch eine philosophische Variante hatte – deren erfolgreichstes Exemplar war bekanntlich Ernst Blochs „Geist der Utopie“. Während Bloch sich jedoch vom jüdischen Milieu distanziert hatte, nicht zuletzt durch seinen literarischen Erfolg, verblieb Löwenthals Beschwörungsversuch einer jüdischen Geschichtseschatologie ganz im Bannkreis von Nobel. Dieser unterhielt nämlich auch ganz persönliche und enge Kontakte zu seinen „Jüngern“, kümmerte sich z. B. väterlich um Leo Löwenthal, als dieser wegen einer langwierigen Tuberkuloseerkrankung seine Studien unterbrechen musste.7
So ist es kein Zufall, dass „Das Dämonische“ Ende 1921 in der Festschrift für Rabbi Nobel gedruckt wurde, wobei nicht uninteressant ist, dass dies mit gewissen Einwänden von Franz Rosenzweig verbunden war, der kurz vorher das „Freie Jüdische Lehrhaus“ in Frankfurt gegründet hatte. Wie Rachel Neuberger mittlerweile gezeigt hat, war die „Wiederentdeckung der jüdischen Wurzeln“, wie sie von Rabbiner Nobel propagiert wurde, nicht nur ein weitverzweigter und anspruchsvoller Versuch, alle Fraktionen: orthodoxes und reformiertes, unpolitisches und zionistisches, assimiliertes und östliches Judentum wieder miteinander zu versöhnen.8 Dieses Unternehmen war auch intellektuell, d. h. theologisch wie philosophisch gleichermaßen anspruchsvoll, wodurch die Intention auf eine jüdische Religionsphilosophie sowohl eine programmatische als auch eine gewisse politisch-praktische Dimension erhielt.
Es war dieser synergetische Effekt, der den Kreis um Nobel als eine der treibenden Kräfte für die allgemeine Renaissance des Judentums erscheinen lässt, die für die Weimarer Epoche konstatiert wurde9. Dies manifestierte sich z. B. auch in der Hochachtung, die der Neukantianer Hermann Cohen, gleichzeitig der bedeutendste jüdische Philosoph seit der Jahrhundertwende, gegenüber Nobel an den Tag gelegt hatte. Cohen war 1918 verstorben und hinterließ als sein Vermächtnis das Buch „Die Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums“ (1919). Und als auch Nehemias Nobel Anfang 1922 plötzlich verstarb, waren die zwei wichtigsten intellektuellen Mentoren des jungen Löwenthal verschwunden – und vielleicht erklärt sich u.a. aus diesen menschlichen wie intellektuellen Verlusten die seltsame Wende, die der junge Löwenthal im Jahr 1923 nahm und die gleichzeitig das Ende seines Studiums markiert.
Ausflug in die christliche Religionsphilosophie – Die Dissertation über Franz von Baader
Die Arbeit, mit der Löwenthal im Sommersemester 1923 an der Universität Frankfurt promoviert wurde, war, wie damals üblich, eine rasch geschriebene Dissertation, die – im Nachdruck der Gesammelten Schriften – 70 Seiten umfasst. Aber nicht dies ist erstaunlich, vielmehr überrascht, nach allem, was über seine Interessenslage zu Anfang der 1920er Jahre gesagt wurde, zunächst die Wahl des Themas als solche. Der Titel lautete „Die Sozietätsphilosophie Franz von Baaders. Beispiel und Problem einer ,religiösen Soziologie‘“. Was hat es zu bedeuten, dass ein so stark ins neo-orthodoxe jüdische Milieu zurücktendierender Jungakademiker sich ausgerechnet an Franz von Baader, d. h. einen exponierten Vertreter der politischen Restauration, genauer der katholischen „Gegenrevolution“ im frühen 19. Jahrhundert wandte, um seine einigermaßen „synkretistischen“ Neigungen in eine akademische Form zu bringen? Worin besteht die Kontinuität in diesem offensichtlichen Bruch?
So reizvoll es wäre, bei der Antwort auf diese Frage in psychologische oder psychoanalytische Deutungen auszuweichen – immerhin war Löwenthal mit Erich Fromm befreundet und ging im Heidelberger „Therapeutikum“ ein und aus –, ich werde mich hier ausschließlich an die akademische Form halten, in der diese Arbeit durchgeführt ist und die auf den ersten Blick vor allem durch eine große innere Geschlossenheit beeindruckt. Steht dies in einem gewissen Gegensatz zu dem Sammelsurium aus philosophischen, politischen und religiösen Ideen, die Löwenthal aus seiner Studienzeit erinnert, so erhalten Themenwahl wie die Art ihrer Durchführung doch auch einen erkennbaren Sinn: Franz von Baader erlaubte es Löwenthal offenbar, einerseits bei „seiner“ Motivationslage zu bleiben, nämlich einem religiös gebundenen Philosophieren, sie andererseits aber in eine Form zu bringen, die akademisch passabel und „bürgerlich“ renommierfähig war, aber auch auf eine politische Perspektive nicht verzichtete.
Ich möchte diese anspruchs- oder auch widerspruchsvolle Konstellation zunächst daran erläutern, wie Löwenthal seine Fragestellung begründet und dabei erkennen lässt, dass er sich der Alternativen durchaus bewusst ist, vor denen eine Zusammenführung von Religion und Soziologie zu stehen kommt: Systematisch kann die Religion entweder als Gegenstand der Soziologie oder die Soziologie als Teil der Theologie behandelt werden – das erstere führt zur „Religionssoziologie“ á la Max Weber, die indes sofort durch ihre „Eindimensionalität“ charakterisiert und als „irreligiöse Soziologie“ abgewertet wird, wodurch für Löwenthal der Umkehrschluss evident ist, mit dem er ganz auf die Linie Franz von Baaders einschwenkt. Die Soziologie sei, wie die Menschenwelt insgesamt, in letzter Instanz nur aus den Prämissen der Theologie abzuleiten. Und diesen zweiten Standpunkt einer „religiösen Soziologie“ macht Löwenthal sich nun zu eigen: „Die Beziehungen, in die der Mensch zum Menschen tritt, und die Bedingungen, unter denen er dies vermag und ausführt, leiten sich ab von einer höchsten unbedingten Bedingung: von Gott.“10
Interessant ist, wie diese systematische Entscheidung in demselben Atemzug durch eine historische Ortsbestimmung untermauert wird: Noch schärfer als von der Religionssoziologie grenzt sich Löwenthal ab von der in den 1920er Jahren blühenden neo-romantischen Gesellschaftslehre und deren „Restauration des Mittelalters“, die er mit Baader genauso geißelt, wie er die „Ideologisierung der Reaktion“ durch die „bourbonische Restauration“11 ablehnt. Weniger scharf, aber dennoch eindeutig fällt die Abgrenzung von Kant und seiner Denkschule aus. Löwenthal übernimmt hier einfach die von Baader selbst vorgetragenen Invektiven gegen die „unzulässigen und zu unhaltbaren Konsequenzen und Antinomien hinführende Voraussetzung einer selbstherrlichen menschlichen Vernunft“. Eindeutig schließlich auch die Abwehr der politischen Revolution: „Die Autonomie musste […] zur Anomie, zur Gesetzlosigkeit führen.“ 12
All diese Argumente laufen darauf hinaus, Franz von Baader nicht nur eine singuläre Stellung in der modernen Geistesgeschichte zuzuschreiben, sondern die rein immanente Deduktion als die einzig adäquate Methode herauszustellen, eine „religiöse Soziologie“ zu begründen. Auf dieses dogmatische Verfahren ist Löwenthal selber dezidiert festgelegt, auf das „rechte Nachdenken Baaders von oben, von der theologischen Spitze nach unten“ – oder, wie das Resümee des ersten Kapitels lautet: „auf die Grundlegung der Erkenntnis und ihrer Theorie in der Theologie“.13 Daraus resultiert der Aufbau der gesamten Arbeit, die folgerichtig vom theologischen System Baaders ausgeht (Kapitel 2), einen Zwischenschritt in der „religiösen Psychologie“ macht (Kapitel 3), um dann die eigentliche „Sozietätsphilosophie“ (4. Kapitel) anzuvisieren. Wenn dies der Gedankengang der Arbeit im Großen ist, so bleibt zu fragen, warum sich Löwenthal aus der Finalisierung auf diesen letzten Teil hin – auf Geschichte und Gesellschaft – so etwas verspricht, wie ein Umschlagen der dogmatischen Deduktion in eine kritische Perspektive; denn genau dies scheint es zu sein, was sich Löwenthal von der Baader-Studie verspricht, wenngleich es nur subkutan oder zwischen den Zeilen zu spüren ist.