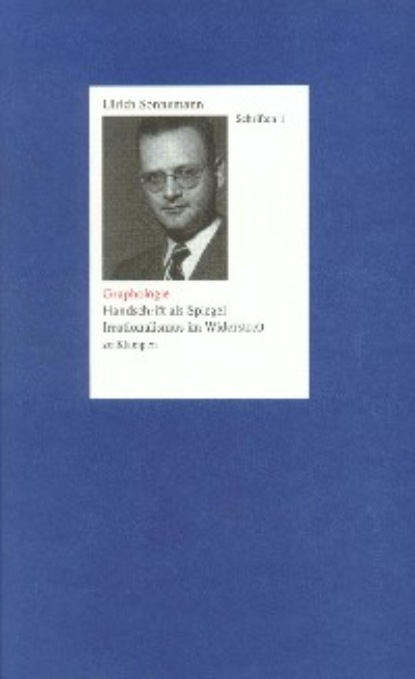- -
- 100%
- +
Auch wenn die wissenschaftliche Graphologie ihre Existenz ohne Frage Klages verdankt, so ist er doch selbst einer Reihe von Vorgängern verpflichtet, die um nahezu fünfzig Jahre ins neunzehnte Jahrhundert zurückreicht. Abgesehen von vereinzelten Andeutungen wie spontanen Beschreibungen von Handschriften zur Charakterisierung einer bestimmten Persönlichkeit, die sich durch alle Jahrhunderte und Nationalliteraturen verstreut finden, entstand die Graphologie als systematische Forschungsrichtung, als Jean-Hippolyte Michon 1875 sein ›Système de Graphologie‹ veröffentlichte, das Ergebnis einer jahrzehntelangen vergleichenden Forschung, die auf Briefen, die Michon erhalten hatte, und auf seiner Bekanntschaft mit den Briefschreibern beruhte.
Was Michon – und nach ihm sein systematischer arbeitender, aber weniger talentierter Schüler Jules Crépieux-Jamin – begründeten, war die sogenannte Graphologie der Zeichen, die nach der Zeit dieser beiden Franzosen zu jener Art Graphologie degenerierte, wie sie noch heute von vielen Amateuren und Scharlatanen in diesem Bereich praktiziert wird, obwohl man auch sagen könnte, daß der typische amateurhafte Ansatz gegenwärtig eher noch eine inkonsistente Vermischung der »Graphologie der Zeichen« mit dem in diesem Kapitel beschriebenen völlig unsystematischen Zugriff auf die Handschrift geworden zu sein scheint. Für Michon repräsentieren bestimmte isolierte Haken, Schleifen, Überschneidungen usw. bestimmte Charaktereigenschaften, und der Charakter selbst galt ihm als die Summe dieser Eigenschaften. Dank seiner bemerkenswerten persönlichen Beobachtungs- und Kombinationskraft sind Michons Entdeckungen keineswegs unterzubewerten, sein »système« aber erwies sich, nachdem es ihm einmal aus den Händen genommen war, als dermaßen inadäquat, daß es jenes allgemeine Urteil hervorrief, das die psychologische Untersuchung der Handschrift als zwangsläufig unwissenschaftlich abwertete – eine Ansicht, die sich in diesem Land im Grundsatz bis heute erhalten hat. Ihre wesentlich frühere Überwindung in Europa verdankte sich sowohl der enormen Verfeinerungs- und Systematisierungsarbeit, die die führenden Experten in diesem Feld vollbracht hatten, als auch den neuen Denkschulen, die in Europa etwa zur Zeit des Ersten Weltkriegs eine führende Rolle in der akademischen Psychologie selbst erlangten.
Von Michons Entdeckungen angeregt, fand diese Entwicklung in erster Linie in Deutschland statt, wo Wilhelm Langenbruch, Hans H. Busse, Albrecht Erlenmeyer und Wilhelm Preyer zu ihren einflußreichsten Beförderern wurden. Preyers ›Psychologie des Schreibens‹ von 1895 stellte, seinem Titel zum Trotz, noch keinen Fortschritt der psychologischen Begriffe dar, unternahm aber zum ersten Mal eine methodische Analyse der Eigenschaften und Bestandteile der graphischen Bewegung. Von da an und angeregt durch graphologische Periodika, die in Deutschland gegründet wurden, beschleunigte sich die Entwicklung. Georg Meyers ›Die wissenschaftlichen Grundlagen der Graphologie‹, wie die meisten hier genannten Werke nie ins Englische übersetzt, war die erste Annäherung an die Handschriftenanalyse durch einen professionellen Psychologen. Meyers Buch ist extrem konservativ und befaßt sich mehr damit, die theoretische Möglichkeit zu demonstrieren, eine wissenschaftliche Graphologie zu entwickeln, als daß es das wirklich täte; es überwindet die naive Spezifizität von Michons Interpretationen, ersetzt sie durch allgemeinere Begriffe, versäumt es dann aber, den Weg zu jener kritischen Eigenheit zu zeigen, die nach ihm von dem Philosophen und Psychologen Ludwig Klages erreicht wurde.
Alle heutige Graphologie mit irgendeinem Anspruch, als psychologisches Instrument zu dienen, verdankt sich Klages, der als erster eine allgemeine Theorie des Ausdrucks formuliert hat. Seine wesentlichen graphologischen Werke –›Die Probleme der Graphologie‹, 1910, ›Handschrift und Charakter‹ (das bedeutendste), 1917, ›Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft‹, 1923, ›Prinzipien der Charakterkunde‹, 1928, und ›Graphologisches Lesebuch‹, 1930 – regten nicht nur viele professionelle Psychologen zur Handschriftenforschung an, sondern erwirkten auch die Hochschulwürde für die Graphologie und veranlaßten Schulen, Krankenhäuser, Beratungsbüros, Geschäftsbetriebe und Gerichte, für ihre unterschiedlichen Zwecke graphologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Neben Klages wurde das meiste an herausragenderer moderner Arbeit geleistet von Robert Saudek, dessen Werke, mit Ausnahme einer Abhandlung über die amerikanische Handschrift, ins Englische übersetzt wurden; von Max Pulver –›Symbolik der Handschrift‹, 1931, ›Trieb und Verbrechen in der Handschrift‹, 1934, beide unübersetzt –, der Begriffe analytischer Herkunft in das Feld einführte; von Minna Becker, die 1926 ein exzellentes Buch über Kinderhandschrift schrieb; von Roda Wieser, die ebenfalls über die graphischen Erzeugnisse von Kriminellen geschrieben hat; und von Johannes Walther, der sich insbesondere in der Analyse der Bindungsformen hervortat. Hierzulande haben Joseph Zubins und Thea Stein-Lewinsons Monographie, die die statistische Analyse einzelner graphischer Züge, wie sie zuvor in diesem Kapitel erwähnt wurden, entwarf, und Werner Wolffs mehr analytisch beeinflußte Arbeiten auf unterschiedliche Weise die von Klages’ Schule gelieferten Vorgaben aufgenommen.
Heute noch zieht sich der Einfluß von Klages’ Schule durch den gesamten Bereich graphologischer Arbeit und Forschung. Zu einem beträchtlichen Teil dürfte dies nicht nur den meisten hier genannten Arbeiten als Verdienst angerechnet werden, sondern zugleich auch deren Unzulänglichkeiten erklären. Der wachsende Einfluß, den die Gestalt-Schule in den letzten zwanzig Jahren auf die europäische Psychologie ausgeübt hat, ebnete den Weg für eine verständige Aufnahme der Graphologie auf seiten von Colleges und Universitäten, aber obwohl er dieser Schule in manchen Aspekten seines Denkens sehr nahestand, war Klages ihr in anderen doch zu fern, um seine Theorie über gewisse Grenzen hinaus zu entwickeln. Diese Grenzen, die hauptsächlich aus seiner – hoch dogmatischen – philosophischen Theorie des Bewußtseins als notwendig störendem Faktor im Zusammenspiel der Lebenskräfte im Menschen herrührten, führten zu einer Vereinfachung seines Begriffs des graphischen Rhythmus’, der zu grob war, ihn die grundlegende Differenz zwischen integrierten und desintegrierten Zuständen der Persönlichkeit als in der Handschrift reflektiert verstehen zu lassen. Sein graphologisches System erwies sich in der Konsequenz als für psychodiagnostische Zwecke derart unzureichend, daß es eine Revision einiger seiner entscheidendsten – zugleich aber verzerrtesten – Begriffe durch den Verfasser erforderte. Im vorliegenden Buch ist diese Revision im Kapitel über Rhythmus und Regelmaß, Integration und Fluktuation formuliert. Zur Anwendung kommt sie sowohl im systematischen Teil, der es unternimmt, die Struktur der Bewertungsebenen neu aufzubauen, als auch in den klinischen Kapiteln, die, auch wenn sie nur vorläufige Befunde vorlegen, die Früchte langjähriger Beobachtung und Erfahrung auf diesem Gebiet sind.
Die Probleme der Persönlichkeitspsychologie
und die Theorie der Ausdrucksbewegung
Die Bedeutung aller Ausdrucksbewegungen als relevanter Charakterindikatoren wurde schon zuvor in unserer Diskussion berührt. Hinsichtlich einiger seiner spezifischen Aspekte impliziert das Konzept der »Isomorphismen« oder Analogien von Systemeigenschaften die Existenz gesetzmäßiger, bedeutungsvoller und notwendiger Verbindungen zwischen der psychologischen Verfaßtheit einer Person und ihren Formen des Verhaltens; diese Verbindungen schienen den Verhaltensformen eine morphologische und ästhetische Einheit zuzuschreiben, recht ähnlich nicht nur der Formeinheit in individuellen Organismen, sondern auch denen des »Stils« in künstlerischen Schöpfungen, der Denk- und Kultur-»Muster« in sozialen und ethnologischen Entitäten und vieler anderer auf diese Bereiche bezogener »physiognomischer« Phänomene. Persönlichkeit fungiert diesem Konzept zufolge als ein konfiguratives Ganzes, das in der Dimension der Zeit ausgedehnt ist, innerhalb dessen aber die Teile in erster Linie nicht durch ihre Abfolge in der Zeit bestimmt sind (kausative Determination) und auch nicht durch irgendwelche anderen unmittelbar wechselseitigen Beziehungen zwischen zweien von ihnen; ebensowenig gibt es das kontinuierliche Wirken eines zugrundeliegenden gemeinsamen Prinzips der Systemaktivität, auf das die individuellen Verhaltenstatbestände (in ihren physiologischen wie psychologischen Aspekten) zurückgeführt werden können und, um verstanden zu werden, auch müssen. Ein Prinzip der Systemaktivität wie jenes, das den organismischen Gesamtprozeß regelt, ist nicht die Gesamtmenge mehrerer Zwei-Faktoren-Beziehungen, sondern stellt eine grundsätzlich andere logische Kategorie dar: In Zwei-Faktoren-Beziehungen und ihren Aggregaten sind die Relata, und zwar beide, unabhängig von der Dimension ihrer Verteilung; in Systemen dagegen sind die Komponenten stets das, was immer ihre Position im System sie zu sein bestimmt; ihre Verteilungsdimension wird somit selbst konstitutiv für das System. Zwei-Faktoren-Beziehungen und ihre Aggregate kommen zwar in der Tätigkeit des Organischen vor, sie betreffen jedoch nie den gesamten Organismus; vielmehr müssen sie als besondere und äußerst vereinfachte Manifestationen eines Prinzips von Systemaktivität verstanden werden, das relativ unabhängig von demjenigen ist, das den organismischen Gesamtprozeß regiert und das sich auf seine zeitliche Dimension beschränkt. Betrachtet man diesen Prozeß als ganzen und folgt man Andras Angyal (›Foundations for a Science of Personality‹), der wesentlich an der Entwicklung dieser Kategorien beteiligt war, lassen sich drei Hauptdimensionen des Funktionierens der Persönlichkeit unterscheiden.
1. Eine Fortschrittsdimension, in der Persönlichkeitsfunktionen nach dem Gesetz der Finalität, das ihrer zeitlichen Ordnung in der bewußten Verfolgung von Zielen zugrunde liegt, bestimmt sind.
2. Eine Tiefendimension, in der Persönlichkeitsfunktionen nach den unbewußten Bedürfnissen des Organismus, denen sie entsprechen, bestimmt sind.
3. Eine transversale Dimension, in der Persönlichkeitsfunktionen nach der Ordnung ihrer wechselseitigen Koordinierung bestimmt sind.
Im Bereich der Ausdrucksbewegungen wird die Fortschrittsdimension durch das Maß an Aufwands- und Richtungskonsistenz repräsentiert; die Tiefendimension durch das Maß an Impulsentbindung; die transversale Dimension durch das Maß an rhythmischer Integration. Sowohl Impulsentbindung als auch rhythmische Integration sind Funktionen, deren Operationen dazu neigen, der bewußten Kontrolle der Person zu entgleiten; Aufwands- und Richtungskonsistenz tun dies in geringerem Maße, können aber nur auf Kosten von Impulsentbindung und rhythmischer Integration bewußt manipuliert werden, eine Tatsache, die einen einfachen Nachweis solcher Manipulationen gestattet. Ausdrucksbewegungen sind, in anderen Worten, umso aussagekräftiger und tatsächlich ausdrucksvoller, je weniger sich ein Individuum ihrer Ausdrucksqualitäten bei der Ausführung bewußt ist. Vor allem aus diesem Grund ist die Handschrift ein System von Ausdrucksbewegungen von besonderem psychologischem Wert: Zwar ist der Schreiber der von ihm verwendeten Schulschrift-Muster durchaus gewahr und konzentriert sich bewußt auf den Inhalt, den er mit seinem Schreiben vermitteln will, kaum jedoch ist er der Art und Weise inne, in der er das Muster individuell verändert, und im allgemeinen überhaupt nicht, was solche Veränderungen bedeuten mögen. Wie dunkel sein Bewußtsein von »seiner« Handschrift ohnehin sein mag, es schwindet in dem Maße, wie die Inhalte seines Schreibens seine Gedanken in Anspruch nehmen und seine emotionalen Impulse hervorrufen und absorbieren.
Diese besondere Natur der Bewegungsimpulse postuliert allem Anschein nach eines der fundamentalsten Gesetze des Ausdrucks: Ihre »zwingende« Kraft hinsichtlich sowohl der Wucht als auch der Richtungskonsistenz steigt und sinkt reziprok zur introspektiven Aufmerksamkeit, die das Bewußtsein des Schreibers – das im Maß dieser Aufmerksamkeit von seinen äußeren Absichten unabsorbiert bleibt – diesen zuwendet und damit von seinen eigentlichen – spontaneitätsweckenden – Zielen ablenkt. Das ist der Grund, warum unter den verschiedenen Typen von Handschriftenproben Briefe und Manuskripte gegenüber Abschriften vorgegebener Texte und – mehr noch – gegenüber jeglichen im Bewußtsein einer darauffolgenden graphologischen Auswertung produzierten Proben für die psychologische Analyse generell vorzuziehen sind.
Hinsichtlich der in Ausdrucksbewegungen spontan angestrebten Ziele sollte wiederum das Ausdrucksziel, dessen der Organismus, was das Ausmaß der Bestrebung angeht, nicht gewahr ist, vom bewußten Zweck der Bewegung unterschieden werden. Bei der Handschrift ist dieser bewußte Zweck durch die Aufgabe determiniert, bestimmte Briefe, Wörter, Sätze und ganze Texte graphisch auszuführen; das Ausdrucksziel hingegen durch die innere Erfahrung des Schreibenden bei der Ausführung dieser Aufgabe. Daraus folgt, daß in Ausdrucksbewegungen im Sinne der gesamten organismischen Erfahrung offenbar Ziele der folgenden zwei allgemeinen Kategorien gleichzeitig wirksam sind: Erstens das zweckhafte Ziel der Bewegung, das den Verhaltensaspekt in der Fortschrittsdimension der Persönlichkeit bestimmt; zweitens das ausdruckshafte Ziel der Bewegung, das den Verhaltensaspekt in der Tiefendimension der Persönlichkeit bestimmt.
Zusätzlich kann durch die von der Umlenkung bewußter Aufmerksamkeit auf das Selbst bewirkte Impulshemmung eine dritte, nur potentiell wirksame, allgemeine Kategorie des Strebens erzeugt werden. In Übereinstimmung mit dem oben aufgestellten Ausdrucksgesetz scheint sie aus einem Konflikt zwischen dem zweckhaften und dem ausdruckshaften Ziel der Handlung zu resultieren und das Funktionieren der Persönlichkeit in der transversalen Dimension, der der Koordination, zu beeinflussen.
Um die Dichotomie von zweckhaften und ausdruckshaften Zielen zu illustrieren, können Alltagsbeispiele von Bewegungen von Nutzen sein, die stark von einem der beiden auf Kosten des anderen geprägt sind. Die hoch mechanisierten Bewegungen eines an einem Fließband beschäftigten Arbeiters sind durch zweckhafte Ziele in einem Ausmaß bestimmt, das ihre ausdruckshafte Zielgerichtetheit sicherlich vernachlässigbar, wenn auch keineswegs nichtexistent macht; die spontane Schreckgeste, mit der er von seinem Gesicht eine Gefahr abwehrt, die gar nicht seiner Person droht, mit der er vielmehr auf den Anblick eines Unfalls reagiert, der einem anderen, entfernter Arbeitenden zustößt, ist durch seine innere Erfahrung in einem Ausmaß bestimmt, das wiederum die zweckhafte Zielgerichtetheit der Geste zumindest vernachlässigbar macht.
Während sich in beiden Fällen in extremem Maße die Vorherrschaft einer Art von Zielgerichtetheit findet, sind die meisten alltäglichen Handlungen hinsichtlich der zweck- und ausdruckshaften Ziele, denen sie dienen, weit ausgeglichener. Dazu stimmt, daß einer der größten praktischen Vorteile, den die graphische Bewegung der psychologischen Analyse bietet, in ihrer kombinierten und ziemlich gleichen Empfänglichkeit für Ziele beider allgemeinen Kategorien besteht. Über ihre relativ enge Analogie mit der vorherrschenden Struktur der meisten Lebenssituationen hinaus scheint dies auch eine reichliche und wohlgeordnete Versorgung mit psychologischen Indikatoren zu erleichtern. Im Unterschied zu anderen Ausdrucksbewegungen bietet die Handschrift dem Beobachter eine fixierte Aufzeichnung, eine praktische und leicht verfügbare Spur solcher Bewegungen, während z. B. eine Untersuchung des Ganges, um systematisch durchgeführt werden zu können, ziemlich aufwendige Filmaufzeichnungen erforderte.
Wie objektiv ist die Graphologie?
Jede Wissenschaft, ohne Ansehen ihres jeweiligen Gegenstandes, hat sich ursprünglich auf der Grundlage einer Systematisierung alltäglichen empirischen Wissens entwickelt. Die graphologische Methode, die auf einem besonderen Gebiet die gewohnte menschliche Tätigkeit des Erkennens, Klassifizierens und Interpretierens von Verhalten betreibt, bildet von dieser Regel keine Ausnahme. Der graphologische Laie wird kaum das Gefühl haben, sich eine Blöße zu geben, wenn er eine extrem unordentliche Handschrift unordentlich nennt oder eine extrem regelmäßige ordentlich, aber er wird dazu neigen, alle weiterreichenden Feststellungen spekulativ zu nennen, und so legt er kritiklos die Grenzen seiner eigenen Sensibilität für ausdrucksmäßige Eigenschaften als Scheidelinie zwischen Objektivität und Subjektivität fest.
Nun erklärt diese Haltung zwar die Häufigkeit, mit der die Graphologie des »Subjektivismus« bezichtigt wurde, sie beantwortet aber nicht die Frage, wie »gültig« die graphologische Methode tatsächlich ist; und oft wurde der Vorwurf laut, daß die Graphologen sich der Aufgabe der Objektivierung einfach nicht in ausreichendem Maße stellen. Angesichts dieser Kritik mag es nützlich sein, auf die schon geleistete Validierungsarbeit ein- und der Frage nachzugehen, wie Versuchsanordnungen für die weitere Validierung und Gruppenuntersuchungen aufgebaut sein sollten, um aussagekräftig zu sein. Hierzulande wird von Gegnern der Methode immer wieder auf den 1919 von Clark L. Hull und Robert B. Montgomery durchgeführten Versuch verwiesen, der in einem Desaster endete (wenn nicht für die Graphologie, so doch für das, was immer in diesem Versuch auf die Probe gestellt wurde). Er war indes unwissenschaftlich gleichermaßen aus Sicht der Graphologie wie der Experimentaltheorie. Die von Hull und Montgomery getestete Methode befaßte sich mit den Auf- und Abwärtsorientierungen der Wörter, den Weiten der kleinen ms und ns und den Längen von t-Balken, die alle als potentiell korrespondierend mit bestimmten Charakterzügen und deren individuellen Variationen eingeschätzt wurden, das aber war noch Michons Graphologie der Zeichen, die zu dieser Zeit, achtzehn Jahre nach der Veröffentlichung von Meyers Arbeit und, je nachdem, neun bzw. zwei nach Klages’ ersten Veröffentlichungen, längst überholt war. Die Versuchsanordnung bestand, objektiv nicht weniger fragwürdig, aus einer Collegeverbindung, einer engverstrickten Gemeinschaft von Studenten, zum größten Teil homogen nach Anschauungen, Herkunft und Wertvorstellungen, alle ungeübt in der Rolle, die sie in diesem Versuch zu spielen hatten und die darin bestand, gegenseitig ihre Charaktere hinsichtlich einiger jener Züge zu bewerten, von denen angenommen wurde, daß sie mit den von Hull und Montgomery ausgewählten und quantitativ gemessenen graphischen Kennzeichen (und zwar jeweils ein Zug mit einer Eigenheit der Handschrift) korrespondierten. Graphologischer- wie experimentellerseits inadäquat, konnte von dem Unternehmen nicht erwartet werden, irgend bedeutsamere Ergebnisse zu zeitigen, als die Methode es war, mit der es sich seinen Gegenständen näherte.
In Europa wurden häufiger Einzelversuche in blinder graphologischer Diagnose durchgeführt, bei denen erfahrene Anwender aus den Schulen von Klages, Pulver und Saudek getestet wurden. Die Ergebnisse entsprachen in der überwiegenden Zahl der Fälle – und vervollständigten sie in vielen – den verfügbaren sozialen und klinischen Belegen in so hohem Maße, daß die ursprüngliche Skepsis der Forscher im Hinblick zumindest auf die Validität, wenn nicht sogar die Zuverlässigkeit der Methode stark gemindert wurde; man stellte fest, daß sich bei Versuchen mit handschriftlichen Kopien standardisierter Texte, zu denen allein Alter und Geschlecht der Schreibenden angegeben wurde, auf der Basis reinen Zufalls eine unbegrenzte Anzahl möglicher Persönlichkeitsbeschreibungen ergeben konnte; und daß folglich hoch spezifische Persönlichkeitsbeschreibungen, die, gerade in ihrer Spezifizierung, mit dem sozialen und klinischen Bild übereinstimmten und zu denen verschiedene Anwender mit dem gleichen methodischen Ansatz unabhängig voneinander gelangt waren, keinen Zweifel an der Validität dieser Methode lassen konnten. Allerdings stellte man, als die Methode sich weiterentwickelte, auch die Notwendigkeit fest, einen angemessenen Grad an Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und so kam es zu den vielen Objektivierungsexperimenten, die in Deutschland zum größten Teil von den Instituten für Industrielle Psychotechnik durchgeführt und hierzulande von Gordon W. Allport und Philip E. Vernon in ihrem Buch über Ausdrucksbewegungen dargestellt wurden. Das experimentelle Setting lieferten hier in den meisten Fällen die Arbeitsbewertungen einzelner Angestellter gemäß der Beurteilung ihrer Arbeitgeber auf der einen Seite und graphologische Bewertungen ihrer entsprechenden Eigenschaften (wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit) auf der anderen. Die durch die Verwendung von Punkteskalen erreichten Korrelationen lagen alle weit oberhalb bloßen Zufalls, und zwar am auffälligsten bei denjenigen Versuchen, die graphologische Bewertungen von Robert Saudek, Richard Couvé, Gertrud von Kügelgen und besonders Kurt Seesemann einbezogen, dessen graphologische Angestelltenbewertungen eine dreiundneunzigprozentige Übereinstimmung mit den Beurteilungen der Arbeitgeber zeigten.
Erfolgreiche Objektivierungsexperimente hinsichtlich der Graphologie waren aber keineswegs auf Europa beschränkt. Erwähnt werden sollte hier Ruth L. Munroes ›Three Diagnostic Methods Applied to Sally‹ und ›A Comparison of Three Projective Methods‹ (letzteres gemeinsam mit Thea Stein-Lewinson und Trude Schmidl-Waehner), die mit sehr ermutigenden Ergebnissen vergleichende Untersuchungen von »blinden« Persönlichkeitsbeschreibungen unternahmen, die, unabhängig voneinander, auf der Rorschach-Methode, Schmidl-Waehners Kunsttechnik und der Graphologie beruhten.
Obwohl alle diese Ergebnisse eher als erste Schritte auf dem Weg hin zu einer umfassenden Objektivierung der Methoden denn als schlüssige Beweise ihrer Zuverlässigkeit angesehen werden können, erscheinen sie doch als höchst ermutigend, wenn man die Komplexität nicht so sehr der Methode selbst als ihres Gegenstandes, der Persönlichkeit, in Betracht zieht. Das grundsätzliche Problem der Gewinnung objektiver Kriterien, anhand derer Persönlichkeitsbeschreibungen – auf der Basis der Graphologie ebenso wie jeder anderen Technik – aussagekräftig überprüft werden können, wird noch verwickelter, wenn wir die relativ einfache Situation, die die für Punkteskalen geeigneten Persönlichkeitsbewertungen auf bestimmte Züge sozialen Funktionierens hin darstellen, hinter uns lassen und auf das klinisch weit interessantere Feld graphologisch gewonnener umfassender Persönlichkeitsbeurteilungen vorrücken. Um einen korrekten Bezugsrahmen für die Objektivierung solcher Beurteilungen aufzustellen, müssen wir zuerst wissen, welche allgemeine Ordnung von Phänomenen sie beschreiben, da nur dieses Wissen uns in die Lage versetzen wird, nach der korrespondierenden Ordnung von Phänomenen in der Realität zu suchen.
Im Vorfeld der systematischen Analyse, der die Schriftprobe in den verschiedenen Bewertungsdimensionen unterzogen wird, konzentriert der Gutachter sich auf die Probe als ganze, eliminiert ihren Inhalt gänzlich aus dem Beobachtungsfeld und läßt das letztere zu einem Muster von Bewegungsspuren werden. In der passiven und doch aufmerksamen visuellen Erfahrung dieses Musters spielen die spezifischen sozialen Funktionen des Schreibens für den Beobachter keine Rolle mehr, und jegliche intellektuelle Aktivität auf seiner Seite ist noch ausgeschaltet. In dieser Phase der Untersuchung und kraft ihrer kann der Gutachter nicht nur einen Gesamteindruck der Probe gewinnen, sondern auch zulassen, daß einzelne oder wiederkehrende Eigenschaften derselben seine Aufmerksamkeit erregen; und genau dieser ganzheitliche Blickwinkel wird in der Untersuchung noch einmal am Ende eingenommen, wo er zur Wiederherstellung eines eigentlichen Gesamtbezugsrahmens dient, in den die verschiedenen Beobachtungsdaten eingefügt werden können, der ihre relative charakterologische Bedeutung – ihre »Position« im Persönlichkeitssystem – bestimmt und der im Prozeß der Konzentration auf einzelne graphische Details und Bewertungsbereiche verloren gegangen sein kann. Das hierbei angegangene Phänomen ist ersichtlicherweise nicht der eine oder andere »Zug«, sondern Persönlichkeit als eine funktionale Einheit; also kann nur die Persönlichkeit als funktionale Einheit das eigentliche objektive Kriterium sein, an dem graphologische Befunde zu messen sind. Das schließt nicht die graphologische Untersuchung der Persönlichkeit hinsichtlich spezifischer Linien des sozialen Funktionierens aus (die oben zitierten europäischen Versuche konzentrierten sich alle auf Untersuchungen dieses Typus’), wohl aber jegliches direkte und isolierte graphologische Urteil zu einzelnen »Zügen«: Urteile dieser Art müssen aus der ganzen Persönlichkeitsstruktur erschlossen und dürfen nicht auf isolierten und außerhalb ihres gegebenen Gefüges interpretierten Eigenschaften der Handschrift begründet werden.