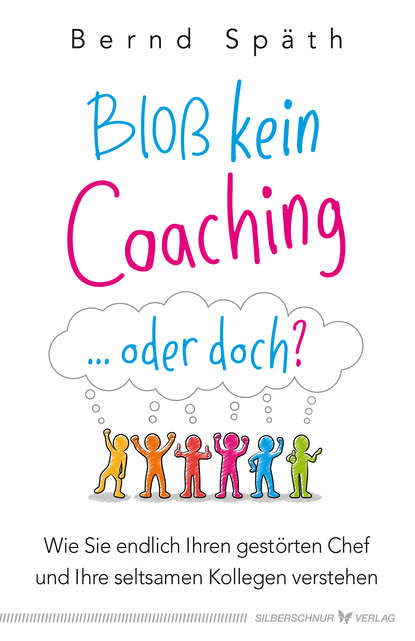- -
- 100%
- +
Und in Margot, einer Koblenzer Juristin, findet er dann seine Meisterin. Erst betreiben die beiden eine lebhafte und wilde Affäre, und Eric schwärmt mir von Margots außerjuristischen Qualitäten vor. Dann leiht Margot ihm ein paar tausend Euro. Kurz darauf allerdings findet sie, während Eric sich in ihrem Bad frisch macht, ein zärtliches Brieflein von Steffi in seiner Sakkotasche und holt ihn sich gleich mal aus dem Bad. Und nun ist sogar Erics Repertoire an Lügen und Ausflüchten erschöpft, sie wirft ihn hochkant hinaus.
»Macht nix«, verkündet er frei von allen Selbstzweifeln. »Findet sich immer was Neues.«
Aber schon als er das Geld nicht zurückzahlen kann, pfändet Juristin Margot ihm sein Gehalt, und das wiederum kann er Birgit nicht richtig erklären und muss die Hosen runterlassen. So wird aus dem Götterweib Margot nun also eine »miese Schlampe«, nur reicht diese Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber nicht richtig aus. – Margot war eine gute Kundin des Möbelhauses, als dessen Niederlassungsleiter Eric fungiert. Erst ruft Birgit mich an und kotzt sich lange bei mir aus. Dann ruft Eric mich an mit der Standardeinleitung: »Du bist doch Coach.«
Da er sich bekanntlich nichts vorzuwerfen hat, soll ich Birgit coachen, »damit die langsam mal wieder vernünftig wird«. Denn Birgit will sich scheiden lassen. Eric allerdings meint, ich soll sie so hinmodellieren, dass sie seine Dauerexkursionen »versteht«.
»Wenn hier überhaupt über etwas geredet wird, dann nur mit dir und über deinen promisken Zwang«, sage ich.
»Was für’n Zwang?«, fragt er empört. »Mich zwingt doch keiner, ich brauch das eben. Oder glaubst du echt, ich lass deswegen jetzt was anbrennen?«
»Deine Frau brennt schon«, sage ich. Vier Wochen später hält er ihr amtlich zugestelltes Scheidungsbegehren in der Hand, als er unangekündigt bei mir auftaucht.
Man kann nun über Eric sein moralisches Urteil fällen und sich damit bequem aus der Affäre ziehen. Fakt aber ist: Irgendwo tickt er nicht richtig. Nicht nur sein suchthaftes Hetzen nach Affären fällt auf, auch deren Unverzichtbarkeit für die Aufrechterhaltung seines Selbstwertgefühls, die narzisstische Ausblendung all dessen, was er in der Seele seiner Partnerin anrichtet, und auch die vehemente Abwehr von Verantwortung. Am auffälligsten allerdings ist ein immer wieder aus dem Nichts durchbrechender Groll, den er in sich trägt und den er vordergründig gegen die »Jordanplantscher« richtet – zusammenhangloser Antisemitismus also, der genauso resistent ist gegen Rationalität wie dieser gesamte Persönlichkeitsbereich.
Mein Coaching pflege ich normalerweise anzubieten und die Entscheidung darüber dem Klienten zu überlassen. Eric allerdings verdonnere ich dazu. In den ersten drei Sitzungen stoße ich nur auf betonierte Abwehr: »Ich bin eben so, ich brauch das eben, ich hab das immer so gemacht, wieso soll ich damit jetzt aufhören, ich hab doch alles im Griff.« (Übrigens eine Lieblingsfloskel von Coaching-klienten.) Immer sichtbarer wird, dass es bei Erics Affärensucht um eine psychische Überlebensstrategie geht: Er braucht diese »Erfolge«, denn nur damit kann er etwas zudecken, das er nicht (mehr) ansehen und noch weniger spüren will.
»Sexsucht« ist der Titel eines hervorragenden Werks von Kornelius Roth, in dem er die psychischen Hintergründe dieses offensichtlichen Zwangsverhaltens ausleuchtet. Die unübersehbare Symptomcharakteristik von Erics Verhalten legt die Vermutung nahe, dass es sich um ein viel breiter angelegtes Problem handelt, als er auch nur ansatzweise einräumen will. Folgerichtig zeigt sein Verhalten auch und gerade eine sogenannte Appellcharakteristik: den Hilfeschrei eines kleinen Jungen. Er heißt: Ich bin unfähig, dauerhaft Vertrauen zu empfinden; weder zu mir selbst noch zu anderen, und schon gar nicht zu Frauen. Ich kann mich nicht fallen lassen, denn das macht mich verwundbar. Allgemein kann ich mit Menschen nur manipulativ umgehen, denn so kontrolliere ich sie. Und nur wenn ich zu jeder Frau auf Distanz bleibe, fühle ich mich sicher. – Bloß, der unerfüllte Wunsch geliebt und angenommen zu werden, der sich in seinem dauerhaften Groll offenbart, bleibt auf diese Weise offen und treibt ihn weiter an. Von Affäre zu Affäre zu Affäre. In die anstehende dritte Scheidung, und – wie sich kurz darauf zeigt – in den Jobverlust, weil offenbar noch andere Kundinnen ihn bei der Geschäftsleitung angeschwärzt haben.
Roth zeigt nachvollziehbar auf, dass solche Charaktere über zutiefst zerrüttete Elternbeziehungen verfügen, selbst wenn der äußere Anschein anderes suggeriert und die jährlichen Familienrituale brav eingehalten werden. So auch bei Eric: der störrische und trinkfreudige Vater, ein rigider Katholik, der dem Kind jeglichen Körperkontakt verweigerte, neigte zu Ausbrüchen, vor denen Eric sich in eine besonders intensive Beziehung zur Mutter flüchtete. – Diese sich allerdings auch zu ihm, und so wurde der Vater zu einer randständigen Figur, die von beiden abfällig behandelt wurde und als positives Identifikationsobjekt für Eric völlig ausfiel. Als Eric von seiner Mutter spricht, laufen dem alten Haudegen unerwartet zwei Tränen über die Wangen. Für den Vater, »der meine Grenzen nie geachtet hat«, empfindet er nur Verachtung.
»Deine Mutter auch nicht«, sage ich.
»Was?«
»Auch sie hat deine Grenzen verletzt. Eure Beziehung hatte und hat etwas von einer symbiotischen Notgemeinschaft. Du hast dich bis heute nicht abgelöst von ihr.«
»Ich soll meine Mutter aufgeben?! Hast du ein’ an der Waffel?!«
Ich würde Eric gerne zu einem Düsseldorfer Spezialisten für Sexualstörungen schicken, doch das verweigert er strikt. Jetzt wird die Situation brenzlig: Macht er mich unbewusst zum Vater, dem er sich rachehaft verweigert, weil der ihm die Mutter wegnehmen will, dann kommen wir in schwieriges Fahrwasser. Ich muss lange über meine eigene Rolle nachdenken und bitte mir Bedenkzeit aus.
»Du verdammter Hund, du hast Recht!«, eröffnet er die nächste Sitzung.
»???« – Man kommt ja auch nicht immer gleich mit.
Dann sprudelt es aus ihm heraus, ein eruptiver Redeschwall mit gehetzter Stimme und verzerrten Zügen, geschlagene siebzig Minuten lang, während derer es in seinem Brustkasten arbeitet wie in einem Walzwerk. Nebenher leert er die ganze Kaffeekanne.
Bilder stehen im Raum: Der Vater, Kriegsgeneration, emotional schwerst gehemmt, hat ihn kein einziges Mal in den Arm genommen, nur beim Strafen war er zuverlässig. Die Mutter, bepöbelt und häufig zusammengeschrien, fühlte sich abgewertet und benutzt, wollte längst weg, »aber sie blieb nur wegen mir«.
Und so klammerten beide sich aneinander, ohne zu merken, dass sie sich gegenseitig überforderten: Die Mutter konnte Eric den Vater nicht ersetzen und Eric ihr nicht den Partner. Aber er genoss es, wie er sich plötzlich erinnerte, wie warm und angenehm ihr Frauenkörper sich anfühlte, wenn er als Elfjähriger mit ihr im Bett kuschelte, auch wenn er sich dabei etwas schuldig fühlte. Doch Mama genoss es auch und drückte ihn eng an sich. – Bis der Vater aus der Kneipe kam und Eric zurück musste ins eigene Bett, weg von der zärtlich streichelnden Mutter. Sobald er von ihr spricht, wird die machohaft-flache Stimme weich und warm. Und es wird erkennbar, wie viel Einsamkeit und Abwertung er kompensiert durch sein unentwegtes Jagen nach Erfolg bei Frauen.
Eine gesunde psychische Entwicklung jedenfalls ist unter solchen Umständen nicht möglich. Es wird ein Gemisch aus seelischer Vernachlässigung, unterdrücktem Hass, Grenzverletzungen und nicht zuletzt unterdrückten inzestuösen Wünschen – und zwar durchaus beidseitig. Nach zwei weiteren Sitzungen willigt Eric ein, zum Spezialisten zu gehen, und bittet Birgit um Verzeihung. Entgegen meiner Erwartung nimmt sie an. – Sage mir einer noch etwas über die Geheimnisse einer Frauenseele.
Ein Jahr später haben sich die Situation und Erics Ehe tatsächlich wieder stabilisiert. Eric, so scheint es, beginnt das erste Mal, eine Frau zu lieben.

Über die Fehlerkorrektur
Als die Kugel in den Erdwall rauscht, keine dreißig, vierzig Zentimeter rechts von mir, gucke ich erst mal interessiert hinterher. Eine 357 Magnum, die reißt einem ja doch ganz schöne Löcher in den Bauch.
»Hoppala!«, sagt der Manni freudig. »Ja, da schau her!«
Ich schenke ihm einen müden Blick. »Langsam könntest das mal lassen.«
Immerhin war’s jetzt das zweite Mal. Letzte Woche auch schon.
»Da war glatt noch eine in der Trommel!«
»Jetzt nimmer«, sage ich, »die anderen fünf sind eh raus.«
Der Manni guckt interessiert auf die rauchende Mündung. »Da is er rauskommen«, sagt er, »Gell? Aber i hab ja eh daneben ‘zielt!«
»Good for you.«
Für einen Schießtrainer ist er ja manchmal etwas zerstreut, der Manni. Auch für einen ehrenamtlichen.
Solche Dinge passieren, wenn man sehr lange zielt, dabei die Konzentration verliert und deshalb die Waffe wieder sinken lässt, während man mit einem leichten Druck des Zeigefingers den Abzug auslöst – den Daumen fest auf dem Abzugshahn – und sie so wieder entspannt. Dann geht der Hahn kontrolliert nach vorne, ohne den Schuss auszulösen. Die nicht verschossene Patrone allerdings wird durch die Bewegung des Abzugshahns in der Trommel weiterbewegt, als wäre sie jetzt leer. Hat man die Trommel durchgeschossen, rotiert die noch scharfe Patrone wieder in Abschussposition. Wenn dann jemand abdrückt, geht die Kugel raus. Es empfiehlt sich, in solchen Momenten nicht im Weg zu stehen.
»Ma’ darf halt nie auf jemand’ zielen«, sagt der Manni voller Inbrunst. »Des is schon wichtig.«
»Zielen nicht«, sage ich gereizt. »Mitzählen wär’ schon nicht schlecht.«
Manni hatte mir die Waffe aus der Hand genommen, um mir nochmals den weichen Druck der Fingerkuppe gegen den Abzugsbügel zu demonstrieren: So sanft, dass der Schuss praktisch von selber bricht. Die Mündung hatte knapp an meinem Körper vorbeigedeutet, als Mannis Theorie sich in die Praxis umsetzte. Vorige Woche auch schon. Beide Male fand ich zu Hause ein paar Schmauchspuren seitlich auf dem Hemd.
»Da hätt’st g’schaut, wenn i dich daschossen hätt’«, lacht der Manni etwas zu laut und wechselt die Papierscheibe aus. Als ich ihn hinterher bei einem Cappuccino auf seinen Fehler anspreche, lacht er nochmals jovial: »Ah was, i hab ja net auf dich ‘zielt, sondern extra daneben! No risk, no fun!« – Sein Verhalten deckt sich mit mir bekannten vereinzelten Stimmen seiner Kunden, die mit der Leistung seiner Installateursfirma unzufrieden waren: Es wird alles weggelacht, und es bleibt das Gefühl von ein bisschen zu viel Show. Wie man überhaupt bei Manni stets das Gefühl hat, dass er etwas arg viel Aufmerksamkeit braucht und sein Verhalten immer etwas aufgesetzt wirkt. Oft bekommt man das Gefühl: Da ist noch irgendwas dahinter, was er nicht zeigen will.
Was er nicht zeigen will, ist Betroffenheit, denn die wäre ein Schuldanerkenntnis – das Eingeständnis eines Fehlers also. Für die Histrioniker nämlich ist Schuld gleichbedeutend mit Untergang: Sie ertragen sie nicht, nicht einmal den Gedanken daran. – Und bisweilen, wenn man sieht, wie verzweifelt sie sich dagegen wehren, kommen einem instinktiv die Bilder eines kleinen Kindes, das sich vor Angst einnässt.
Womit wir es also zu tun haben, ist Schuldabwehr, die histrionisch präsentiert wird. Bekannt ist meist die andere Form der histrionischen Struktur: Gackernde Hysterikerinnen, die durch ihr schrilles und sexualisiertes Auftreten alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bei ihnen gehört es unvermeidlich zum Gesamtauftritt, dass sie Schuld und Verantwortung entrüstet von sich weisen – und seien diese noch so offensichtlich. Krassestes Beispiel war eine Bekannte, die unentwegt mit den Füßen an der schweren Glasplatte meines Wohnzimmertisches herumwackelte, bis diese sich selbstständig machte und mit sechzig Kilo Gewicht krachend aufs Parkett schlug. Auf meine erschreckte Frage: »Sag mal, hast du sie noch alle?« kam ein empörtes: »Was redest du denn für Zeuch, ich war das nicht!« – Schuldabwehr durch Verleugnung.
Die Männervariante bedient sich meist der jovial-herzlichen Inszenierung: Es wird mit aufgesetzter Fröhlichkeit geleugnet, was offensichtlich ist; wobei das Lachen hölzern wirkt, die Scherze seicht und gekünstelt. Dies nicht zuletzt, weil das unterliegende Schuldgefühl durch sie hindurchscheint wie Licht durch einen dünnen Vorhang. Schuld, sozusagen, wird weggelacht, wobei dem Betroffenen das schale und unzufriedene Gefühl verbleibt, während der Täter sich emotional aus dem Staub gemacht hat.
Diese Abwehrstrategie ist oft vorzufinden in autoritär bestimmten Unternehmenskulturen. Wo »perfekte Leistung« abverlangt wird (ohnehin eine Schimäre und Ausdruck eines ins Angsthafte übersteigerten Perfektionszwangs), wachsen die schneidig überspielten Versagensängste ins Pathologische. Nicht selten manifestieren sie sich in einer hohen Krankheitsrate, auch wenn diese dann verdrängt wird, weil die Mitarbeiter vor Angst zur Arbeit erscheinen. Typischerweise ist in diesen Häusern der Leistungsdruck so immens, dass die natürliche Einsicht, einen Fehler gemacht zu haben, blockiert ist durch Strafangst. Damit entfällt die Möglichkeit jeglicher Fehlerkorrektur zugunsten pathologischer Schuldabwehr: Da »Schwäche« nicht geduldet wird, kann nicht korrigiert werden, was offiziell nicht existiert. Jemand, der wie ich berufsbedingt in vielen Unternehmen unterwegs ist, kennt diese Männerrunden, die sich vor lauter Heiterkeit gar nicht mehr einkriegen können, während sie sich dabei unentwegt gegenseitig beobachten. – Man muss nur erst dahinterkommen, dass hier die nackte Angst regiert; und nicht zuletzt der Zwang, um jeden Preis »dazuzugehören«. Ausnahmslos alle – ich betone: ausnahmslos alle – weisen in ihrer Kindheitsgeschichte schwere traumatische Erfahrungen auf, die in der Regel eingebettet sind in eine repressive Erziehungsatmosphäre und ausgeprägte Zuwendungsdefizite. Solche Menschen schaffen es oft bis weit an die Spitze. Getrieben jedoch sind sie von Kindheitsängsten und Entwertungserlebnissen, gegen die sie verbissen anarbeiten. Ihre Erfolge freuen sie nicht wirklich. Eher sind sie eine Art »Gegenbeweis« der Art: Seht ihr, Papa/Mama, ich bin DOCH etwas wert!
Bei einem Handwerker wie Manni war es nicht ganz so krass. Ich machte keine Termine mehr mit ihm und verzichtete darauf, meine Schießkünste aufzufrischen. Ein knappes Jahr später stand er unerwartet vor meiner Tür. »Wie geht ‘n des, mit deiner Dings … deiner Coacherei?« Er war grau im Gesicht. Keine Scherze mehr.
Einer seiner Mitarbeiter hatte Mist gebaut, und Manni hatte es dem Auftraggeber gegenüber verschwiegen. Der Kunde hatte sich aufgrund der fehlerhaften Leistung verletzt und Strafantrag gestellt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Dazu hatte er Schadensersatzklage erhoben. Mannis Strategie, das Ganze mit flotten Sprüchen und ein paar Gefälligkeiten zu erledigen, war ins Leere gelaufen. Jetzt hatte er Angst um seine Existenz. Die ersten vierzig Minuten verbrachte er damit, mir dazulegen, was für ein Vollidiot der Kunde sei.
»Wenn einer sich z’wegens so was verletzt, dann g’hört der eing’sperrt wegen Dummheit! Des is jedenfalls meine Meinung. Aber bei unserne sauberne Herrn Juristen …«
»Genug jetzt, Manni.«
In Mannis Vorstellung war klar, wie das Coaching zu verlaufen hatte: Ich hatte seine Meinung über den Vollpfosten von Kunden zu teilen und ihm dann – quasi ex cathedra – zu sagen, wie er so einen erledigen konnte. »Und zwar so, dass der sich nie wieder rührt, verstehst!«
Erst in der dritten Sitzung, mit viel Mühe und einem Höchstmaß an Feinfühligkeit, brachte ich ihn dazu, sich selbst zu reflektieren. Das setzte unerwartet ein, wie ein Sturzbach, und Manni kam kaum mit dem Reden hinterher, so sehr purzelten auf einmal die Bilder durch seinen Kopf.
»Woher kommt diese Angst, Manni?«, fragte ich. »Woher diese panische Angst vorm Schuldsein?«
Er war rot angelaufen. Sein urgemütliches Handwerkergesicht hatte sich im Schmerz verzerrt.
»Wennst selber gar nix dafür kannst … und dann wirst trotzdem … Aaaah ja, Scheißdreck, glaubst …«
Er schwieg, und es arbeitete in ihm. Wir kannten uns seit unserer Kindheit, und urplötzlich schossen mir wieder diese Bilder durch den Kopf, als hätte der Manni sie gerade losgetreten.
»Die Kiesgrube, gell?«
Er presste die Lippen zusammen. »Nie wieder!«, explodierte es aus ihm. »Nie wieder, verstehst!«
Er schlug die Hände vors Gesicht.
Am Nordrand unserer Stadt war eine alte Kiesgrube gewesen. Als Jungs hatten wir dort oft gestöbert und gespielt. Nicht zuletzt, weil wir dort die Luftschächte eines alten Flak-Bunkers entdeckt hatten, in die wir gerne hineinkrochen. Die Leute warfen alles Mögliche in die Grube. Eines Tages entdeckten wir ein stinkendes Fass voller Bücklinge. Der Dritte von uns, ein Problemkind namens Hubert, ergriff einen davon feixend am Schwanz und wedelte damit herum, bis der Schwanz abriss und der Bückling quer auf Mannis weißes Sonntagshemd flog. Manni erstarrte, denn er wusste, was ihn mit dem schmutzigen Hemd zu Hause erwartete. Dann verdrosch er Hubert, bis der heulend davonrannte. Ich begleitete ihn nach Hause. Manni kam gar nicht dazu zu sagen, dass er schuldlos war. Sein Stiefvater, ein verbitterter Kriegsheimkehrer, der in Russland ein Bein verloren hatte, hatte blitzschnell seine rechte Krücke hochschnellen lassen und sie Manni über den Rücken gezogen. Während Manni von dem Schlag taumelte und vor Schmerzen schrie, verdrosch der Alte ihn, bis er sich nur noch wimmernd auf dem Boden rollte. Ich hatte bis zum Schluss entsetzt zugesehen und war dann davongerannt.
»I will nie wieder schuld sein, verstehst?«
»Die Schuld lag nie bei dir, Manni.«
Manni begann zu begreifen, dass seine Schuldabwehr war, was sie praktisch immer ist: der Schutzmechanismus eines Kindes gegen seelische und/oder körperliche Misshandlung. Umsonst entsteht keine Angst. In den folgenden Sitzungen begann er seine Angst abzulegen, dann stoppte er, weil seine Frau sich über die Kosten beschwerte. Aber wohl auch aus Stolz, denn den Rest wollte er alleine schaffen. Nebenher hatte ich ihn noch mit einem Münchener Anwalt zusammengebracht, der ihm half, einigermaßen heil aus der Sache herauszukommen.
»I weiß gar net, wie i dir danken soll«, sagte der Manni.
»Ist mein Beruf«, grinste ich.
»Echt, des hat mir sehr g’holfen, dein Zeugl. Ganz verstanden hab i’s ja net …«
Er haute mir die Pranke auf die Schulter. »Magst net wieder amal schießen geh’n, sag? Warst auf einmal verschwunden, damals!«
»Geile Idee, Manni«, antwortete ich, während mein Magen sich leicht zusammenzog. »Machen wir unbedingt!«

Agency & Communion
»Schneider hat’s zerlegt«, sagt der Klient. »Mit dem brauchen wir die nächsten vier Wochen nicht zu rechnen. Drum tu ich lieber vorher was. Proaktiv sozusagen, hehe.«
Klar. Proaktiv. Schneider war’s anscheinend nicht: Er hatte täglich massive Auseinandersetzungen im Büro, bis hin zum gegenseitigen Mobbing. Aufgrund seines schneidigen, erfolgsorientierten Auftretens, das die anderen als abwertend empfanden, wurde er zuerst nur abgelehnt. Dann schraubte die Konfliktspirale sich weiter nach oben. Auch der Klient ist Teil des Konfliktgeschehens, ein kleiner Gegenschneider, teilt kräftig aus, steckt kräftig ein. Doch das macht ihm, sagt er, nichts aus. Im Gegenteil beflügelt es ihn, »besser zu sein als die ganzen Idioten da«. Auf Schneiders Sympathie legt er ebenso wenig Wert wie auf die der anderen, er will schließlich selber »nach oben«. – Ein paar Tage nach dem Erstgespräch dekompensiert er. Abends beim Grillen mit den Schwiegereltern. Für die nächsten sechs Wochen ist nicht mit ihm zu rechnen.
Er sieht blass aus, als er wieder auftaucht, wirkt nachdenklich, in sich gekehrt. – Nicht gerade selten, wenn das Selbstbild einen schweren Schlag abbekommen hat. Gerade Männer im zweiten Lebensdrittel neigen ja dazu, sich eine Art ewiger Unbesiegbarkeit zu attestieren. Jedenfalls so lange, bis sie auf der Schnauze liegen. Tatsächlich stelle ich nicht selten eine gewisse Blindheit fest für die Erkenntnis, dass jemand bereits seine Eigensubstanz verbraucht. »Sie können im Kopf immer noch, wenn Sie mit dem Körper schon lange nicht mehr können«, sagte mir vor zwanzig Jahren mein Hausarzt, bevor ich mich kurz darauf auf der Intensivstation wiederfand, mit zwei, drei Tagen Restlebensdauer. Lesson learnt.
Es besteht bisweilen eine krampfartige Verdrängungs(un)kultur in Managerkreisen: Die Zelebration des eigenen Substanzverbrauchs, als vermeintliches Merkmal leistungsmäßiger Überlegenheit, ist nicht auszurotten. Nach außen hin verkauft als Dynamik und »Power« und vordergründig erlebt als narzisstische Bestätigung, kommen die Abstürze in den eigenen vier Wänden, wenn Gefühle innerer Leere sich einstellen angesichts der Tatsache, dass der eigene Organismus permanente Grenzüberschreitungen signalisiert. Insofern ist, abseits der gängigen Sichtweise, der Burn-out eine zutiefst positive Angelegenheit, denn er vermittelt eine klare Message: Hör lieber zu, bevor es echt zu spät ist. – Vom Burn-out erholt man sich. Von einigen anderen Dingen nicht mehr.
Die scheinbar Unbesiegbaren nämlich sind es, die das Gefühl verloren haben für die eigenen Belastungsgrenzen. Indikator einer bedenklichen Entwicklung aus psychologischer Sicht ist es stets, wenn die Außenkontakte buchstäblich gekappt werden und der Umgang mit Menschen sich nur noch unter Nützlichkeitsaspekten – sprich: Benutzungsstrategien – vollzieht. Der daraus resultierende Rückzug auf das oft gehörte »Ich brauch’ keinen!« mag ein subjektives Stärke- und Größenerlebnis vermitteln, de facto allerdings ist die vermeintliche Unabhängigkeit nur die Regression in eine kindliche Allmachtsphantasie.
Es mag dabei offen bleiben, ob überhaupt ein Mensch imstande ist, vor den Fährnissen des Lebens völlig alleine zu bestehen, oder ob diese Selbstüberschätzung dann auf der Zeitachse nicht zwangsläufig zum gefürchteten »hardware damage« führt. (Allein die Formulierung ist schon eine Aussage für sich.) Tatsache ist aber auch, dass eine derartige Einstellung zutiefst unphysiologisch ist: Sie ist in der Blaupause der Spezies Mensch nicht vorgesehen. – Schlimmer noch: Sie ist kontraproduktiv bis zur Selbstschädigung.
»Für alle Lebensformen sind zwei dialektisch aufeinander bezogene Modalitäten von Aktivität von existentieller Bedeutung: agency und communion. Als Basiselemente dienen sie der Interaktion des Individuums mit seiner Umwelt auf unterschiedlichste Weise«, schreibt Karl Köhle (Köln) im Standardwerk »Psychosomatische Medizin«. Man greift wohl nicht zu hoch, wenn man annimmt, das menschliche Verhalten generell und ganz besonders das im Arbeitsleben pendele zwischen diesen beiden verhaltensbiologisch definierten Polen: »Agency« bezeichnet Strebungen und Verhaltensformen, die existenzielle Interessen des Organismus als Individuum verfolgen. Agency strebt nach Selbstregulation, Selbsterweiterung und Beherrschung der Umwelt: Autonomie, Leistung, Kontrolle, Macht. »Communion« hingegen bezeichnet das individuelle Bedürfnis des Individuums nach Partizipation an einem größeren Organismus, sein fundamentales Verlangen, sich anderen anzuschließen, sich ihnen zugehörig zu fühlen, mit ihnen eine Einheit zu bilden: soziale Verbundenheit, Kooperation, Vertrauen, Intimität, Liebe. (Köhle, aaO). – Schon Freud, Adler und Balint haben es ähnlich formuliert.
Weniger akademisch: Beide Komponenten sind im Gesamtsystem Mensch einfach angelegt, das mag einem passen oder nicht. Wer die eine übersteigert, unterdrückt die andere. Nur: existenzielle Bedürfnisse lassen sich eh nicht abschalten. Sie steuern uns aktiv und drängen nach Erfüllung, nicht anders als Atmen, Essen, Schwitzen. – Wer’s nicht glaubt: Versuchen Sie mal, eine Woche lang kein Wasser zu lassen. In unserem Beispiel jedenfalls wird sichtbar, dass beide Kontrahenten – Schneider und der Klient – gleichermaßen die genetisch einprogrammierte Funktionsbasis verlassen und die Balance zwischen beiden Komponenten aufgegeben haben: Die Überbetonung der »agency« führt unbestreitbar zu Erfolgserlebnissen, doch ist soziale Isolation bis hin zur Vereinsamung keine Seltenheit. (»Außerhalb der Arbeit hat der keine Freunde mehr!«) Umgekehrt, die überbetont auf »communion« Ausgelegten sind die Kollegen, die jeder mag, aber die man nicht ganz ernst nimmt, weil sie sich nicht zu behaupten wissen. (»Netter Kerl, aber irgendwie’n Weichei!«)