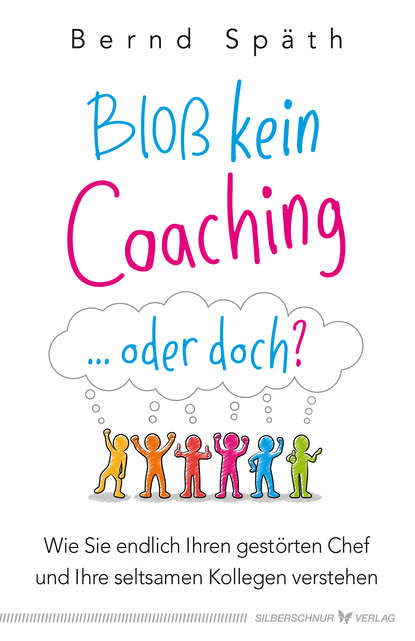- -
- 100%
- +
Also kommt es auf die individuelle (!) Balance an, und die ist nun mal individuell, weil die Menschen auch unterschiedlich sind. Entscheidend ist, dass beide Formen des Balanceverlusts mittelfristig hochpathogen sind. Denn es darf nicht übersehen werden, »dass der dialogische Austausch, an dem alle Sinne beteiligt sind, bis in die Regulation physiologischer Funktionen hineinwirkt.« (Köhle, aaO). Und hier eben schließt sich der Kreis: Ist der menschliche Austausch im Betrieb gestört oder verloren, entsteht eine tatsächlich lebensfeindliche Umwelt, die die Leute krank werden lässt. Nicht weil sie so empfindlich sind, sondern weil der Gesamtorganismus nicht darauf angelegt ist, in einem solchen Biotop dauerhaft zu überleben. Die Körperchemie entgleist. Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Haut sind die häufigsten Organe mit Signalfunktion.
»Homo est natura sua ens sociale« heißt es schon in der Theologia Christiana Fundamentalis: »Der Mensch ist seiner Natur nach ein soziales Wesen.«
Oder wie Martin Buber es formulierte: »Der Mensch wird am Du zum Ich.« – Jedenfalls dann, wenn er überleben will.

Über die Aggressionsverschiebung
Dem Flüchtling, so viel ist bekannt, wird praktisch alles hinten reingeschoben. Und das ist wahr, denn was man überall hört, kann nicht falsch sein. Sie bekommen kostenlos eine Wohnung. Sobald sie drin sind, fressen sie uns alles weg, nehmen uns unsere Frauen weg, stehlen – das machen sie ganz besonders gerne – alten Frauen die Fahrradln und werden praktisch überall frech. Man darf dem Flüchtling nix sagen, ohne dass er gleich zuhaut, denn der Flüchtling hat keine Kultur, sonst wär er ja keiner. Und ob er wirklich vertrieben worden ist, weiß man’s? Besser ist, man traut ihm nicht, denn von Natur aus ist er auch noch falsch. Und undankbar auf jeden Fall, denn der Flüchtling ist immer einer, der bloß die Hand aufhält. Deswegen gehört der, der ihn bei uns hereingelassen hat, »aufg’hängt«, aber heute traut sich ja keiner mehr was.
Wer nun glaubt, ich hätte politisch die Seiten gewechselt, der ist zu kurz gesprungen: Ich gebe lediglich Phrasen wieder, die ich während meiner Kindheit in den Fünfzigern des vergangenen Jahrhunderts täglich zu hören kriegte, und die ich als Sechs-, Siebenjähriger willig nachplapperte. Umso williger, als mir »einer von denen« mitten im Winter die Unterlippe aufgeschlagen hatte, nur weil ich ihn traditionsgemäß als »Flüchtlingssau« bezeichnet hatte. So was wäre umgekehrt in Ordnung gewesen, aber dem Flüchtling stand so etwas – da war man sich einig – nicht zu. Schließlich war er ein Zugezogener, den niemand hierher eingeladen hatte.
So war »der Flüchtling« zutiefst ungewollt, und man ließ es ihn spüren. Allerorten wurde gezischelt, als im Westen meiner Heimatstadt Ackerland als Bauland ausgewiesen wurde und man ganze Blocksiedlungen für ihn hochzog, sogenannte »Heimstätten«, nach denen man praktischerweise die Heimstättenstraße benannte, damit klar war, welche Gebiete man als Einheimischer zu meiden hatte. Denn dort wohnten die »Grattler« aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Perfiderweise hatten die Neubauten bereits Wasserspülung in den Toiletten, während dies damals beim Normalbürger eher die mondäne Ausnahme war, und so schäumte der Zorn hoch, dass man Leuten die »früher nix g ‘habt« hatten, jetzt den schieren Luxus in den Hintern blies. Ausgegrenzt und ungewollt bildeten die hier geborenen Flüchtlingskinder eigene kleine Gangs, mit denen sie uns »Normale« schikanierten und verprügelten, womit auch dem Dümmsten klar werden musste, »was für einer« der Flüchtling war und dass er keinerlei Anzeichen von Integrationsbereitschaft zeigte. Noch dazu war klar, dass der Flüchtling nicht mehr gehen würde, weil »der Polack’« sein Land besetzt hatte und es nicht mehr herausrückte. So dass der Flüchtling viele Generationen lang als Flüchtling unter uns leben würde – von manchen auch tituliert als »Berufsflüchtling« -, ohne jemals »einer von uns« werden zu können, denn das war er ja nicht.
Die deutsche Nachkriegsgesellschaft stand vor einer riesigen Aufgabe, die sie unter Führung des damaligen Kanzlers Adenauer größtenteils bravourös bewältigte, bedenkt man, in welchem zerbombten Zustand das Land sich befand, in das Millionen deutscher Vertriebener hineinfluteten. Ob man es schaffen würde, war kein Diskussionsthema, denn eine Alternative gab es nicht. Die »Argumente« jedoch, die man tagtäglich von einer frustrierten Bevölkerung zu hören bekam, dürften den meisten Lesern aus aktuellem Anlass bekannt vorkommen. Ihre Dummheit, ihre Gehaltlosigkeit und ihre Infamie entstammen offenbar untersten Triebschichten, die so stark sind, dass sie damals jede realitätskonforme Annäherung an das nicht zu leugnende gesellschaftliche Problem verhinderten, so wie sie es heute wieder tun. Selbst die Kinder der Verhassten, so niedlich und liebenswert sie als Einzelfälle waren, vermochten die Front nicht aufzuweichen: »Am End’ bleibts’s ein Flüchtling. Des is jedenfalls meine Meinung!«
Territorialität, Nahrung und Reproduktion sind nach Irenäus Eibl-Eibesfeldt, dem großen Schüler des Verhaltensforschers Konrad Lorenz, die verhaltensbiologischen Grunddeterminanten des Menschen, deren, wenn auch nur vermeintliche, Verletzung zu reflexhaften Abwehrreaktionen aus tiefsten Hirnregionen führt: das Eindringen ins eigene Gebiet, das »Wegfressen« eigener Ressourcen, der »Diebstahl« der eigenen Frauen und Männer zu Reproduktionszwecken, das löst archaische Aggression aus, bei der der Verstand außen vor bleibt. Und man merkt ja auch, dass Stimmungen gegen Migrationsgruppen stets resistent sind gegen Sachargumente, während die Stimmungsmacher aus ihrer Befindlichkeit heraus die Realität selektiv wahrnehmen und nur bestätigende Gesichtspunkte akzeptieren. Deren Hinterfragung hingegen führt zu Aggression und/oder Gewalt, sei es durch das Verprügeln »linker Zecken« oder das Anzünden von Flüchtlingsheimen.
Ein häufiges Argument gegen »den Flüchtling« war in meiner Kinderzeit, sie seien dahergekommen und hätten »nix zum Fressen« gehabt, was bei nüchterner Betrachtung nicht weiter verwundern dürfte. Der Flüchtling habe daraufhin Bauernhöfe aufgesucht und um etwas zu essen gebeten, wenigstens für die Kinder, doch meist sei er barsch weitergeschickt worden. Seine Verschlagenheit habe sich nun darin offenbart, dass er tatsächlich nicht weiterging, sondern zu beten anfing. Da hätten die meist recht katholischen bayerischen Bauern »nimmer aus’können« und murrend etwas herausgerückt. De facto also habe der Flüchtling die Unglücklichen erpresst. Heute nennt man das »Victimblaming«.
So horribel dieses ganze Gerede einerseits ist, so aufschlussreich ist es im Hinblick auf die Psychologie derer, die es von sich geben. Denn es offenbart ihre Projektionen: Selber reflexhaft aggressiv aufgeladen von der nicht zu leugnenden Verletzung ihrer primären Matrix Territorialität/Nahrung/Reproduktion, projizierten die Einheimischen ihre eigene Aggression nach außen: auf Menschen, die genau diese existenzielle Troika verloren hatten. Nicht länger konfrontiert mit der eigenen Aggression, konnten sie so ihr biederes Selbstbild aufrechterhalten, denn die Feinde kamen selbstredend von außen und waren keine Hilfesuchenden, sondern eine Art von Wegfressern. – Wohlgemerkt: Es soll nicht Partei ergriffen oder polemisiert werden. Doch sei darauf hingewiesen, dass bei einer derartigen psychischen Konstellation praktisch keine Chance mehr besteht, ein real existierendes Problem mit sachgemäßen Strategien zu lösen. Wer Parallelen sieht zur heutigen Situation, der möge sich nicht wundern. Auch heute werden real nicht begründbare »Ängste« vorgeschoben, um eine aus tiefsten Hirnregionen emanierende Wegbeißreaktion zu legitimieren. Kein Wunder also, dass einem vieles daran ziemlich pathologisch vorkommt.
Betrachtet man das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern, so bleibt man erst einmal ratlos: Wer dringt hier ein und raubt Frauen und Nahrung? De facto niemand bzw. eine lächerlich geringe Zahl von Migranten. Dennoch war die »Flüchtlingsproblematik« das Hauptthema der Demagogen und die Ursache ihrer Stimmengewinne. Das Versagen der Politik offenbart sich nun gerade in ihrem recht einfältigen Geschwurbel zu diesem Phänomen. Nach allen Gesetzen der Logik kann man nur gegen einen »Eindringling« vorgehen, der auch existiert. Existiert er real nicht, bekommt die ganze Geschichte etwas Wahnhaftes. – Es sei denn, es existiert ein wirklicher Triebstau, der mittels einer sogenannten »Aggressionsverschiebung« kompensiert wird.
So jedenfalls bezeichnet die Sozialpsychologie die »Tendenz, Aggressionen gegen unbeteiligte Dritte zu richten, wenn sie nicht gegenüber der ursprünglichen Quelle der Frustration zum Ausdruck gebracht werden können«. Und das kommt dem Ganzen schon viel näher. Die aufgestaute Wut, vorwiegend in ostdeutschen Regionen, mag berechtigt sein oder nicht, sie ist jedenfalls da. Und wer damals mitverfolgte, wie dilettantisch und verantwortungslos die Vereinigung durchgezogen wurde, der wird den Ostdeutschen ihre Wut nicht absprechen können. Schon Hans Modrow, der letzte DDR-Ministerpräsident, mit dem ich wenige Tage vor der ersten gesamtdeutschen Wahl die erste Talkshow in Bonn durchführte, warnte in unserem Gespräch genau davor.
Man müsste also ganze Regionen unseres Landes sozusagen »ent-wüten«, wollte man dem Problem gerecht werden. Das jedoch ließe sich nur durch eine langfristig denkende politische Konzeption bewerkstelligen, an der es fehlt. Denn »Psychodynamik« ist in der Politik ein unbekannter Begriff, »Verwaltungsvorschrift« dafür umso populärer.
Allerdings sind diese Verschiebungen nicht nur in der politischen Landschaft anzutreffen, sondern fester Bestandteil eines jeden analytisch orientierten Coachings: Ängste und Projektionen, die aus der Kindheit stammen und dort jede Berechtigung hatten, werden nun auf neue Objekte gelegt.
Chefs, Kollegen, Teilhaber und noch einige andere. Die Mutter, die von mir immer nur verlangte, widerspruchslos zu funktionieren, lege ich nun auf eine zickige Untergebene, derer ich nicht Herr werde. Den autoritären und leistungsfordernden Vater finde ich wieder im Geschäftsführer, der sich wie ein Trampel benimmt. Und im Flüchtling erkenne ich entweder den konkurrierenden Artrivalen oder das Bild meiner eigenen Schutzbedürftigkeit aus frühen Jahren. Letzteres dürfte dem Menschsein näher kommen als jeder animalische Primärreflex. Und so wäre es langfristig sinnvoller, die Ängste anzusprechen, als deren Träger zu verdammen. Da die Diskussion von beiden Seiten aber meist nur reflexorientiert geführt wird, sehe ich da schwarz.

Überlegenheit und Schwäche
»Sie machen mir gleich mal einen Zeitplan«, sagt der Herr Geschäftsführer.
Er hat sich auf die Couch platziert, mich kritisch gemustert und befehlsgewohnt Kaffee bestellt.
»Nö«, sage ich.
»Wie bitte?«
»Ich bin nicht Ihr Angestellter.«
»Ich bezahle Sie!«
»Nicht dafür, dass ich pariere. Das schminken Sie sich gleich mal ab.«
»Ja, was ist denn das?!«
»Man nennt es Coaching. Und es heißt nicht, dass Sie mich gleich mal in den Griff kriegen und wir hier Ihr System installieren.«
»Warum nicht?«
»Weil dieses System Sie hierhergebracht hat.«
Da fällt ihm dann doch das Gesicht herunter.
»Würden Sie mir mal mit drei Sätzen Ihren Vater beschreiben?«
Die Antwort ist ein weitschweifiger, seltsam verschwurbelter Monolog, der schnell etwas klar werden lässt: Der Vater war eine autoritäre, unterdrückende Figur, bei der es außer Parieren nichts gab und bei der die Vorstellungen der Familienmitglieder absolut nichts zählten, nicht anders als ihre emotionalen Bedürfnisse nach Nähe, Wertschätzung, Anerkennung und dergleichen. Deren Kompensat war »Leistung« – die einzige Möglichkeit, ein Minimum an positiver Aufmerksamkeit zu erwirtschaften. Der Sohn, der sogar die verbale Konfrontation mit dem zutiefst negativen Vater-Imago bis heute ängstlich vermeidet, hat hinter seiner Cheffassade ein sogenanntes »Vater-Introjekt«. Er beschreibt ihn nur indirekt und zeigt Tendenzen einer wenig realitätsgemäßen Idealisierung, mit der die bis heute unbearbeiteten Hassgefühle gegenüber dem Vater aufgefangen werden sollen.
Anders gesagt: Mein Besucher wurde nicht erzogen, sondern dressiert. Anderes als engmaschige Kontrolle, die jede Form von Autonomie als Abweichung ahndete und mit barscher Abwertung verband, hat er niemals kennengelernt. Und jetzt sitzt er mit knapp fünfzig hier und will, dass ich ihm »tools« beibringe – rein technisch natürlich -, denn die Firmengesellschafter haben moniert, er wisse nicht auf Menschen zuzugehen. Kein Wunder, bei der Riesenangst, die der Mann mit sich herumträgt.
»Ich habe mit fünf Coaches Termine ausgemacht und werde mir den aussuchen, der mir am geeignetsten erscheint«, knallt er mir kühl lächelnd hin, im offensichtlichen Vollgenuss seiner Macht. »Aber Sie können sich ja anstrengen.«
»Jetzt haben Sie nur noch vier«, sage ich und lasse ihn weiterziehen.
Ein Mensch, der einem Menschen nicht anders gegenübertreten kann als von oben herab und kontrollierend, ist ein armer Mensch. Der Kern seiner Persönlichkeit ist stark geschwächt, das Selbstwertgefühl gering und so verbleibt ihm für den Erhalt seines Selbstbildes nur eine Position: die des demonstrativ Überlegenen. Sie gibt ihm das dringend benötigte gute Gefühl, jedoch speist dieses sich nicht aus echter Souveränität – und damit Gelassenheit, die Augenhöhe verträgt -, sondern aus einer tiefsitzenden Selbstunsicherheit, die den Betroffenen pausenlos dazu zwingt, sich über andere zu stellen. Solche Klienten sind schwierig, denn sie zwingen den Coach auf jeden Fall: entweder zu dem, was der Klient wünscht, oder zu einer Reaktion, die klare Grenzen setzt. – Damit besteht die ernsthafte Gefahr, dass sich das Coaching in einem Kreis dreht, dessen Drehgeschwindigkeit der Klient bestimmt. Der Coach ist dann gefangen und muss achtgeben, dass er nicht von oben bis unten manipuliert wird.
Derartige Strukturen sind in aller Regel das Resultat eines langanhaltenden psychischen Missbrauchs, sei es durch autoritäre Väter oder Mütter oder deren Ersatz, wie zum Beispiel Pflegeeltern. Oft auch ist es ein ganzes soziales Milieu, das sich über autoritäre Anmaßung und entwertendes Verhalten gegenüber Kindern definiert. (Man denke nur einmal, wie viele Mitglieder meiner Jahrgänge, die unter den nach außen stets biederen Tätern der Nazizeit aufzuwachsen hatten, später psychisch erkrankten. Ich erschrecke bisweilen, wenn ich mir die Zahlen aus meinem eigenen Schuljahrgang ansehe.) Auch hier sind meist Introjekte aktiv.
Was also ist ein Introjekt? Vereinfacht gesagt ist es die Aufnahme eines äußeren Wertes oder einer äußeren Person in das Innere eines Menschen. Negativ wird es dann, wenn es in die Kinderseele eines Klienten quasi gewaltsam hineingerammt wurde. Wenn also keine Möglichkeit bestand, beispielsweise den als liebevoll erlebten Vater als psychische Wirkgröße in sich aufzunehmen und sich im späteren Reifestadium damit zu identifizieren (»Mein Papi kann alles!«) und ihm aus eigenem lustvollem Antrieb nachzueifern. Sondern wenn der autoritär und aufdringlich herrschende Vater jede Ich-Grenze seines Kindes selbstherrlich ignoriert, um ihm seine eigenen Werte nicht zu vermitteln, sondern aufzuzwingen. – Fritz und Laura Perls, die Erfinder der Gestalttherapie, definieren es so: »Bei der Assimilation verwandelt der Organismus (als Gesamtheit von Körper, Geist und Seele) Neues aus der Umwelt in Eigenes, das er zur Selbsterhaltung und zum Wachstum benötigt. Bei der Introjektion wird das Neue aus der Umwelt ohne Prüfung und Umwandlung als Ganzes in den Organismus aufgenommen, da an der Kontaktgrenze u.a. die Bewusstheit herabgesetzt ist oder völlig fehlt. (…) Das so entstandene Introjekt bleibt im Organismus ein Fremdkörper.« Nicht zuletzt bei der Entstehung einer Borderline-Störung, die ja immerhin schon mit präpsychotischen Schüben verbunden ist, spielen negatives Vater- und Mutter-Introjekt nach Otto Kernberg eine entscheidende Rolle.
Die so übernommenen Elternbilder, also »Vater-Imago« und »Mutter-Imago«, werden in aller Regel von den Betroffenen tabuisiert: Schon der bloße Gedanke an Kritik ist unzulässig und wird im Gespräch sofort blockiert. Die Eltern sind zum Teil des eigenen Ichs geworden. Ihre Entidealisierung würde nicht nur hypothetisch, sondern tatsächlich zum Zusammenbruch des Ichs führen, oft auch mit massiver körperlicher Symptomatik. Denn die erst äußerlich und später dann innerlich erzwungene Identifikation mit diesen Elternfiguren ist nichts anderes als die schon von Anna Freud sogenannte »Identifikation mit dem Aggressor«: Sie schützt das eigene psychische System und bildet eine Art »letzter Notbremse« vor einem drohenden Zusammenbruch des Selbst angesichts überwältigender Attacken und nicht integrierbarer Affekte. Leicht vorstellbar, wie schädigend dieses System ist. Leicht vorstellbar auch, dass dieses bizarre Identifikationssystem meist lebenslang wirkt und so von Generation zu Generation weitergegeben wird. So erklären sich die meisten unseligen Familientraditionen, seien sie von Gewalt geprägt (Wilhelm II., Hitler, Himmler, Stalin u.a.), von Versagen, von Alkohol, von Promiskuität und Selbstschädigung (Kennedy-Clan) – die Liste ist letztlich endlos. Das »Glück« in diesen Clans jedenfalls ist häufig ein neurotisch inszeniertes, bestimmt von Verleugnung und Gruppendruck.
Ich entsinne mich eines Klienten, bei dem jede Sitzung nach dem gleichen Muster verlief: Er brachte Material dar, dessen Grundtenor es war, dass seine außerordentlichen Fähigkeiten weder verstanden noch gewürdigt würden. Wir bearbeiteten die tiefe Kränkung, die seine Kindheit ihm vermittelt hatte: Ein ungehobelter, bäuerischer Vater, dem die Hochbegabung seines Sohnes regelrecht zuwider war und der folglich in ausgeprägter Geistesfeindlichkeit alles zertrat, was außerhalb seines sehr engen Horizontes im eigenen Kind zu sprießen begann. Der Klient reflektierte, verstand, wurde von heftigen Emotionen bewegt und fühlte sich endlich angenommen. Dann, unversehens, gab er mir jedes Mal eine drüber, indem er mir mit einem hingeworfenen Halbsatz bedeutete, wo ich meinen Platz zu suchen hatte – in etwa neben dem Hundenapf. Er gab also die erlittene Entwertung weiter und konnte sich so wenigstens für einen kurzen Moment überlegen fühlen, auch wenn es bald wieder kippte. Beeindruckend war, mit welcher Verbissenheit ein zweifach promovierter Akademiker pausenlos daran arbeitete, nur ja nie wieder »unten« zu sein, und dafür völlig unrealistische Huldigungen einforderte. Für eine rechtliche Auseinandersetzung vermittelte ich ihm als Anwalt einen ausgewiesenen Spezialisten des Fachgebiets, mit dem er umgehend Krach bekam, weil dieser sich weigerte, seine rechtlichen Belehrungen anzunehmen. – Das zutiefst entwertende Vater-Introjekt in ihm leistete ganze Arbeit mit entsprechend verheerenden Folgen für das Leben des Mannes.
In recht mühseliger Arbeit gelang es, ihm bewusst zu machen, dass er seine bizarre Selbstüberhöhung benötigte, um sich von seiner Vergangenheit nicht in die Tiefe ziehen zu lassen, und dass die – wie er es gelernt hatte – gewaltsame Einforderung von Anerkennung und Wertschätzung rein angstinduziert war und genau das Gegenteil des Gewünschten bewirkte. Erst reagierte er sehr ärgerlich, dann wurde er sehr still. Dann entschuldigte er sich und meinte, er habe viel an sich zu arbeiten. Es war einer der kleinen Wendepunkte, die man bisweilen erreicht und die einen freuen, so als Coach. – Sein Introjekt behielt er, aber es hatte aufgehört, ihn zu vergiften. Und so probierte er mit zunehmendem Vergnügen den Verkehr auf Augenhöhe. Nur seinen Vater verfluchte er weiterhin.

Über die illusionäre Verkennung
Der ganze Mann wirkt irgendwie »gehalten«. Sein Hemd ist weiß, der Kragen steht, die einfarbige blaue Krawatte ist mit der Mikrometerschraube gebunden und die ärmellose Weste sitzt wie auf dem Reißbrett. Nicht anders die mit dem Messer gescheitelten dunklen Haare: Kein einziges, das es auch nur wagen würde, sich dreist querzulegen. – So sieht gelebte Ordnung aus. Nicht Ordentlichkeit, sondern Ordnung an sich, der edelste aller menschlichen Werte, denn das Leben hat durchdacht und geregelt zu sein bis in seine letzten Falten. Der Herr, Ende dreißig vielleicht, hat eine kleine IT-Firma, und für die will er jetzt ein Direct-Mailing-Konzept, das ich ihm mit meiner Agentur erstellen soll. – Machen wir, klaro. Wir vereinbaren einen Termin für die Folgewoche, dann wird er uns in unseren Geschäftsräumen besuchen.
»Bitte schicken Sie mir eine schriftliche Terminbestätigung«, sagt er. »Es muss ja alles seine Ordnung haben.«
Na sicher doch.
Wenn ein zutiefst akkurater Mensch völlig zerrupft daherkommt, so ist das auch für einen abgeklärten Agenturchef befremdlich: das Gesicht verschwollen, die Lippen dick und eingerissen. Von der linken Braue zieht sich außen ums Auge ein riesiges schwarzes Hämatom bis zum Wangenknochen. Um den Rand der linken Augenhöhle leuchtet dazu eine zentimeterlange schrundige Narbe. – Sieht nach Autounfall aus. Oder nach Sturz vom Balkon.
»Ja, um Himmels willen«, sage ich fassungslos.
Erst mal gibt’s eine Tasse Kaffee, die er vorsichtig und offensichtlich nicht schmerzfrei schlürft.
»Nix für ungut«, sage ich, »aber was ist denn passiert?« Der Mann wirkt immer noch verstört. Etwa so, als hätte neben seinem zweifellos wohlgeordneten Frühstückstisch ein Artilleriegeschoss eingeschlagen.
»Ich bin nun mal ein disziplinierter Mensch«, mümmelt er aufgewühlt und richtet sich dazu linealgerade auf. »Bei mir hat nun mal alles seinen Platz!«
»Jawoll!«, sage ich und kapier einfach nix.
»Vor fünf Tagen …« – er ringt mit sich und atmet schwer – »habe ich mich zur Ruhe begeben. Ich sitze wie jeden Abend am Rand meines Bettes und hatte die Hosen bereits in den Spanner gehängt.«
»Aha!«
»Gerade als ich meinen rechten Schuh ausgezogen habe und ihn auf den Spanner ziehe …« (Hmmm, Hosen aus, Schuhe an, denke ich mir. Junge, wie ziehst du dich aus?) »… bekomme ich einen furchtbaren Schlag auf das linke Auge. So stark, dass mein Brillenglas zerbrach! Und sofort begann ich zu bluten.«
Da wird einem ja doch anders.
»Zuerst war ich richtig benommen, dann schrie ich laut um Hilfe, denn ich dachte selbstverständlich an einen Überfall! Selbstverständlich!«
»Würd’ ich auch.« Ich überlege, ob ich mir für solche Fälle nicht doch was in die Schublade legen soll.
»Oh Gott, mir schlug das Herz bis zum Hals! Ich konnte ja nichts erkennen! Es war ja dunkel!« (Also halten wir fest: Licht aus. Hose ausziehen, über die Schuhe. Hose im Dunkeln auf den Spanner. Dann im Dunkeln auf den Bettrand setzen, Schuhe ausziehen und Spanner rein. Schuhe vermutlich im Dunkeln auf einen mnemotechnisch markierten Platz stellen, so dass man sie im Falle eines Brandes, einer Explosion des Hauses oder eines Überfalls durch die Truppen einer feindlichen Macht im besten Wortsinne blind greifen kann.)
Seine Brust, sie hebt und senkt sich. Es wabert in ihm. Furchtbares muss sich abgespielt haben, so wie er mich ansieht.
»Okay. Haben Sie die Polizei gerufen? Hat man den Kerl gefangen?«
»Nein«, kommt es aus gepressten Lippen, eine Stimme, aus der die Bitterkeit herausläuft wie aus einer überfahrenen Zitrone.
»Hmmmm …«
»Es war kein Überfall. Es war der Schuhspanner.«
Wenn ich es mir jemals im Leben hoch angerechnet habe, trotz inneren Explosionsdrucks ernst geblieben zu sein, dann in diesem Moment.
»Der Schuhsp…?«
»Ja!«, kommt es so abgehackt, als sei der Verrat eines Freundes bekannt zu geben.